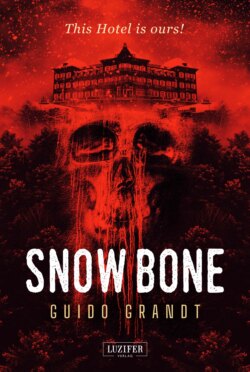Читать книгу SNOW BONE - Guido Grandt - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2-1
ОглавлениеEs war eine unheilverkündende Nacht. Die Luft war angereichert mit einem sich windenden Etwas. Roh, bösartig und absolut tödlich …
Draußen zerrten und rissen die Naturgewalten weiter an den mächtigen Mauern des Hotels. Unablässig heulte und fegte der schneidige Wind um die säulenbewehrte Fassade. Das Gebäude ächzte, stöhnte und knarrte wie ein Schiff auf offener, stürmischer See. Vor den kathedralenartigen Fenstern fielen pausenlos Schneeflocken. Selbst von der Serpentinenauffahrt war nicht mehr viel zu sehen, geschweige denn von den Parkplätzen. Die Sport- und Kinderspielplätze waren bis auf halbe Höhe im Schnee begraben. Genauso die Taxi- und Bushaltestellen, die Garagen und die Geräteschuppen. Manche Wehen erreichten bis zu sieben Meter und begruben alles unter sich. Selbst die überdachte Aussichtsterrasse am Ostflügel des Snow Hill Hotels war mit Schnee und Eis bedeckt. Die nächtlichen Temperaturen blieben konstant bei Minus fünfzehn Grad.
Überall auf den Etagen herrschte geradezu eine Grabesstille. Ned und Laura waren nach dem Lunch genauso auf ihren Zimmern geblieben, wie Tobey, Veronica und Britt. Keiner von ihnen verspürte große Lust dazu, ihre Zeit mit den ungehobelten Jägern totzuschlagen. Wenn man sich aus dem Weg ging – und das war in einem Hotel dieser Größe ja wohl möglich – würde es auch zu keinen neuen Spannungen kommen. Nur bei den Mahlzeiten würde man sich zwangsläufig begegnen. Außer der Hausmeister würde zukünftig getrennte Essenszeiten einführen, was wiederum zu einem neuen Streit über das Wenige, was sie noch an Proviant besaßen, führen konnte. Die Gefahr war natürlich groß, dass eine Gruppe die andere verdächtigen würde, mehr zu bekommen.
Jack Shaffer, Ray Romero, Peter York und Eric Waters verspürten jedoch kein Bedürfnis, sich stundenlang in ihren zugewiesenen Zimmern aufzuhalten. Viel lieber saßen sie in der verwaisten Cocktailbar. Diese lag, wenn man die Eingangshalle durchschritt, rechterhand zwischen dem Speisesaal und dem Restaurant.
Die rauen Burschen saßen auf kostspieligen ledernen Barhockern um eine rechteckige, Mahagonitheke herum. Links und rechts von ihnen ragten ledergepolsterte Nischen mit hohen Rückenlehnen und glänzenden, schwarzen Tischen auf, die für Gäste gedacht waren, die es etwas ungestörter liebten. Sie erstreckten sich von der hohen Eingangstür aus nach beiden Seiten und machten dann einen Bogen um die lange Theke. Die gedämpfte Barbeleuchtung sorgte für eine intime Atmosphäre.
Alle Regale bis auf zwei waren leer. Reihen von schimmernden Flaschen mit verschiedenen Whiskey-, Wermut-, Weinbrand- und Likörsorten waren dort untergebracht. Wild Turkey, Gilby’s Sharrod’s Private Label, Jim Beam, Seagram’s, Kentucky Straight Bourbon, Tennessee Whiskey, Martini, französischer Cognac, Gin … Die Weine und Champagner hingegen waren ausgeräumt und standen wahrscheinlich irgendwo in den Vorratsräumen. Die auf Hochglanz polierten Bierhähne und die darunter liegenden Abflussbleche waren staubtrocken. Aber obwohl es kein Bier gab, schien noch immer das gärige, feuchte Aroma des Gerstensafts in der Luft zu liegen, geschwängert mit dem Geruch von Hochprozentigem sowie Reinigungsmitteln.
Irgendwo hatte Jack einen Aschenbecher aus schwerem Kristallglas gefunden sowie drei Streichholzheftchen, die jetzt vor ihm auf dem Mahagonitresen lagen. In seiner Rechten hielt er eine glimmende Zigarette. Träge kräuselte sich der Rauch zu der hohen Decke empor.
Außerdem standen vor den nächtlichen Barbesuchern Gläser mit Kentucky Straight Bourbon und Tennessee Whiskey, denen sie schon reichlich zugesprochen hatten.
»Der Schneesturm wird nicht so schnell vorübergehen«, meinte Eric Waters lispelnd. Genauso wie Shaffer konnte er die Wetterlage am besten von allen beurteilen, schließlich arbeiteten und lebten er und sein Freund und Kollege als Holzfäller im Wald. Die freie Natur war ihnen deshalb mehr vertraut, als alles andere.
»Selbst wenn, dann wird es Wochen dauern, bis der Rückweg ins Tal wieder passierbar ist«, ergänzte Jack mit heiserer Stimme und zog danach geräuschvoll an der feuchten Kippe.
Romero nahm einen großen Schluck. Warm lief der Bourbon durch seine Kehle und erzeugte im Magen ein wohliges Gefühl. »W-W-Wenn uns das E-E-Essen ausgeht, m-m-müssen wir uns e-e-ben selber s-s-s-schlachten …«
»Red‘ keinen Scheiß, Ray«, fuhr ihn Peter York an. »Das ist nicht witzig.«
»Warum reagierst du denn so gereizt?«, wollte Waters wissen.
»Ich habe erst vor Kurzem eine TV-Dokumentation gesehen, die mir eine Gänsehaut verursacht hat und das will schon was heißen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist im Oktober 1972, eine Chartermaschine mit einem uruguayischen Rugbyteam, samt deren Freunden und Angehörigen an Bord mitten in den schneebedeckten Gipfeln der Anden abgestürzt. Einige hatten überlebt und mussten schließlich in über 3.600 Metern Höhe ohne Nahrungsmittel und ohne Hoffnung auf Hilfe ums Überleben kämpfen. Neben den eiskalten Temperaturen und den tödlichen Lawinen war der Hunger irgendwann ihr schlimmster Feind.«
»Spuck schon aus, was du damit sagen willst, Peter.« Jack drückte den Zigarettenstummel im Aschenbecher aus und wischte sich Asche von seiner Hose.
»Um nicht elendig zu verhungern, beschlossen die Überlebenden schließlich, menschliches Fleisch zu essen, weil sie keine andere Nahrungsquelle hatten.«
»V-V-Von wem d-d-denn?«
»Von den Leichen, die unter dem Schnee lagen, Ray! Kapierst du das?« Obwohl Peter York einen ganzen Kopf kleiner war als sein Kumpel, hätte er ihm am liebsten eine gescheuert, so sehr wühlte ihn diese Geschichte auf. Seit sie erfahren hatten, dass in dem von der Außenwelt abgeschnittenen Snow Hill Hotel die Lebensmittelvorräte fast gänzlich aufgebraucht waren, konnte er an nichts anderes mehr denken. Nur noch an Kannibalismus. Daran, wie er seine Zähne in Rays, Erics oder Jacks kaltes, rohes und leichenstarres Fleisch schlug … wie er dicke Brocken herausriss, und sie hinunterwürgte …
York leerte sein Glas mit einem Zug, um sich nicht über der Mahagonitheke übergeben zu müssen.
»Ein bisschen an der sexy Britt herum zu nagen, würde mir nichts ausmachen.« Shaffer lachte auf.
»Denk doch nur mal an ihre prallen Titten, der pure Wahnsinn«, stimmte Waters ihm zu. Er und Jack waren die einzigen Verheirateten unter den vier Jägern. Eric hatte sogar zwei Kinder. Dennoch träumte er davon, eine Pussy wie Britt unter den sprichwörtlichen Hammer zu bekommen. Jack dachte sowieso an nichts anderes und stieg ohnehin jedem Rock nach. Vor allem den blutjungen Frauen. Er war unglücklich in der Ehe mit seiner dicklichen, nicht gerade attraktiven Jane, die es auch in der Horizontalen nicht mehr brachte.
»Ihr könnt mich mal«, rief York dazwischen, der sich wegen des plötzlichen Themenwechsels von seiner Anden-Kannibalismus-Story zu Britt auf den Arm genommen fühlte. Er wollte sich gerade vom Barhocker schwingen, aber Jacks riesige Pranke hielt ihn zurück.
»Du hast ja recht, Peter«, sagte er in einem versöhnlichen Tonfall. »Das ist echt eine verflucht beschissene Überlebensgeschichte. Soweit darf es hier niemals kommen.«
»G-G-G-Genau«, pflichtete ihm Ray bei.
York kratzte sich an seinem runden, pausbäckigen Gesicht und schenkte sich noch mehr ein. Er hob das Glas, sah seine Kumpels an und wollte einen Trinkspruch aufsagen, unterließ es dann aber. Alle vier tranken auf einmal aus.
Gedankenverloren starrte Waters auf den kurzflorigen Barockteppichboden. Auch ihm ging jetzt immer wieder die grausame Vorstellung über die Menschenfresserei durch den Kopf. Plötzlich verengten sich seine Pupillen. Das dezente Blätterrankenmuster schien ein seltsames Eigenleben zu entwickeln. Zwischen den einzelnen Ranken bildeten sich neue Dekore und fremde Ornamente …
Waters kniff die Augen zusammen und schaute genauer hin.
Nein, es waren Gesichter.
Menschliche Gesichter und doch … irgendwie unproportioniert und deformiert. Sie besaßen weit hervorquellende Augen, kraterartige Nasenlöcher und schwammähnliche Lippen. Grotesk, sonderbar und absolut widerwärtig.
Als sich einer der entstellten Münder öffnete und ein entsetzliches Stöhnen daraus herausdrang, schrie Waters unvermittelt auf. Alle Haare standen ihm zu Berge. Selbst über seinen Vollbart lief ein seltsames Kribbeln. Schnell löste er den ungläubigen Blick vom Teppichboden, um die monströsen Fratzen nicht länger betrachten zu müssen.
Er war erstaunt, dass seine Kumpels nicht auf sein Erschrecken reagierten. Doch sie saßen einfach nur wie versteinert da.
Shaffer und Romero starrten stumm auf den großen, runden Spiegel zwischen den Flaschenregalen. Denn die mit Aluminium beschichtete Glasplatte warf nicht etwa ihr unverzerrtes Abbild zurück, sondern etwas ganz anderes: Dutzende weit aufgerissene Augenpaare. Schimmernd, glänzend und rot glühend wie in Blut getauchte Silbermünzen. Furchtbarer als alles, was sich die Jäger bislang hatten vorstellen können.
Sage niemals vor dem Spiegel etwas Böses, denn er spiegelt das Gesagte …
Der starre Blick aus den Höllenaugen ließ etwas Unheimliches und Giftiges in ihren Mägen entstehen, sich windend und krümmend wie Giftschlangen. Diese Augen versprachen ihnen nur eines: den endgültigen Tod. Grausam und qualvoll. Einen Tod, der sie für immer in die ewige Nacht hineinzerrte.
Für immer und ewig …
Shaffer und Romero lief es eiskalt den Rücken hinunter. Sie waren unfähig, sich zu rühren.
Auch York bewegte sich nicht. Allerdings schaute er weder in den Spiegel noch auf den Teppichboden, sondern hinter den Tresen. Dort kratzte etwas ununterbrochen, als würden Krallen über Metall scharren. Tatsächlich wimmelte es in dem Zwischenraum von riesigen, rundlichen Wanderratten.
Die Nagetiere waren fast so groß wie ausgewachsene Katzen, mit dicken, haarlosen und mit Schuppenringen besetzten Schwänzen. Ihr Fell war schmutzig graubraun bis braunschwarz. Ihre onyxschwarzen Augen traten wie Murmeln hervor. Sie besaßen das typische Gebiss mit den beiden mächtigen Schneidezähne-Paaren. Deutlich sichtbar war darauf der harte Schmelz, der aufgrund des häufigen Nagens orangegelb verfärbt war.
Aber am schlimmsten war für York der Anblick ihrer strohigen Schnurrhaare in den stumpfen Schnauzen, denn in diesen hatten sich Fetzen rohen, blutigen Fleischs verfangen …
Auf einmal kamen aus allen Richtungen gleichzeitig die trippelnden Geräusche der wuselnden Ratten. Wie eine dunkle Flut ergossen sie sich aus großen Löchern in den Wänden in die Cocktailbar hinein und umkreisten die Lederhocker, auf denen die vier Jäger saßen.
Vor Schock und Ekel schrie Peter York laut auf und zog hastig die Beine an. Gleichzeitig wunderte er sich, dass seine Freunde gar nicht reagierten. Sahen sie die Nagetiere denn nicht?
Dann war es schlagartig vorbei.
Die Ratten verblassten genauso wie die Augen im Barspiegel und die Fratzen im Muster des Teppichbodens.
Im selben Moment erwachten die Jäger wie aus einer tiefen Trance. Sie schüttelten die Köpfe und schauten sich verwirrt an. Es dauerte jedoch gefühlte Minuten, bis sie in der Lage waren, sich gegenseitig von ihren entsetzlichen Wahrnehmungen zu erzählen.
Schließlich sagte Jack Shaffer: »Wir haben einfach zu viel gesoffen und deshalb halluziniert. Das ist alles.«
Doch insgeheim glaubten sie das nicht.
Keiner von ihnen.
***
Der Hunger nagte in ihren Eingeweiden wie die Ratten, die Peter York in der Cocktailbar gesehen hatte. Aber davon ahnte Veronica Cassavates natürlich nichts. Sie lag im Zimmer neben ihrem Freund Tobey Arness und zerwühlte die Decke, weil sie sich unruhig von einer Seite des breiten Doppelbettes auf die andere wälzte. Schon seit Stunden quälte sie sich und bemühte sich krampfhaft, Schlaf zu finden. Doch je mehr sie es versuchte, desto weniger schien es ihr zu gelingen. Letzten Endes war sie auch weit nach Mitternacht immer noch genauso hellwach, wie zu dem Zeitpunkt, als sie ins Bett geschlüpft war.
Tobey hingegen schlief wie ein Toter. In der ganzen Zeit hatte er sich nicht einmal bewegt. Er hatte sich bäuchlings, mit angewinkelten knochigen Knien auf der Matratze ausgestreckt, den Kopf seitlich nach links gedreht, den Mund leicht geöffnet. Leise Schnarchgeräusche, die sich wie stetes, weit entferntes Sägen anhörten, kamen währenddessen über seine Lippen,
Doch das war es nicht, was Veronica wachhielt. Das war sie bereits gewohnt, schließlich lebte sie schon seit ein paar Jahren mit ihrem Freund zusammen. Vielleicht war es die Auseinandersetzung mit den Jägern am Nachmittag, die sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Hinzu kam noch die immer größer werdende Sorge um die stetig schwindenden Nahrungsmittelvorräte und das unaufhörliche Schneetreiben draußen vor dem Hotel, das sie über viele Tage oder gar Wochen von der Außenwelt abschneiden könnte. Vom Tal … vom Parkplatz … von ihren Autos … von Frisco.
Hunger …
Die beiden Kaninchen und die drei Hände voll Kartoffeln waren bei Weitem zu wenig gewesen, um elf erwachsene Personen sattzubekommen. Besonders, weil es nach dem Lunch nichts mehr gegeben hatte.
Hunger …
Veronicas Magen knurrte noch lauter. Das Verlangen nach Nahrung wurde langsam immer übermächtiger in ihr.
Leise stand sie auf, achtete darauf, dass die Boxspringfederung nicht quietschte, um Tobey nicht zu aufzuwecken, und schlüpfte in ihre Jeans und den dicken Kaschmirpullover. Danach zog sie sich die modischen, flachen Sneakers an, steckte die Schlüsselkarte ein, schlich zur Tür, schlüpfte hindurch und zog sie ganz sachte hinter sich zu.
Die Deckenleuchten auf dem Korridor waren bis auf ein Minimum gedämpft. Von draußen fiel bleiches Mondlicht durch die kathedralenartigen Fenster und zeichnete Muster und Schatten auf den Teppichboden. Bis in den ersten Stock hatten es die Schneewehen noch nicht geschafft, obwohl sie bereits mit ihren eisigen Fingern an der Unterseite der Fensterbänke kratzten.
Ein unheimliches Schweigen hatte sich wie eine Decke, die jegliche Geräusche erstickte, über das Snow Hill Hotel ausgebreitet. Nur das schwache Heulen des Windes, der nach wie vor aus Nordosten blies, drang zu ihr.
Veronica huschte über den Flur, vorbei an den Zimmern ihrer Freunde und der Jäger. Sie nahm allerdings nicht die Haupttreppe ins Untergeschoss, sondern den Fahrstuhl. Aus irgendeinem Grund scheute sie, die nächtliche Hotellobby und den Hauptkorridor im Erdgeschoss bis zum Lift, der sie in den Versorgungstrakt bringen würde, zu Fuß zu durchqueren. Was, wenn einer der Jäger noch auf war und ihr begegnete? Genau das wollte sie sich lieber nicht ausmalen, und ihr Freund wohl auch nicht, der allerdings sowieso gerade vollkommen ahnungslos oben im Zimmer fest wie ein neugeborenes Baby schlief …
Als die attraktive, wasserstoffblonde Frau, den mit verschnörkelten Ornamenten aus Kupfer und Messing verzierten Fahrstuhl betrat, sackte er ein wenig durch. Schnell schloss sie die Tür und drückte auf den Knopf ins Untergeschoss. Rumpelnd und knarrend fuhr der offenbar auf antik getrimmte Lift an, der aber tatsächlich alt war und sicher schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Das Rasseln des Messinggitters, das Zittern unter ihren Füßen und das gequälte Jaulen des Getriebes beruhigte sie auch nicht gerade.
Mit fieberhafter Aufmerksamkeit stand Veronica im Inneren der Kabine, die sechs Personen Platz bot. Tief unter ihr drangen aus dem Schacht unheimliche Geräusche herauf, so als lauerten dort irgendwelche Ungeheuer. Auf einmal überfiel sie die Panik, dass der Fahrstuhl aufgrund eines Kurzschlusses zwischen den Stockwerken stecken bleiben könnte. Sie atmete unwillkürlich schneller und presste die blutleeren Lippen zu dünnen Strichen zusammen.
Als der Lift endlich im Untergeschoss ankam, gab es ein kreischendes Geräusch. Jetzt bereute Veronica es, nicht einfach die Treppe genommen zu haben. Von dem ganzen Lärm war bestimmt das Hausmeister-Ehepaar geweckt worden, dass hier unten sein Quartier hatte.
Schnell zog sie das Messinggitter zurück und die Fahrstuhltür auf und stieg aus der Kabine. Für einige Sekunden verharrte sie regungslos und lauschte, ob Caleb oder Hillary Philbin nicht vielleicht bereits auf dem Weg zu ihr waren. Aber nicht der geringste Laut durchbrach die beklemmende Stille.
Erst jetzt wurde Veronica bewusst, dass sie den falschen Aufzug genommen hatte, denn dieser hatte sie zwar ins Untergeschoss gebracht, aber weit weg vom eigentlichen Versorgungstrakt, der den Schildern nach auf der gegenüberliegenden Seite der Etage lag. Deshalb musste sie zu Fuß den langen, leeren und nur gedämpft erleuchteten Korridor entlanggehen, mitten hinein in das muffig riechende Zwielicht. Grotesk verzerrt tanzte ihr Schatten an den toten Mauern um sie herum, von denen eine düstere Macht auszugehen schien. Die Luft war durchsetzt von einem Geruch aus Feuchtigkeit und Schimmel.
Außer den schwachen quietschenden Schrittgeräuschen, die die Gummisohlen ihrer Sneakers auf dem Linoleumboden verursachten, war alles ruhig. In diesem Trakt, der ausschließlich dem Personal vorbehalten war, hatten die Architekten auf teuren Teppichboden verzichtet.
Die junge Frau beschlich plötzlich ein unbestimmtes aber beklemmendes Gefühl. Sie kam sich auf einmal so isoliert vor, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Die unheimliche Grabesstille und der Gifthauch des Gebäudes schienen sie buchstäblich zu verhöhnen. Es kam ihr wie ein Gang durch ein nicht enden wollendes Mausoleum vor.
Weil sie plötzlich fror, zog Veronica fröstelnd die Schultern hoch. Fast wünschte sie sich jetzt doch, die Philbins würden auftauchen, nur um der beklemmenden, eisigen Einsamkeit entfliehen zu können.
An jeder halb offenen Tür, an der sie vorüberhuschte, schienen missgestaltete Ungeheuer ihre Klauen nach ihr auszustrecken, um sie in die dahinterliegende Finsternis zu zerren.
Nicht nur du, sondern auch das Snow Hill Hotel ist hungrig, Veronica …
Die junge Frau beschleunigte ihre Schritte.
Hunger nach Blut und Leben, Veronica …
Das atemlose Grauen, das die Stimme in ihrem Gehirn auslöste, jagte ihr eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken.
Nach DEINEM Blut und DEINEM Leben, Veronica …
Durch ihre Eingeweide schien jetzt ein glühender Ast gezogen zu werden. Das heiße Grauen kroch ihr bis in die Brust und die Kehle. Nur mit äußerster Mühe gelang es ihr, einen Entsetzensschrei zu unterdrücken.
Es dauerte eine Weile, bis Veronica den breiten Flur von Süden nach Norden genommen hatte, dann endlich erreichte sie die von Gummikeilen offengehaltene Doppeltür der Hauptküche. Irgendwo hier mussten die Kühl- und Vorratsräume sein.
Veronica betätigte den Lichtschalter. Im Schein der Neonlampen lag die blitzblank geputzte Küche kalt und verlassen vor ihr. Die blassgrauen Fliesen und der Chromnickelstahl bildeten förmlich eine Einheit.
Ihr Blick schweifte von der Spüle mit den drei Becken bis zu den Wandschränken und den Arbeitstischen, doch nirgendwo entdeckte sie Türen, die zu den gesuchten Provianträumen führten. Enttäuscht drehte sie sich um, machte das Licht aus und ging wieder hinaus.
Auf einmal fiel ihr ein, dass die Vorratslager zwar an der Stirnseite der Küche lagen, aber nicht direkt von dort aus erreichbar waren. Dazu musste sie erst vom Korridor aus nach links abbiegen und an der rechten Außenwand der Küche entlanggehen. Schließlich stand sie vor dem Hauptkühlraum und öffnete den schweren Riegel. Abgestandener und fauliger Geruch schlug ihr von den Lebensmitteln entgegen, die hier vor Monaten aufgetaut und verdorben waren. Der Raum war komplett leer geräumt. Lediglich in den Ecken lagen unberührte Rattenköder. Von dort aus erreichte sie jedoch die begehbare, abgeteilte kleinere Vorratskammer, von der eine Hälfte gekühlt und in der anderen das Trockensortiment untergebracht war.
Als Veronica die wenigen Lebensmittel inspizierte, die hier noch gelagert waren, überfiel sie unweigerlich ein eisiger Schrecken. Es war etwas ganz anderes, wenn man nur davon sprach, als wenn man das Dilemma mit eigenen Augen sah. Trotz allem wühlte der Heißhunger weiter wie ein herrenloser, amokfahrender Mähdrescher in ihrem Magen.
Mit zitternden Händen riss sie deshalb eine Schachtel Cornflakes auf und schaufelte sich so viele von den Mais-Frühstücksflocken in den Mund, wie sie nur konnte. Gierig kaute und schluckte sie und machte fast die ganze Packung leer. Ein schlechtes Gewissen gegenüber Tobey oder den anderen hatte sie zwar schon, aber sie pfiff darauf. Dann wollte sie nach einer der wenigen Dosen mit geräucherten und luftgetrockneten Dauerwürsten greifen, doch in diesem Moment verkrallte sich irgendetwas in Veronica Cassavates Gehirnwindungen. So kam es ihr jedenfalls vor. Ihr Hals schnürte sich zu und sie konnte kaum noch atmen. Etwas trieb ihr das Grauen in den Leib, bis tief hinein ins Mark und auf dem Grund ihrer Seele.
Etwas unsagbar Böses, Kaltes, Glitschiges und Erschreckendes …
… und dann war da die schwarze Katze. Mit giftig gelben Augen starrte sie die Frau an. An ihrem Schwanz war eine Schnur befestigt, deren Ende um den Abzug eines Gewehrs gebunden war. Einer Henry Rifle, Kaliber .44 mit Edelholzkolben. Das mächtige Loch der pechschwarzen Mündung schimmerte wie der personifizierte Eintritt in die Hölle.
DAS SCHIESSEISEN IST FEUERBEREIT, BABY!
Wie ein flammendes Fanal brannte sich diese Erkenntnis unwillkürlich in Veronicas Denken.
DAS SCHIESSEISEN …
Die Katze starrte sie immer noch mit diesen schrecklichen gelben Augen an, die nichts Natürliches an sich hatten.
IST …
Bewege dich bloß nicht, du hässliches Vieh!, schoss es Veronica durch den Kopf. Bitte, bitte, bitte nicht …
FEUERBEREIT …
Der Stubentiger schnurrte, aber es war nichts Possierliches daran, es klang eher wie die eingeschaltete Motorsäge des grausamen Leatherface-Killers aus dem Horror-Schocker Texas Chainsaw Massacre.
Abgrundtief böse. Entschlossen und tödlich.
BABY!
Jäh wurde die Tür der Vorratskammer aus den Scharnieren geschleudert, als würde sie aus Plastik bestehen. Veronica erschrak zu Tode. Aber nicht nur sie, sondern auch die schwarze Katze.
Mit hochaufgestelltem Schwanz rannte der Stubentiger in die gegenüberliegende Richtung. Weg vom Türrahmen. Die Schnur spannte sich. Wie in Zeitlupe konnte die Frau sehen, wie der Abzug der Henry Rifle durchgedrückt wurde, bis der Hahn auf den hinteren Teil des Verschlusses krachte. Der Schlag übertrug sich auf die vorne liegenden Zündnocken, die links und rechts auf den Rand der Patrone hämmerten und diese zündeten.
PPPEEEEENNNNNGGGGG …
Die Schussdetonation war ohrenbetäubend.
Wie Donner eines Tropengewitters rollte sie durch den Raum und hallte von den Wänden wider. Die Kugel Kaliber .44 bohrte sich in Veronicas Oberkörper, direkt unter der linken, tätowierten Brustwarze. Blut spritzte, Muskelfleisch, Sehnen und Knochen wurden wie unter dem Hammer eines Berserkers zerstört. Aus dem Stand wurde die Frau einen halben Meter hochgehoben und gegen eine leere, an der Wand aufgestellte Holzpalette geschleudert. Ihr blieb die Luft weg. Schlimmer noch aber war der übermächtige Schmerz der Schusswunde, als wäre in ihre linke Brustseite ein Stahlkeil zwischen die Rippen gerammt worden.
Dann kam etwas auf schwarzen Schwingen herangeflogen, das die Frau unweigerlich hinab in die ewige Verdammnis und den Pfuhl des Todes riss …
Und Veronica Cassavates schrie, schrie und schrie.
***
Als sie die markerschütternden Schreie vernahmen, war die frostige Nacht bereits weit fortschritten. Zuerst glaubten die Männer, die Hilferufe würden direkt aus der Wand hinter der Bar kommen, doch das war bestimmt nur eine akustische Täuschung. Vielleicht tönten die Laute auch über ein unsichtbares Belüftungssystem zu ihnen herüber. Aber davon hatten sie natürlich keine Ahnung, weil sie weder Bauingenieure noch Architekten, sondern nur einfache Holzfäller und Jäger waren.
Nach ihren seltsamen Visionen, von denen jeder von ihnen auf seine Art und Weise heimgesucht worden war, hatten sie einfach weitergetrunken.
Doch nun waren die vier alkoholisierten Männer auf einmal wieder hellwach.
»Verflucht, woher kommt das?« Peter Yorks Frage blieb zitternd im Raum stehen.
»D-D-Das hört sich an w-w-w-wie aus dem U-U-Untergeschoss …«, stotterte Romero.
Der athletisch gebaute Shaffer drückte seine halb gerauchte Zigarette in den mit Kippen überfüllten Aschenbecher. »Dann lasst uns mal nachsehen gehen!«
Obwohl sie viel getrunken hatten, fehlte ihnen die tapsige Unbeholfenheit von Säufern, als sie sich von den Barhockern schwangen. Die Männer waren allerdings einiges gewohnt, deshalb stolperten oder wankten sie auch nicht, sondern gingen mit halbwegs sicheren Schritten aus der Cocktailbar, hinaus. Gegenüber vom Speisesaal war der Lift, der sie ins Untergeschoss brachte. Als sie aus der Kabine stiegen, befanden sie sich vor der riesigen Küche, deren Doppeltür nach wie vor mit Gummikeilen offengehalten wurde. Dunkel und verlassen lag sie vor ihnen. Die gellenden Schreie waren jetzt verebbt. Dafür aber hörten sie aus den dahinterliegenden Kühlräumen ein heftiges Schluchzen.
Die Jäger nahmen den Weg an der Küche vorbei zum leeren Hauptkühlraum, dessen Tür ebenfalls offen stand und von dort aus in die abgeteilte Vorratskammer. Dort fanden sie Veronica Cassavates im ungekühlten Bereich, in dem der Rest des Trockensortiments lagerte. Die sonst so lebenslustige Frau saß auf einer Holzpalette, die auf dem kahlen Boden lag. Ihr kurzes, wasserstoffblond gefärbtes Haar war zerzaust und stand wie ein Wischmob von ihrem Kopf ab. Das hübsche Gesicht war ohne jegliche Farbe. Ihr Nasenpiercing funkelte im Neonlicht wie einer der dreißig Silberlinge, die Judas für seinen Verrat an Jesus von den Römern erhalten hatte.
Neben ihr lag eine leere, aufgerissene Schachtel Cornflakes auf dem Boden. Einige wenige Maisflocken waren um ihre Sneakers herum verstreut. Stumpfsinnig und mit seltsam entrückter Miene starrte sie auf ihre Füße.
Das Schluchzen war jetzt verstummt, doch dafür wiederholte sie immer wieder dieselben Worte:
»Katze … nicht schießen … Katze nicht schießen …«
Für die Jäger war klar, was sich hier zugetragen hatte. Veronica hatte sich über einen Teil der letzten Proviantvorräte hergemacht und war dabei von irgendetwas überrascht oder erschreckt worden. Jedoch bestimmt nicht von einem schießenden Stubentiger!
Dementsprechend groß war die Wut der vier angetrunkenen Männer, die nun um sie herumstanden. Lauthals beschimpften sie die Literaturstudentin.
»I-I-Ich zeig dir g-g-gleich wo’s l-l-lang geht …« Romero strich sich aufgebracht durch den brandroten Dreitagebart. Mit der Zungenspitze fuhr er sich in die Lücke, dorthin, wo der obere Schneidezahn fehlte.
»Gegen eine kleine Nummer hätte ich auch nichts einzuwenden«, stimmte ihm York zu. Mit seinen geschwollenen Tränensäcken unter den Augen, der kurzen Nase mit den großen Löchern sowie der hervorstehenden Unterlippe sah er aus wie ein Schwein, das auf Trüffeljagd war.
»Wenn du was zum Lutschen willst, Kleine, dann hole ich gleich meine Rauchwurst raus! Die ist viel griffiger und schmeckt garantiert.« Grinsend nestelte er an seinem Hosenschlitz herum.
Vor Begeisterung spuckte Waters auf den Boden.
»Immer ran, Ray, zeig‘s der tätowierten Pussy! Danach werde ich auch einen versenken.«
Bei dem Gedanken, ebenfalls zum Schuss zu kommen, knetete Shaffer in heller Vorfreude sein strammes Glied unter der Hose.
Gerade als York nach der weiterhin teilnahmslos dahockenden Frau greifen wollte, erklang hinter ihm eine nuschelnde Stimme. »Lass bloß die Pfoten von meiner Freundin!«
Ruckartig wandten sich die Jäger um. Ohne, dass sie es bemerkt hatten, waren Tobey, Ned, Laura und Britt in den Vorratsraum gekommen. Auch sie mussten die Schreie aus dem Untergeschoss gehört haben.
»Du dürre Bohnenstange willst mir drohen?«, fragte York aufgebracht. Sein ohnehin vom Alkohol gerötetes Gesicht färbte sich daraufhin noch dunkler.
»Das war keine Drohung …«
»Halt dein verfluchtes Maul!«
Ned Harlan, der neben Tobey stand, schluckte nervös. Angesichts der wild aussehenden, körperlich in allen Belangen überlegenen und offensichtlich durch Alkoholgenuss streitsüchtigen Jäger, wagte er keinen Mucks. Auch Laura und Britt blieben still, um die angeheizte Stimmung nicht zum Explodieren zu bringen.
Tobey wollte sich so schnell wie möglich um Veronica kümmern, die ununterbrochen flüsterte: Katze … nicht schießen … Katze nicht schießen …, als handele es sich dabei um einen irren Kinderreim. Wie eine Spinne stakste er auf seinen langen, streichholzdünnen Beinen auf die Männer zu, um an ihnen vorbeizukommen.
Der Vorderste von ihnen war Peter York, der mit seinen ein Meter siebzig gut dreißig Zentimeter kleiner war als der riesige Arness. Er musste den Kopf in den Nacken legen, um zu ihm aufblicken zu können. Aber das tat er ohne Furcht und mit finster dreinblickenden Augen.
Allerdings war es Shaffer, der fast gleich groß wie der Student war, der diesem nun in den Weg trat. Es sah so aus, als würde ein stämmiger Bär vor einem zu groß geratenen, ausgemergelten Wiesel stehen.
»Hör mir gut zu, Bohnenstange«, zischte er gefährlich leise. »Ich kenne meinen Freund. Wenn Peter dich erst mal in seinen Fingern hat, dann wird er dich genauso schlimm zurichten wie die Tiere, die er meistens nur anschießt, ohne sie sofort abzumurksen. Weißt du, warum er das macht?«
Irritiert schüttelte Tobey den Kopf, schwieg aber.
»Damit er sie quälen kann … und zwar lebend! Alles klar, Bohnenstange?«
Doch auch diese Warnung ignorierte der Student, der halb krank vor Sorge um seine Freundin war, und wollte den muskulösen Mann vor sich einfach zur Seite schieben. Allerdings hätte er auch versuchen können, einen Felsblock von seinem Platz zu räumen.
Ohne Vorwarnung verpasste Shaffer dem Hageren eine mächtige linke Gerade und setzte dann sofort mit einem rechten Haken nach, der Tobey regelrecht von den Füßen hob und zu Boden schleuderte.
Halb benommen und aus Nase und Mund blutend, blieb er liegen.
»Ich habe die Bohnenstange abgeräumt und du den Fatty«, brüstete sich Shaffer und blickte York an.
»U-U-Und was bleibt f-f-für mich ü-ü-übrig?« Romero riss seine Fäuste hoch und ging spielerisch auf Waters los, der wie ein kleines Kind mit ihm herumtollte.
Britt nutzte die Gelegenheit, um an Tobey vorbei zu Veronica zu gelangen. Sie kniete sich neben sie hin und fuhr ihr sanft mit der Hand durch das zerzauste Haar.
»Was ist denn los mit dir, Süße?«
Es schien so, als würde ihre Freundin aus einer Trance erwachen, die stark an Debilität grenzte. Ihr verschwommener, in sich gekehrter Blick richtete sich unendlich langsam auf Britt. Ansatzlos füllten sich ihre dunklen Augen mit Tränen, welche warm und salzig ihre blassen Wangen hinabrannen. Ein Weinkrampf schüttelte ihren Körper. Britt drückte sie fest an sich.
Ned Harlan ging jetzt mit unsicheren Schritten zu dem sich vor Schmerz krümmenden Tobey, dessen Gesicht mit Blut verschmiert war. Laura bewegte sich immer noch keinen Zentimeter.
»Was war denn hier überhaupt los?« Die Stimme des Bankangestellten zitterte leicht, wie Rauch über einer Grillstelle.
»Wir sind dir zwar keine Rechenschaft schuldig, Fatty, aber eure Freundin ist wie eine siebenköpfige Raupe über die letzten Reste des Proviants hergefallen«, knurrte Shaffer unwirsch. »Das ist geschehen, wenn du es genau wissen willst.«
Wie vor Kurzem im Speisesaal, wollte Ned in diesem Moment das Zepter in die Hand nehmen. Vergessen war seine Hosenpisserei. In diesem Augenblick wuchs er geradezu über sich hinaus, obwohl die Angst weiterhin wie ein Bleigewicht in seinem Magen lag. Heute Nacht würde er es Laura mal wieder so richtig hart besorgen. So hart, wie ein Mann, ein wahrer Held, es nur tun konnte.
»Warum hat Veronica dann wie ein Tier geschrien? Habt ihr …«
»Ich hau dir gleich noch mal aufs Maul!«, brüllte York plötzlich los, der sich erneut auf den Bürohengst stürzen wollte. Shaffer konnte ihn gerade noch davon abhalten.
Erschrocken machte Ned einen Schritt zurück und wäre beinahe über Tobeys lange Beine gestolpert.
»Lass es sein, Peter. Du machst dir nur die Hände schmutzig.« Shaffer ließ seinen Kumpanen wieder los, der sich immer noch kaum beruhigen konnte. Er drehte sich um und starrte Britt genauso unverblümt an, wie Waters, der seit Minuten nichts anderes tat. Wie ein lüsterner Rüde beobachtete er jede Bewegung der sexy Blonden. Speichel hatte sich in seinen Mundwinkeln gesammelt.
In diesem Moment kam Caleb Philbin in die Vorratskammer. Mit einem schnellen Blick in die Runde versuchte er, die Situation einzuschätzen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sein drahtiger Körper steckte in einem grauen Puma-Jogginganzug. Die stechend blauen Augen wanderten von einem zum anderen und schienen dabei jeden einzelnen wie einen Falter an einem Brett festzunageln.
Shaffer übernahm schließlich das Wort und klärte den Hausmeister auf. Dabei betonte er, dass sie Veronica nichts zuleide getan hatten, sondern sie nur, alarmiert von ihrem Schreien und Schluchzen, in einem fast apathischen Zustand hier vorgefunden hatten.
Inzwischen waren Veronica und auch Tobey wieder auf den Beinen. Der Lange wischte sich mit dem Hemdsärmel das Blut aus dem Gesicht und hakte sich bei seiner Freundin ein. Mit unsicheren Schritten gingen sie gemeinsam aus dem Vorratsraum hinaus. Britt, Ned und Laura folgten ihnen.
»Sie sollten diese verdammte Vorratskammer abschließen, Housekeeper«, meinte Shaffer.
»Was ich zu tun und zu lassen habe, brauchen Sie mir nicht unter die Nase zu reiben«, erwiderte Caleb mit harter Stimme. »Ist das klar?«
»Sonnenklar, Housekeeper.« Der bullige Mann grinste breit, als würde er sein Gegenüber nicht für voll nehmen. Vielleicht war es ja auch tatsächlich so.