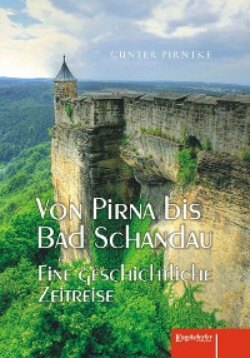Читать книгу Von Pirna bis Bad Schandau - Gunter Pirntke - Страница 8
Geschichte der Gesteine und Felsen
ОглавлениеHäufig trifft man im Elbsandsteingebirge Felsstrukturen an, die auf Brauneisenanreicherungen zurückzuführen sind. Eisenoxide wurden vom durchsickernden Wasser gelöst und lagerten sich in bestimmten Sandsteinschichten ab. Dort verfestigen sie den Sandstein und schützten ihn vor schneller Erosion. Über einen längeren Zeitraum entwickelten sich die charakteristischen Brauneisenbänder, -röhren und -schwarten.
Wenn sich zwei nahe beieinander liegende Felsöffnungen durch Erosion vergrößern, entstehen sogenannte Sanduhren. Dort wo der Sandstein am weichsten ist, kommt es zunächst zur Verbindung der hinteren Teile der Löcher. Die Felskruste im vorderen Teil ist widerstandsfähiger. Dies führt dazu, dass sich eine Säule herausbildet.
Abb. 4: Wabenverwitterung
Eine der typischen Verwitterungsform im Sandstein sind die Waben. Ihre Entstehung geschieht vorwiegend durch chemische Kräfte und nicht, wie man früher annahm, durch Winderosion. Salze werden an der Gesteinsoberfläche ausgeschieden. Dabei bilden sich Kristalle, die den Sandstein sprengen und damit die Verwitterung beschleunigen. Gleichzeitig kommt es unter dem Einfluss von Kieselsäure zu einer Verfestigung des Felsens. Diese beiden entgegengesetzten, in enger Nachbarschaft ablaufenden Vorgänge führen zu der charakteristischen Wabenstruktur.
An einigen Stellen der Felswände lassen sich auch sogenannte schiefe Schichtungen beobachten. Deren Ursprung liegt darin, dass sich Sand aus fließendem Wasser in Schwemmkegeln absetzte. Hier kann man als Schlussfolgerung ableiten, dass die Ablagerung der Sande in einem Flachmeer stattfand und dass der Sedimenteintrag durch zufließende Gewässer erfolgte.
Wie kommt es nun zu den Felsstürzen? Die Sandsteinmassive unterliegen einer ständigen Veränderung. Unter den Felswänden häufen sich kleinere herabgestürzte Steine und Blöcke bis zur Größe eines Einfamilienhauses. Um einen solchen Felssturz auszulösen genügt manchmal nur ein Dauerregen. Felsstürze gab es im Laufe der geologischen Geschichte immer wieder, die meisten sind auch heute unabwendbar. Es ist zu befürchten, dass die Gefahr durch den zunehmenden Klimawechsel in den kommenden Jahren immer häufiger auftreten wird. Wir wollen die Hauptmechanismen des Felsabtrags im Elbsandsteingebirge näher beschreiben.
Durch Prozesse der Verwitterung werden von der Felsoberfläche ständig einzelne Sandminerale bis hin zu kleineren, einige Kilogramm schweren Steinen abgelöst. Sie werden von Frost, Baumwurzeln oder durch Salze aufgelockert.
Detaillierte Messungen haben gezeigt, dass die Hänge der Sandsteinebenheiten sich in ständiger Abwärtsbewegung befinden, auch wenn es sich oft nur um Millimeter oder sogar Zehntel von Millimetern im Jahr handelt. Diese langsame Bewegung kann durch Regenwasser beschleunigt werden. Das Wasser weicht nicht nur das Grundgestein auf, sondern macht den Sandstein, der eine durchschnittliche Porosität von 20% aufweist, auch schwerer. Eine besonders gefährliche Jahreszeit ist der zeitige Frühling, wo die Blöcke noch dazu vom Frost gelockert werden.
Am 22. November 2000 kam es am Wartturm zu einem der spektakulärsten Felsstürze der vergangenen Jahrzehnte in der Sächsischen Schweiz. Dabei brach etwa ein Drittel des Felsens ab, etwa 450 m³ Sandstein mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 800 Tonnen stürzten über 60 bis 75 m zu Tal. Das war die größte Felsmenge seit einem Felssturz im Jahr 1961 am Bienenkorb, der zudem keine so große Fallhöhe hatte.
Abb. 5: Wartturm im April 2001
Die Felsstürze sind oft dadurch bedingt, dass das Sandsteinmassiv unterhöhlt ist.
Die Sandsteinoberfläche verhält sich anders, als das tiefer gelagerte Gestein. Sie wird von der Sonne erwärmt und vom Wasser durchfeuchtet. Dadurch kommt es zu Volumenänderungen und Temperaturspannungen. Es sind zwar nur geringfügige Veränderungen, aber sie erfolgen regelmäßig zu jeder Jahreszeit und manchmal auch jeden Tag und jede Nacht. So kommt es zum ständigen Lostrennen und Abfallen der Oberfläche. Manchmal löst sich der Fels schalenartig. Diese Erscheinung ist z. B. an Felsüberhängen gut erkennbar.
Dennoch: „Ich habe auf meinen früheren Reisen durch das südliche Deutschland, die Schweiz, Salzburg, Österreich und Schlesien sehr viel Schönes dieser Art gesehen, doch solche herrlichen Felsengruppen sind mir dort nirgends aufgestoßen“, sagte Carl Merkel, Höhlen- und Naturforscher 1826.