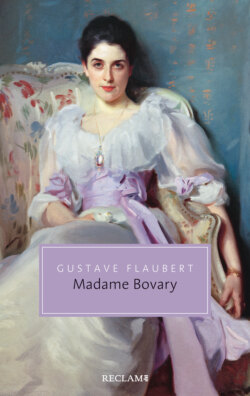Читать книгу Madame Bovary. Sittenbild aus der Provinz - Gustave Flaubert, Gustave Flaubert - Страница 13
Zweiter Teil I
ОглавлениеYonville-l’Abbaye (so genannt nach einer ehemaligen Kapuzinerabtei, von der nicht einmal mehr die Ruinen vorhanden sind) ist ein Marktflecken, der etwa acht Meilen von Rouen entfernt liegt zwischen der Landstraße nach Abbeville und der nach Beauvais im Tal der Rieule, eines Flüsschens, das in die Andelle fließt, nachdem es kurz vor seiner Mündung drei Mühlen getrieben hat; es sind ein paar Forellen darin, die die Dorfbuben sonntags angeln.
Man verlässt die große Landstraße bei La Boissière und geht auf flachem Gelände weiter bis zur Anhöhe von Les Leux, von wo aus man das Tal überblicken kann. Der Fluss, der es durchquert, macht daraus etwas wie zwei Regionen von unterschiedlichem Aussehen: alles, was links liegt, ist Weideland; alles, was rechts liegt, wird beackert. Das Wiesengebiet zieht sich unterhalb eines Wulstes niedriger Hügel hin und nähert sich von hinten den großen Weidewiesen der Landschaft Bray, während nach Osten hin die Ebene sanft ansteigt, immer breiter wird und bis ins Unendliche ihre blonden Kornfelder ausbreitet. Das am Saum der Grasflächen hinfließende Wasser trennt mit einem weißen Streifen die Farbe der Wiesen und die der Ackerfurchen, und so ähnelt das Land einem großen, ausgebreiteten Mantel mit grünem, silberbebortetem Samtkragen.
Am Horizont hat man bei der Ankunft den Eichenwald von Argueil vor sich sowie die steilen Hänge von Saint-Jean, die von oben bis unten mit ungleichmäßigen roten Strichen gestreift sind; das sind die Spuren des Regenwassers, und jene ziegelsteinfarbenen Tönungen, die die graue Farbe des Berges in ein dünnes Netzwerk zerteilen, rühren von den vielen eisenhaltigen Quellen her, die von dort aus rundum ins Land hinabrinnen.
Man befindet sich hier auf der Grenzscheide der Normandie, der Picardie und der Ile-de-France, einer Bastardregion, wo die Mundart ohne Besonderheit ist und die Landschaft ohne Charakter. Dort werden die schlechtesten Neufchâteler Käse des ganzen Arrondissements hergestellt, und andererseits ist die Bewirtschaftung kostspielig, weil viel Mist verwendet werden muss, um den lockeren, mit Sand und Steinen durchsetzten Boden zu düngen.
Bis zum Jahre 1835 führte keine brauchbare Landstraße nach Yonville; zu jener Zeit jedoch ist ein Haupt-Gemeindeweg angelegt worden, der die Landstraße nach Abbeville mit der nach Amiens verbindet und gelegentlich von den Fuhrleuten benutzt wird, die von Rouen nach Flandern fahren. Gleichwohl ist Yonville trotz dieser »neuen Absatzwege« nicht vorwärtsgekommen. Anstatt den Ackerboden zu verbessern, verbleibt man hartnäckig bei der Weidewirtschaft, so wenig sie auch abwerfen mag, und die träge Gemeinde hat sich von der Ebene abgekehrt und selbstverständlich weiter nach der Wasserseite zu vergrößert. So sieht man schon von weitem den Flecken am Ufer entlang hingestreckt liegen wie einen Kuhhirten, der am Bach seine Mittagsruhe hält.
Am Fuß der Höhen hinter der Brücke beginnt eine mit jungen Pappeln gesäumte Chaussee, die geradewegs zu den ersten Häusern des Orts führt. Sie sind von Hecken umschlossen; inmitten der Gehege liegen zahlreiche, regellos verstreute Nebenbauten, Apfelpressen, Wagenschuppen und Brennereien zwischen buschigen Bäumen, in deren Gezweig Leitern, Stangen oder Sensen hängen. Die Strohdächer sehen aus wie bis an die Augen gestülpte Pelzmützen; sie verdecken fast ein Drittel der niedrigen Fenster, deren dicke, gewölbte Scheiben in der Mitte mit einem Knoten geziert sind, in der Art von Flaschenböden. An die weißen, von schwarzem Gebälk durchzogenen Kalkwände klammern sich hier und dort magere Birnbäume an, und die Türen der Erdgeschosse haben kleine, drehbare Klappen, damit die Küken, die auf den Schwellen in Zider getauchte Brotkrumen picken, nicht ins Haus laufen. Allmählich werden die Gehege enger, die Wohnstätten rücken dichter aneinander, die Hecken verschwinden; ein Bündel Farnkraut baumelt an einem Besenstiel unter einem Fenster; dort ist eine Hufschmiede, und dann kommt ein Stellmacher mit zwei oder drei neuen, zweirädrigen Karrenwagen, die auf die Landstraße hinausragen. Schließlich erscheint, zwischen Gitterstäben sichtbar, ein weißes Haus hinter einem Rasenrund, das ein Amor mit auf den Mund gelegtem Finger schmückt; zwei gusseiserne Vasen stehen an den beiden Enden der Freitreppe; an der Tür glänzen amtliche Schilder; es ist das Haus des Notars und das schönste des Dorfs.
Die Kirche liegt an der andern Seite der Straße zwanzig Schritte weiter, dort, wo es auf den Marktplatz geht. Der kleine Friedhof, der sie umgibt, umschlossen von einer brusthohen Mauer, ist so voller Gräber, dass die alten, in gleicher Höhe mit dem Boden liegenden Steinplatten ein ununterbrochenes Quaderpflaster bilden, darein das Gras ganz von sich aus regelmäßige, grüne Rechtecke gezeichnet hat. Die Kirche ist während der letzten Regierungsjahre Karls X. renoviert worden. Doch das Holzgewölbe beginnt oben ein bisschen morsch zu werden und zeigt an manchen Stellen in seinem blauen Anstrich schwarze Rillen. Über der Haupttür, dort, wo eigentlich die Orgel sein müsste, befindet sich eine Empore für die Männer; es führt eine Wendeltreppe hinauf, die unter den Holzschuhen hallt.
Das Tageslicht fällt in schrägen Strahlen durch die farblosen Fenster auf die Bänke, die quer zur Wand stehen; auf einigen ist eine kleine Strohmatte festgenagelt, und darunter steht in großen Buchstaben zu lesen: »Bank von Monsieur Soundso.« Weiter hinten, wo das Schiff sich verengt, steht dem Beichtstuhl gegenüber eine Statuette der Madonna; sie trägt ein Atlasgewand und einen mit silbernen Sternen besäten Tüllschleier; ihre Wangen sind genauso knallrot angemalt wie die eines Götzenbilds auf den Sandwich-Inseln; und schließlich beherrscht eine Kopie der »Heiligen Familie, Stiftung des Ministers des Innern«, zwischen vier Leuchtern den Hauptaltar und schließt das Blickfeld ab. Die Chorstühle aus Fichtenholz sind ohne Anstrich geblieben.
Die Markthalle, das heißt ein Ziegeldach auf etwa zwanzig Holzpfeilern, nimmt ungefähr die Hälfte des Marktplatzes von Yonville ein. Das Bürgermeisteramt, gebaut »nach den Entwürfen eines Pariser Architekten«, ist eine Art griechischer Tempel und bildet mit dem Haus des Apothekers einen Winkel. Es hat im Erdgeschoss drei ionische Säulen und im ersten Stock eine Rundbogengalerie, während das abschließende Giebeldreieck von einem gallischen Hahn ausgefüllt wird, der die eine Klaue auf die Verfassung stützt und in der andern die Waage der Gerechtigkeit hält.
Aber was am meisten den Blick auf sich lenkt, das ist, gegenüber dem Gasthaus »Zum goldenen Löwen«, Monsieur Homais’ Apotheke! Hauptsächlich am Abend, wenn die große Lampe angezündet ist und die beiden bauchigen Glasgefäße, grün und rot, die das Schaufenster schmücken, ihre Farben weit über den Boden werfen, dann sieht man durch sie hindurch den Schatten des Apothekers, der sich auf sein Pult stützt. Sein Haus ist von oben bis unten mit Ankündigungen beklebt, die in Kursivschrift, Rundschrift und nachgemachter Druckschrift lauten: »Vichy-Brunnen, Selterswasser, Barèger Tafelwasser, Blutreinigungsmittel, Raspail-Tropfen, Arabisches Kraftmehl, Darcet-Pastillen, Regnault-Paste, Bandagen, Badesalz, Gesundheits-schokolade usw.«. Und auf dem Geschäftsschild, das so lang ist wie der ganze Laden, steht in Goldbuchstaben: »Homais, Apotheker.« Drinnen im Laden, hinter der großen, auf dem Ladentisch festgeschraubten Waage, liest man über einer Glastür das Wort »Laboratorium«, und in halber Höhe noch einmal auf schwarzem Grund in goldenen Lettern den Namen »Homais«.
Sonst gibt es in Yonville nichts zu sehen. Die Straße (die einzige) ist einen Büchsenschuss lang und von ein paar Läden gesäumt; sie endet unvermittelt an der Biegung der Landstraße. Wenn man sie rechts liegen lässt und unter der Höhe von Saint-Jean entlanggeht, kommt man bald zum Friedhof.
Zur Zeit der Cholera hatte man, um ihn zu vergrößern, ein Stück der Mauer niedergelegt und drei Morgen anstoßenden Ackerlands hinzugekauft; aber dieser ganze neue Teil ist fast unbenutzt geblieben; wie zuvor drängen sich die Gräber nach dem Eingangstor hin zusammen. Der Wärter, der zugleich Totengräber und Küster ist (und somit aus den Leichen der Gemeinde doppelte Einnahmen zieht), hat sich das brachliegende Land zunutze gemacht und baut darauf Kartoffeln an. Doch sein kleines Feld schrumpft von Jahr zu Jahr zusammen, und er weiß nicht, ob er sich über die Begräbnisse freuen oder über die Gräber ärgern soll.
»Sie leben von den Toten, Lestiboudois!«, hatte ihm schließlich eines Tages der Herr Pfarrer gesagt.
Diese gruselige Bemerkung hatte ihn nachdenklich gestimmt; eine Zeitlang hörte er damit auf; aber noch heute fährt er mit dem Legen seiner Knollen fort und versichert sogar mit Nachdruck, sie wüchsen ganz von selber.
Seit den Ereignissen, die hier erzählt werden sollen, hat sich in Yonville tatsächlich nichts verändert. Die Blechtrikolore dreht sich noch immer auf der Kirchturmspitze; vor dem Laden des Modewarenhändlers flattern nach wie vor die beiden Kattunwimpel im Wind; die Fötusse des Apothekers, die wie Päckchen weißer Stärke aussehen, verwesen immer mehr in dem trübe gewordenen Alkohol, und noch immer zeigt der alte, goldene, vom Regen missgefärbte Löwe über dem Tor des Gasthauses den Vorübergehenden seine Pudelmähne.
An dem Abend, da das Ehepaar Bovary in Yonville eintreffen sollte, war die Wirtin jenes Gasthofs, die Witwe Lefrançois, so stark beschäftigt, dass sie beim Hantieren mit ihren Kasserollen dicke Tropfen schwitzte. Am folgenden Tag war nämlich Markt im Flecken. Da musste im voraus Fleisch zerteilt, Geflügel ausgenommen, Suppe gekocht und Kaffee gebrannt werden. Außerdem hatte sie ihre regelmäßigen Tischgäste, und dazu kamen heute noch der Doktor, seine Frau und deren Dienstmädchen; am Billard wurde schallend gelacht; drei Müllerburschen in der kleinen Gaststube riefen nach Schnaps; das Holz flammte, die Glut prasselte, und auf dem langen Küchentisch erhoben sich zwischen rohen Hammelvierteln Stapel von Tellern und zitterten unter den Stößen des Hackklotzes, auf dem Spinat zerkleinert wurde. Vom Geflügelhof war das Gegacker der Hühner zu hören, hinter denen die Magd herlief, um ihnen den Hals abzuschneiden.
Ein Mann in grünen Lederpantoffeln, leicht von den Blattern gezeichnet und eine Samtkappe mit goldener Troddel auf dem Kopf, wärmte sich am Kamin den Rücken. Sein Gesicht drückte nichts als Selbstzufriedenheit aus, und er wirkte, als lebe er genauso ruhig wie der Stieglitz, der über seinem Kopf in einem Weidenrutenbauer hing; es war der Apotheker.
»Artémise!«, schrie die Wirtin, »zerknick Reisig, füll die Karaffen, trag Schnaps auf, beeil dich! Wenn ich nur wüsste, was ich der Gesellschaft, die Sie erwarten, als Nachtisch vorsetzen soll! Du meine Güte! Die Umzugsleute fangen schon wieder mit ihrem Geklapper auf dem Billard an! Und dabei steht ihr Wagen noch immer in der Einfahrt! Die ›Schwalbe‹ bringt es fertig und rammt ihn, wenn sie kommt! Ruf Polyte, er soll ihn beiseite schieben …! Wenn ich mir vorstelle, Monsieur Homais, dass sie seit heute morgen schon fünfzehn Partien gespielt und acht Schoppen Zider getrunken haben …! Die stoßen mir noch ein Loch ins Billardtuch«, fuhr sie fort und sah ihnen von weitem zu, den Schaumlöffel in der Hand.
»Das wäre weiter kein Malheur!«, antwortete Homais. »Dann müssten Sie ein neues kaufen.«
»Ein neues Billard!«, jammerte die Witwe.
»Weil das jetzige nicht mehr viel taugt, Madame Lefrançois; ich sage es Ihnen immer wieder, Sie schaden sich selbst am meisten! Sehr sogar! Und überdies verlangen heutzutage die Spieler enge Löcher und schwere Queues. Man spielt die Bälle nicht mehr direkt an; es ist alles anders geworden! Man muss mit seinem Jahrhundert gehen! Sehn Sie sich mal Tellier an …«
Die Wirtin wurde rot vor Ärger. Der Apotheker sprach weiter:
»Sie können sagen, was Sie wollen: sein Billard ist schmucker als Ihrs; und wenn es darum geht, eine patriotische Poule zu spielen, für die Polen oder für die Überschwemmten in Lyon …«
»Vor Bettlern wie denen hat unsereiner keine Angst!«, unterbrach ihn die Wirtin und zog ihre dicken Schultern hoch. »Lassen Sie’s gut sein, Monsieur Homais, solange der ›Goldene Löwe‹ weiterbesteht, wird er Gäste haben. Wir haben Speck auf den Rippen! Wogegen Sie es eines Morgens erleben werden, dass Ihr ›Café Français‹ die Bude zugemacht hat und an den Fensterläden gewisse hübsche Zettelchen kleben! Ein neues Billard anschaffen?«, fuhr sie im Selbstgespräch fort, »wo meins so bequem ist zum Wäschelegen? Und wo ich zur Jagdzeit bequem darauf sechs Gäste übernachten lassen kann …? Aber dieser langweilige Kerl, der Hivert, kommt und kommt nicht!«
»Warten Sie etwa auf den mit dem Essen für Ihre Herren?«, fragte der Apotheker.
»Auf den warten? Monsieur Binet ist ja noch nicht da! Schlag sechs werden Sie ihn hereinkommen sehen; so was an Pünktlichkeit lebt nicht nochmal auf Erden. Er muss stets seinen Platz im kleinen Gastzimmer haben! Eher ließe er sich totschlagen als woanders zu essen! Und anspruchsvoll ist er! Und heikel in Bezug auf den Zider! Der ist nicht wie Monsieur Léon; der kommt manchmal erst um sieben oder sogar um halb acht; der schaut nicht mal hin, was er isst. Solch ein netter junger Mann! Kein lautes Wort spricht er.«
»Da sehen Sie den Unterschied zwischen einem jungen Mann, der eine gute Erziehung genossen hat, und einem ehemaligen Kavalleristen und jetzigen Steuereinnehmer.«
Es schlug sechs. Binet trat ein.
Er trug einen blauen Gehrock, der in sich steif rings um seinen mageren Körper herabfiel, und seine Ledermütze mit den mittels einer Schnur oben am Kopfteil festgenähten Klappen ließ unter dem hochstehenden Schirm eine kahle Stirn sehen, was vom ständigen Tragen des Helms herrührte. Er hatte eine schwarze Tuchweste an, einen Rosshaarkragen, eine graue Hose, und seine gut gewichsten Schuhe hatten zu jeder Jahreszeit zwei gleiche Ausbeulungen; das kam von hervortretenden Zehen. Kein Haar ragte aus der Linie seines blonden Rundbarts hervor, der um das Kinn herumging und sein langes, fahles Gesicht mit den kleinen Augen und der Hakennase umrahmte wie eine Buchsbaumeinfassung ein Beet. Er war ein Meister in allen Kartenspielen, ein guter Jäger, besaß eine schöne Handschrift und hatte daheim eine Drehbank stehen; darauf drechselte er aus purem Vergnügen Serviettenringe, die er mit der Eifersucht eines Künstlers und dem Egoismus eines Spießers in seinem Haus aufstapelte.
Er ging auf die kleine Gaststube zu; aber aus der mussten erst die drei Müllerburschen hinausbefördert werden; und während der ganzen Zeit, da für ihn gedeckt wurde, blieb Binet stumm auf seinem Platz neben dem Ofen stehen; dann schloss er die Tür und nahm seine Mütze ab, wie er stets zu tun pflegte.
»Der nutzt sich die Zunge nicht durch Höflichkeitsfloskeln ab!«, sagte der Apotheker, sobald er mit der Wirtin allein war.
»Mehr sagt er nie«, antwortete sie; »letzte Woche sind zwei Tuchreisende hier gewesen, lustige Brüder, die den ganzen Abend lang einen Haufen so komischer Sachen erzählt haben, dass ich Tränen lachen musste, und er hat dagesessen wie ein Stockfisch, ohne ein Wort zu sagen.«
»Ja«, sagte der Apotheker, »keine Phantasie, keine witzigen Einfälle, nichts, was einen Mann der Gesellschaft ausmacht!«
»Dabei heißt es, er sei bemittelt«, wandte die Wirtin ein.
»Der und bemittelt?«, entgegnete Homais. »Der? Na, bei seiner Stellung ist es immerhin möglich«, fügte er in ruhigerem Tonfall hinzu.
Und er fuhr fort:
»Ja, wenn ein Kaufmann mit ausgedehnten Beziehungen, wenn ein Rechtsanwalt, ein Arzt, ein Apotheker so absorbiert werden, dass sie Sonderlinge oder sogar Griesgrame werden, dann verstehe ich das; Beispiele dafür werden in den Geschichtswerken angeführt! Aber das rührt dann wenigstens davon her, dass sie sich über irgendwas Gedanken machen. Wie oft ist es zum Beispiel mir passiert, dass ich auf meinem Schreibtisch nach meinem Federhalter gesucht habe, weil ich ein Schildchen schreiben wollte, und schließlich merkte ich dann, dass ich ihn mir hinters Ohr gesteckt hatte!«
Inzwischen war Madame Lefrançois auf die Haustürschwelle getreten, um nachzusehen, ob die »Schwalbe« noch immer nicht komme. Sie erbebte. Ein schwarzgekleideter Mann betrat plötzlich die Küche. Im letzten Dämmerlicht waren sein kupferrotes Gesicht und sein athletischer Körper zu erkennen.
»Was steht zu Diensten, Herr Pfarrer?«, fragte die Wirtin und nahm vom Kamin einen der Messingleuchter, die dort mit ihren Kerzen eine Säulenreihe bildeten. »Wollen Sie was trinken? Ein Schlückchen Johannisbeerlikör oder ein Glas Wein?«
Der Geistliche dankte äußerst höflich. Er wolle seinen Regenschirm abholen, den er neulich im Kloster Ernemont habe stehen lassen; und nachdem er Madame Lefrançois gebeten hatte, ihn im Lauf des Abends ins Pfarrhaus zu schicken, ging er, um sich zur Kirche zu begeben, wo das Angelus geläutet wurde.
Als der Apotheker den Hall seiner Schuhe auf dem Marktplatz nicht mehr vernahm, fand er, jener habe sich soeben sehr ungebührlich benommen. Das Abschlagen einer angebotenen Erfrischung dünke ihn eine ganz abscheuliche Heuchelei; die Priester becherten alle, wenn man sie nicht sehe, und führten am liebsten die Zeiten des Zehnten wieder ein.
Die Wirtin übernahm die Verteidigung ihres Pfarrers:
»Übrigens würde er vier wie Sie übers Knie legen. Letztes Jahr hat er unsern Leuten beim Stroheinfahren geholfen; bis zu sechs Bund auf einmal hat er getragen, so stark ist er!«
»Bravo!«, sagte der Apotheker. »Schickt nur eure Töchter zu solchen Kraftprotzen zur Beichte! Wenn ich die Regierung wäre, würde ich anordnen, die Priester einmal im Monat zur Ader zu lassen. Ja, Madame Lefrançois, alle Monat eine gehörige Phlebotomie, im Interesse der Ordnung und der Sittlichkeit!«
»Seien Sie doch still, Monsieur Homais! Sie sind gottlos! Sie haben keine Religion!«
Der Apotheker antwortete:
»Ich habe eine Religion, meine eigene Religion, und ich habe sogar mehr davon als alle diese Leutchen mit ihrem Mummenschanz und ihren Gauklerkünsten! Selbstverständlich verehre ich Gott! Ich glaube an ein höchstes Wesen, an einen Schöpfer – wer er ist, das geht mich nichts an –, der uns hierher gesetzt hat, damit wir unsere Pflichten als Staatsbürger und Familienväter erfüllen; aber ich habe nicht das Bedürfnis, in eine Kirche zu gehen, dort Silberschüsseln zu küssen und aus meiner Tasche eine Bande von Possenreißern zu mästen, die sich besser nähren als wir! Man kann ihn ebenso gut in einem Wald verehren, auf freiem Feld oder meinetwegen sogar im Sichversenken in die Himmelsweiten, wie die Alten. Mein Gott ist der Gott Sokrates’, Franklins, Voltaires und Bérangers! Ich bin für das ›Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars‹ und die unsterblichen Grundsätze von ’89! Daher glaube ich nicht an den guten Mann von liebem Gott, der mit dem Spazierstock in der Hand durch seinen Garten schlendert, seine Freunde in einem Walfischbauch einquartiert, mit einem Schrei stirbt und nach drei Tagen wieder aufersteht: das alles ist Unsinn und überdies gegen alle Gesetze der physischen Welt; was uns, nebenbei gesagt, beweist, dass die Pfaffen von je in schmählicher Unwissenheit gelebt haben, in die sie am liebsten die ganze Menschheit mit hineinzögen.«
Er verstummte und suchte mit den Augen rings um sich her nach einem Publikum; denn in seinem Überschwang hatte der Apotheker für kurze Zeit geglaubt, er spreche vor dem voll versammelten Gemeinderat. Aber die Gastwirtin hörte nicht mehr zu; sie lauschte auf ein fernes Rollen. Man unterschied das Rasseln eines Wagens, vermischt mit dem Klappern lockerer Hufeisen auf dem Erdboden, und endlich hielt die »Schwalbe« vor der Tür.
Es war ein gelber Kasten auf zwei großen Rädern, die bis fast an das Wagenverdeck hinaufreichten, den Fahrgästen die Aussicht raubten und sie an den Schultern bespritzten. Die kleinen Scheiben der Fenster klirrten in ihren Rahmen, wenn der Wagen geschlossen war, und auf ihrer alten Staubschicht klebten hier und dort Schmutzspritzer, die nicht einmal die Gewitterregen völlig abwuschen. Sie war mit drei Pferden bespannt, deren erstes als Vorspannpferd ging, und beim Bergabfahren holperte sie und streifte hinten den Boden.
Ein paar Yonviller Bürger kamen auf den Marktplatz; alle redeten gleichzeitig, fragten nach Neuigkeiten, Erklärungen und Körben; Hivert wusste gar nicht, wem er zuerst antworten sollte. Er pflegte nämlich in der Stadt allerlei Aufträge aus dem Dorf zu erledigen. Er ging in die Läden, brachte dem Schuster Lederrollen mit, dem Hufschmied Roheisen; für seine Herrin eine Tonne Heringe, holte Hauben bei der Modistin ab, vom Friseur Perücken, und auf dem Rückweg verteilte er längs der Fahrstrecke seine Pakete, indem er sie einfach über die Hecken der Einfriedigungen warf, wobei er auf dem Kutschbock aufstand und aus voller Kehle schrie, während seine Pferde frei weiterliefen.
Ein Zwischenfall hatte ihn aufgehalten; Madame Bovarys Windspiel war querfeldein davongelaufen. Man hatte eine gute Viertelstunde nach ihm gepfiffen. Hivert war sogar eine halbe Meile zurückgefahren; jede Minute hatte er geglaubt, es zu erblicken; aber schließlich hatte die Fahrt fortgesetzt werden müssen. Emma hatte geweint und war ganz außer sich gewesen; sie hatte Charles die Schuld an dem Unglück gegeben. Monsieur Lheureux, der Stoffhändler, der mit ihr im Wagen saß, hatte sie durch eine Menge Beispiele von verlaufenen Hunden zu trösten versucht, die ihren Herrn nach langen Jahren wiedererkannt hätten. Von einem werde erzählt, so sagte er, dass er von Konstantinopel wieder nach Paris gelaufen sei. Ein anderer habe fünfzig Meilen in gerader Linie zurückgelegt und vier Flüsse durchschwommen; und sein leiblicher Vater habe einen Pudel besessen, der ihn nach zwölfjähriger Abwesenheit eines Abends auf der Straße von hinten her angesprungen habe, als er zum Essen in die Stadt gegangen sei.