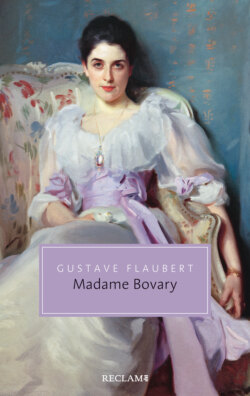Читать книгу Madame Bovary. Sittenbild aus der Provinz - Gustave Flaubert, Gustave Flaubert - Страница 4
Erster Teil I
ОглавлениеWir hatten Arbeitsstunde, als der Direktor hereinkam; ihm folgten ein »Neuer«, der noch sein Zivilzeug anhatte, und ein Pedell, der ein großes Pult trug. Die geschlafen hatten, fuhren hoch, und alle standen auf, als seien sie beim Arbeiten überrascht worden.
Der Direktor deutete uns durch eine Handbewegung an, dass wir uns wieder setzen sollten; dann wandte er sich an den Studienaufseher:
»Monsieur Roger«, sagte er halblaut zu ihm, »diesen Schüler hier möchte ich Ihrer Obhut empfehlen; er kommt in die Quinta. Wenn sein Verhalten und sein Fleiß lobenswert sind, kann er ›zu den Großen‹ kommen, zu denen er seinem Alter nach gehört.«
Der Neue war in dem Winkel hinter der Tür stehengeblieben, so dass man ihn kaum hatte wahrnehmen können; er war ein Bauernjunge, ungefähr fünfzehn Jahre alt und größer als wir alle. Das Haar trug er über der Stirn geradegeschnitten, wie ein Dorfkantor; er sah klug und sehr verlegen aus. Obwohl er keine breiten Schultern hatte, schien seine grüne Tuchjacke mit den schwarzen Knöpfen ihn an den Ärmelausschnitten zu beengen; aus den Aufschlägen sahen rote Handgelenke hervor, die es gewohnt waren, nackt zu sein. Seine blaubestrumpften Beine kamen aus einer gelblichen, von den Trägern straff hochgezogenen Hose. Seine Schuhe waren derb, schlecht gewichst und mit Nägeln beschlagen.
Es wurde mit dem Vorlesen der Arbeiten begonnen. Er spitzte die Ohren und hörte zu, aufmerksam wie bei der Predigt, und wagte nicht einmal, die Beine übereinanderzuschlagen oder den Ellbogen aufzustützen, und um zwei Uhr, als es läutete, musste der Studienaufseher ihn besonders auffordern, damit er sich mit uns andern in Reih und Glied stellte.
Es herrschte bei uns der Brauch, beim Betreten des Klassenzimmers unsere Mütze auf die Erde zu werfen, um die Hände freier zu haben; es galt, sie von der Tür aus unter die Bank zu schleudern, so dass sie an die Wand schlug und viel Staub aufwirbelte; das war so üblich.
Aber sei es nun, dass dies Verfahren dem Neuen nicht aufgefallen war, oder sei es, dass er sich nicht getraute, sich ihm anzupassen, jedenfalls war das Gebet gesprochen, und er hielt noch immer seine Mütze auf den Knien. Es war eine jener bunt zusammengesetzten Kopfbedeckungen, in denen sich die Grundbestandteile der Bärenfellmütze, der Tschapka, des steifen Huts, der Otterfellkappe und der baumwollenen Zipfelmütze vereinigt fanden; mit einem Wort, eins der armseligen Dinge, deren stumme Hässlichkeit Tiefen des Ausdrucks besitzt wie das Gesicht eines Schwachsinnigen. Sie war eiförmig und durch Fischbeinstäbchen ausgebaucht; sie begann mit zwei kreisrunden Wülsten; dann wechselten, getrennt durch einen roten Streifen, Rauten aus Samt und Kaninchenfell miteinander ab; dann folgte eine Art Sack, der in einem mit Pappe versteiften Vieleck endete; dieses war mit komplizierter Litzenstickerei bedeckt, und am Ende eines langen, viel zu dünnen, daran herabhängenden Fadens baumelte eine kleine, eichelförmige Troddel aus Goldfäden. Die Mütze war neu; der Schirm glänzte.
»Steh auf«, sagte der Lehrer.
Er stand auf; seine Mütze fiel hin. Die ganze Klasse fing an zu lachen.
Er bückte sich, um sie aufzunehmen. Einer seiner Nebenmänner stieß sie mit einem Ellbogenschubs wieder hinunter; er hob sie noch einmal auf.
»Leg doch deinen Helm weg«, sagte der Lehrer; er war ein Witzbold.
Die Schüler brachen in schallendes Gelächter aus, und das brachte den armen Jungen so sehr aus der Fassung, dass er nicht wusste, ob er seine Mütze in der Hand behalten, sie am Boden liegenlassen oder sich auf den Kopf stülpen solle. Er setzte sich wieder hin und legte sie auf seine Knie.
»Steh auf«, sagte der Lehrer wiederum, »und sag mir deinen Namen.«
Der Neue stieß mit blubbernder Stimme einen unverständlichen Namen hervor.
»Nochmal!«
Das gleiche Silbengeblubber wurde vernehmlich, überdröhnt vom Gebrüll der Klasse.
»Lauter!«, rief der Lehrer, »lauter!«
Da fasste der Neue einen verzweifelten Entschluss, machte seinen maßlos großen Mund auf und stieß mit vollen Lungen, wie um jemanden zu rufen, das Wort »Charbovari« hervor.
Es entstand ein Lärm, der mit jähem Schwung losbrach, im crescendo mit dem Gellen schriller Stimmen anstieg (es wurde geheult, gebellt, getrampelt und immer wieder gerufen: Charbovari! Charbovari!), der dann in Einzeltönen einherrollte, äußerst mühsam zur Ruhe kam und manchmal unvermittelt auf einer Bankreihe wieder losbrach, wo hier und dort ein unterdrücktes Lachen laut wurde, wie ein nicht ganz ausgebrannter Knallfrosch.
Unter dem Hagel von Strafarbeiten stellte sich die Ordnung in der Klasse allmählich wieder her, und der Lehrer, dem es endlich gelungen war, den Namen Charles Bovary zu verstehen, nachdem er sich ihn hatte diktieren, buchstabieren und nochmals vorlesen lassen, wies sofort dem armen Teufel einen Platz auf der Strafbank an, unmittelbar vor dem Katheder. Er setzte sich in Bewegung, aber ehe er hinging, zögerte er.
»Was suchst du?«, fragte der Lehrer.
»Meine Mü…«, sagte der Neue schüchtern und sah sich beunruhigt rings um.
»Fünfhundert Verse die ganze Klasse!« Die wütende Stimme, die das ausgerufen hatte, vereitelte wie das »Quos ego« einen neuen Sturmausbruch. – »Verhaltet euch doch ruhig!«, fuhr der Lehrer unwillig fort und wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch, das er unter seinem Käppchen hervorgezogen hatte. »Und du, der Neue, du schreibst mir zwanzigmal ab ›ridiculus sum‹.«
Dann, mit milderer Stimme:
»Na, deine Mütze, die wirst du schon wiederfinden; die hat dir keiner gestohlen!«
Alles war wieder ruhig geworden. Die Köpfe neigten sich über die Hefte, und der Neue verharrte zwei Stunden lang in musterhafter Haltung, obwohl von Zeit zu Zeit ein Kügelchen aus zerkautem Papier, das mittels eines Federhalters geschleudert wurde, auf seinem Gesicht zerplatzte. Aber er wischte sich mit der Hand ab und blieb reglos mit niedergeschlagenen Augen sitzen.
Abends, bei der Arbeitsstunde, holte er seine Ärmelschoner aus seinem Pult hervor, brachte seine Habseligkeiten in Ordnung und richtete sorgsam sein Schreibpapier her. Wir beobachteten ihn, wie er gewissenhaft arbeitete, alle Vokabeln im Wörterbuch nachschlug und sich große Mühe gab. Wohl dank dieser Gutwilligkeit, die er bezeigte, brauchte er nicht in die nächstniedrige Klasse zurückversetzt zu werden; denn er beherrschte zwar ganz leidlich die Regeln, besaß jedoch in den Wendungen nicht eben Eleganz. Die Anfangsgründe des Lateinischen hatte der Pfarrer seines Dorfs ihm beigebracht; aus Sparsamkeit hatten seine Eltern ihn so spät wie möglich aufs Gymnasium geschickt.
Sein Vater, Charles Denis Bartholomé Bovary, ein ehemaliger Bataillons-Wundarzt, hatte um 1812 bei Aushebungen Unannehmlichkeiten gehabt und war damals gezwungen, aus dem Heeresdienst auszuscheiden; er hatte nun seine persönlichen Vorzüge ausgenutzt und im Handumdrehen eine Mitgift von sechzigtausend Francs eingeheimst, die sich ihm in Gestalt der Tochter eines Hutfabrikanten darbot; sie hatte sich in sein Aussehen verliebt. Er war ein schöner Mann, ein Aufschneider, der seine Sporen laut klingen ließ, einen Backen- und Schnurrbart trug, stets Ringe an den Fingern hatte und sich in Anzüge von auffälliger Farbe kleidete; er wirkte wie ein Haudegen und besaß das unbeschwerte Gehaben eines Handelsreisenden. Nun er verheiratet war, lebte er zwei oder drei Jahre vom Vermögen seiner Frau, aß gut, stand spät auf, rauchte aus langen Porzellanpfeifen, kam abends erst nach dem Theater nach Hause und war ein eifriger Café-Besucher. Der Schwiegervater starb und hinterließ wenig; er war darob empört, übernahm schleunigst die Fabrik, büßte dabei einiges Geld ein und zog sich danach aufs Land zurück, wo er es zu etwas bringen wollte. Aber da er von der Landwirtschaft nicht mehr verstand als von gefärbtem Baumwollstoff, da er seine Pferde lieber ritt, anstatt sie zur Feldarbeit zu schicken, da er seinen Zider lieber flaschenweise trank, anstatt ihn fassweise zu verkaufen, das schönste Geflügel seines Hofs selber aß und sich seine Jagdstiefel mit Schweinespeck einfettete, sah er nur zu bald ein, dass er am besten tue, wenn er auf jede geschäftliche Betätigung verzichte.
Also pachtete er für zweihundert Francs im Jahr in einem Dorf des Grenzgebietes der Landschaft Caux und der Picardie eine Heimstatt, die halb Bauernhof, halb Herrenhaus war; und zog sich, verbittert, von Reue zernagt, unter Anklagen wider den Himmel dorthin zurück; er war jetzt fünfundvierzig Jahre alt; die Menschen ekelten ihn an, wie er sagte, und er war entschlossen, fortan in Frieden zu leben.
Seine Frau war anfangs toll in ihn verschossen gewesen; unter tausend Demütigungen hatte sie ihn geliebt, und diese hatten ihn noch mehr von ihr entfernt. Ehedem war sie heiter, mitteilsam und herzlich gewesen; bei zunehmendem Alter war sie (wie abgestandener Wein, der sich in Essig umsetzt) mürrisch, zänkisch und nervös geworden. Zunächst hatte sie, ohne zu klagen, sehr gelitten, als sie ihn allen Dorfdirnen nachlaufen sah und zwanzig üble Lokale ihn ihr nachts abgestumpft und vor Besoffenheit stinkend heimschickten! Dann hatte sich ihr Stolz empört. Danach hatte sie geschwiegen und ihre Wut in einem stummen Stoizismus hinuntergewürgt, den sie bis zu ihrem Tod beibehielt. Sie war in geschäftlichen Angelegenheiten immerfort unterwegs. Sie ging zu den Anwälten, zum Präsidenten, wusste, wann Wechsel fällig wurden, erlangte Prolongationen; und im Haus plättete, nähte und wusch sie, beaufsichtigte das Gesinde und bezahlte die Rechnungen, während Monsieur, ohne sich um irgendetwas zu kümmern, beständig in maulender Schläfrigkeit befangen, aus der er nur erwachte, um seiner Frau Unfreundlichkeiten zu sagen, rauchend am Kamin saß und in die Asche spuckte.
Als sie ein Kind bekam, musste es zu einer Amme gegeben werden. Sobald der Kleine wieder daheim war, wurde er verhätschelt wie ein Prinz. Die Mutter fütterte ihn mit eingemachtem Obst; der Vater ließ ihn barfuß herumlaufen, und um sich als Philosoph aufzuspielen, pflegte er sogar zu sagen, eigentlich könne er völlig nackt gehen, wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den mütterlichen Bestrebungen hatte er sich ein gewisses männliches Idealbild von der Kindheit in den Kopf gesetzt, nach dem er seinen Sohn zu modeln trachtete; er sollte streng erzogen werden, nach Art der Spartaner, damit er sich tüchtig abhärte. Er ließ ihn in einem ungeheizten Zimmer schlafen, brachte ihm bei, große Schlucke Rum zu trinken und den Prozessionen Schimpfwörter nachzurufen. Da jedoch der Kleine von Natur friedfertig war, sprach er schlecht auf diese Bemühungen an. Stets schleppte seine Mutter ihn mit sich herum; sie schnitt ihm Papierpuppen aus, erzählte ihm Geschichten und unterhielt sich mit ihm in endlosen Selbstgesprächen, die erfüllt waren von schwermütigem Frohsinn und geschwätzigen Zärtlichkeiten. In der Einsamkeit ihres Lebens übertrug sie auf diesen Kinderkopf alle ihre unerfüllten und zunichte gewordenen Sehnsüchte. Sie träumte von hohen Stellungen, sie sah ihn schon groß, schön, klug, versorgt, beim Amt für Brücken- und Straßenbau oder als Richter. Sie lehrte ihn lesen und brachte es an einem alten Klavier, das sie besaß, sogar fertig, dass er ein paar kleine Lieder sang. Aber von alledem sagte Monsieur Bovary, der von gelehrten Dingen nicht viel hielt, es lohne nicht die Mühe. Würden sie je in der Lage sein, ihn die staatlichen Schulen besuchen zu lassen, ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen? Übrigens setze ein Mann sich im Leben stets durch, wenn er sicher auftrete. Madame Bovary biss sich auf die Lippen, und der kleine Junge stromerte im Dorf umher.
Er folgte den Knechten aufs Feld und verjagte mit Erdklumpenwürfen die Krähen; sie flatterten davon. Er aß die längs der Chausseegräben wachsenden Brombeeren, hütete mit einer Gerte die Truthähne, half beim Heuen, lief in den Wald, spielte an Regentagen unter dem Kirchenportal »Himmel und Hölle« und bestürmte an Feiertagen den Küster, ihn die Glocke läuten zu lassen, damit er sich mit seinem ganzen Körpergewicht an das dicke Seil hängen und sich durch dessen Schwung emporheben lassen konnte.
So gedieh er wie eine Eiche. Er bekam kräftige Hände und eine schöne Gesichtsfarbe.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, setzte seine Mutter es durch, dass mit eigentlichem Unterricht begonnen werden sollte. Damit wurde der Pfarrer beauftragt. Allein die Stunden waren so kurz und wurden so unregelmäßig abgehalten, dass nicht viel dabei herauskam. Sie wurden erteilt, wenn der Pfarrer gerade nichts Besseres zu tun hatte, in der Sakristei, im Stehen, in aller Hast, zwischen einer Taufe und einem Begräbnis; oder er ließ nach dem Angelus, wenn er das Haus nicht zu verlassen brauchte, seinen Schüler holen. Sie stiegen dann in sein Zimmer hinauf und machten es sich bequem: Mücken und Nachtschmetterlinge tanzten um die Kerze. Es war warm, das Kind schlief ein, und der wackere Pfarrer dämmerte mit den Händen auf dem Bauch ebenfalls ein, und bald schnarchte er mit offenem Mund. Es kam aber auch vor, dass der Herr Pfarrer, wenn er einem Kranken in der Umgebung die letzte Wegzehrung gereicht hatte, auf dem Heimweg Charles sich im Freien herumtreiben sah; dann rief er ihn zu sich, hielt ihm eine Viertelstunde lang eine Strafpredigt und nahm die Gelegenheit wahr, ihn am Fuß eines Baums ein Verbum konjugieren zu lassen. Dann störte sie entweder ein Regenguss oder ein vorübergehender Bekannter. Übrigens war er durchaus mit ihm zufrieden und sagte sogar, der »junge Mann« habe ein gutes Gedächtnis.
So konnte es mit Charles nicht weitergehen. Madame wurde energisch. Beschämt oder wohl eher müde gab Monsieur ohne Widerrede nach; es sollte nur ein Jahr damit gewartet werden, bis der Junge seine Erstkommunion hinter sich gebracht hatte.
Darüber gingen weitere sechs Monate hin; doch im nächsten Jahr wurde Charles tatsächlich auf das Gymnasium von Rouen geschickt; gegen Ende Oktober brachte der Vater selber ihn hin; es war um die Zeit des Sankt-Romanus-Jahrmarkts.
Heute würde es uns allen unmöglich sein, sich seiner noch deutlich zu erinnern. Er war ein ziemlich phlegmatischer Junge, der in den Pausen spielte, während der Arbeitsstunden lernte, beim Unterricht zuhörte, im Schlafsaal gut schlief und im Refektorium tüchtig zulangte. Sein Betreuer war ein Eisengroßhändler in der Rue de la Ganterie, der ihn einmal im Monat an Sonntag nach Ladenschluss abholte; er schickte ihn spazieren, damit er sich am Hafen die Schiffe ansehe; danach brachte er ihn dann gegen sieben Uhr, vor dem Abendessen, wieder zurück. Jeden Donnerstagabend schrieb Charles einen langen Brief an seine Mutter, und zwar mit roter Tinte und drei Siegeloblaten; danach vertiefte er sich in seine Geschichtshefte, oder er las auch in einem alten Band des »Anacharsis«, der im Arbeitszimmer herumlag. Bei den Spaziergängen unterhielt er sich mit dem Schuldiener, der wie er vom Lande stammte.
Durch seinen Fleiß hielt er sich stets in der Mitte der Klasse; einmal gewann er sogar einen ersten Preis in Naturkunde. Doch gegen Ende seines Tertianerjahrs nahmen ihn seine Eltern vom Gymnasium, um ihn Medizin studieren zu lassen; sie waren davon überzeugt, dass er sich allein bis zur Reifeprüfung durchhelfen könne.
Seine Mutter suchte für ihn bei einem ihr bekannten Färber ein Zimmer im vierten Stock mit Ausblick auf die Eau-de-Robec. Sie traf Vereinbarungen über den Pensionspreis, besorgte Möbel, einen Tisch und zwei Stühle, ließ von zu Hause ein altes Kirschholzbett kommen und kaufte außerdem einen kleinen gusseisernen Ofen nebst einem Vorrat an Brennholz, damit ihr armer Junge es warm habe. Dann fuhr sie am Ende der Woche wieder heim, nach Tausenden von Ermahnungen, er solle sich gut aufführen, nun er ganz sich selbst überlassen sei.
Das Vorlesungsverzeichnis, das er am Schwarzen Brett las, machte ihn schwindlig: Anatomischer Kursus, Pathologischer Kursus, Physiologischer Kursus, Pharmazeutischer Kursus, Chemischer Kursus, Botanischer, Klinischer, Therapeutischer Kursus, nicht zu reden von der Hygiene und der praktischen Medizin, lauter Bezeichnungen, deren Etymologien er nicht kannte und die ihn anmuteten wie ebenso viele Pforten zu von erhabener Finsternis erfüllten Heiligtümern.
Er verstand nichts; er mochte zuhören, soviel er wollte, er nahm nichts in sich auf. Dabei arbeitete er; er hatte gebundene Kolleghefte; er folgte allen Vorlesungen und versäumte keine einzige Visite. Er vollbrachte sein kleines tägliches Arbeitspensum wie ein Pferd im Göpelwerk, das mit verbundenen Augen im Kreise läuft, ohne zu wissen, was es zerschrotet.
Um ihm Ausgaben zu ersparen, schickte seine Mutter ihm wöchentlich durch den Botenmann ein Stück Kalbsbraten; das bildete, wenn er vom Krankenhaus heimgekommen war, sein Mittagessen; dabei trommelte er mit den Schuhsohlen gegen die Zimmerwand. Dann musste er schleunigst wieder ins Kolleg, in den Anatomiesaal, ins Krankenhaus und dann abermals heim, durch sämtliche Straßen. Abends stieg er nach dem kargen Essen bei seinem Hauswirt wieder in seine Bude hinauf und machte sich in seinem feuchten Anzug, der ihm bei der Rotglut des Kanonenofens am Leibe dampfte, abermals an die Arbeit.
An schönen Sommerabenden, um die Stunde, da die lauen Straßen leer sind und die Dienstmädchen vor den Haustüren Federball spielen, machte er sein Fenster auf und lehnte sich hinaus. Der Bach, der aus dieser Rouener Stadtgegend ein hässliches Klein-Venedig macht, floss unter ihm vorbei, gelb, violett oder blau zwischen seinen Brücken und Gittern. Am Ufer hockten Arbeiter und wuschen sich die Arme im Wasser. An Stangen, die aus den Speichergiebeln hervorragten, trockneten an der Luft Baumwolldocken. Gegenüber, hinter den Dächern, dehnte sich der weite, klare Himmel mit der roten, sinkenden Sonne. Wie schön musste es im Freien sein! Wie kühl unter den Waldbuchen! Und er weitete die Nasenlöcher, um den köstlichen Geruch der Felder einzuatmen, der gar nicht bis zu ihm hindrang.
Er magerte ab, er schoss in die Höhe, und sein Gesicht bekam einen Leidenszug, der es fast interessant machte.
Natürlich wurde er nach und nach aus Lässigkeit allen Vorsätzen untreu, die er gefasst hatte. Einmal versäumte er die Visite, am nächsten Tag seine Vorlesung, allmählich fand er Geschmack am Faulenzen und ging überhaupt nicht mehr hin.
Er wurde Stammgast in einer Kneipe und ein leidenschaftlicher Dominospieler. Allabendlich in einer schmutzigen Spelunke zu hocken, um dort mit den Spielsteinen aus schwarzbepunkteten Hammelknochen auf Marmortischen zu klappern, dünkte ihn ein köstlicher Akt seiner Freiheit, der seine Selbstachtung erhöhte. Es war wie eine Einführung in Welt und Gesellschaft, der Zugang zu verbotenen Freuden; beim Eintreten legte er mit einer beinah sinnlichen Freude die Hand auf den Türknauf. Jetzt wurde in ihm viel Unterdrücktes lebendig; er lernte Couplets auswendig und gab sie gelegentlich zum Besten; er begeisterte sich für Béranger, konnte Punsch bereiten und lernte schließlich die Liebe kennen.
Dank dieser Vorarbeiten fiel er bei der Prüfung als Arzt zweiter Klasse völlig durch. Am gleichen Abend wurde er daheim erwartet, wo sein Erfolg gefeiert werden sollte.
Er zog zu Fuß los und machte am Dorfeingang halt; dorthin ließ er seine Mutter bitten und erzählte ihr alles. Sie entschuldigte ihn, schrieb den Misserfolg der Ungerechtigkeit der Examinatoren zu und richtete ihn dadurch ein bisschen auf, dass sie es übernahm, die Sache in Ordnung zu bringen. Erst fünf Jahre später erfuhr Monsieur Bovary die Wahrheit; sie war schon alt, er nahm sie hin, im Übrigen außerstande, anzunehmen, dass ein Mensch, der von ihm abstammte, ein Dummkopf sei.
So machte Charles sich von neuem an die Arbeit und bereitete sich ohne Unterbrechung auf die Stoffgebiete seines Examens vor; er lernte alle Fragen vorher auswendig. Daher bestand er mit einer ziemlich guten Note. Welch ein Freudentag für seine Mutter! Es wurde ein großes abendliches Festessen veranstaltet.
Wo sollte er seine Kunst nun ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen alten Arzt. Seit langem schon hatte die Mutter Bovary auf dessen Tod gelauert, und der Gute war kaum bestattet, als Charles sich auch schon als sein Nachfolger im Haus gegenüber niederließ.
Aber nicht genug damit, dass sie ihren Sohn großgezogen, dass sie ihn Medizin hatte studieren lassen und dass sie für die Ausübung seines Berufs Tostes entdeckt hatte: er musste eine Frau haben. Sie machte für ihn eine ausfindig: die Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe, fünfundvierzig Jahre alt und im Besitz einer Rente von zwölfhundert Francs.
Obwohl Madame Dubuc hässlich war, dürr wie eine Bohnenstange und bepickelt wie ein knospender Frühling, fehlte es ihr nicht an Bewerbern. Um zum Ziel zu gelangen, musste Mutter Bovary sie alle aus dem Feld schlagen, und sie triumphierte sogar sehr geschickt über die Machenschaften eines Metzgermeisters, der von der Geistlichkeit unterstützt wurde.
Charles hatte in der Heirat den Aufstieg in bessere Lebensbedingungen erblickt; er hatte geglaubt, er werde freier sein und könne über sich selber und sein Geld verfügen. Aber seine Frau hatte die Hosen an; er durfte vor den Leuten zwar dieses sagen, aber nicht jenes; alle Freitage musste er fasten, sich nach ihrem Geschmack kleiden und auf ihren Befehl hin die Patienten, die nicht bezahlten, hart anpacken. Sie machte seine Briefe auf, überwachte jeden seiner Schritte und belauschte, wenn es sich um Frauen handelte, durch die Zwischenwand hindurch die ärztlichen Ratschläge, die er in seinem Behandlungszimmer gab.
Morgens musste sie ihre Schokolade haben; sie forderte Rücksichtnahmen ohne Ende. Unaufhörlich jammerte sie über ihre Nerven, ihre Lunge, ihre Körpersäfte. Das Geräusch von Schritten tat ihr weh; war er außer Hause, so fand sie die Einsamkeit grässlich; kam er wieder, so sicherlich nur, um sie sterben zu sehen. Wenn Charles abends heimkehrte, streckte sie ihre langen mageren Arme unter der Bettdecke hervor, schlang sie ihm um den Hals, ließ ihn sich auf die Bettkante setzen und begann, ihm von ihren Kümmernissen zu erzählen: er vernachlässige sie, er liebe eine andre! Man habe es ihr ja gleich gesagt, dass sie unglücklich werden würde; und schließlich bat sie ihn um einen Gesundheitssirup und um ein bisschen mehr Liebe.