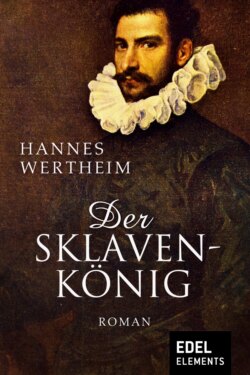Читать книгу Der Sklavenkönig - Hannes Wertheim - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеIngmales Geschichte
An Bord eines Sklavenschiffes, 1715
Er ist nicht wie die anderen. Er spricht nicht ihre Sprache. Er kennt nicht ihre Träume, nicht ihre Götter. Er ist anders.
Vielleicht erhält ihn dieses Bewußtsein am Leben. Er hat weiße Skorpione zwischen Daumen und Zeigefinger zerquetscht, sie ausgesaugt. Er hat in den dampfenden, stinkenden Eingeweiden eines verendeten Kamels Nächte überlebt, in denen nackte Felsen vor Kälte zersprangen. Er hat auf der Flucht vor den Verfolgern das Blut von toten Eseln getrunken. Er ist über brennenden Sand gelaufen. Er hat Steinvipern mit bloßer Faust die Köpfe abgerissen und ihnen das Gift aus den Drüsen gedrückt. Er hat zwei seiner Verfolger, maurische Reiter, zugleich mit einer Lanze durchbohrt, so daß ihnen die Rippen brachen und als rosafarbene Spieße in den Himmel ragten, einen leeren, toten Himmel, der niemals Regen spendet, der Tiere verenden, Pflanzen verdunsten und Menschen verdursten läßt.
Er ist ein Sohn der Wüste geworden, auf der Flucht vor den Menschenfängern Allahs und ihren krummen Musketen.
Er ist gegen sein hämmerndes Herz, gegen seine bis zum Bersten gespannten Lungen, gegen die sengende Sonne gelaufen, um sein Leben zu retten.
Er ist Ingmale, Sohn des Umgume, König von Ika Ibo, und es war ein böser, eifersüchtiger Geist, der ihn schließlich zur Beute seiner Häscher machte, endlose Meilen von seiner Heimat entfernt, von dem dunklen Regenwald an der Mündung des Ase. Dort, wo sein Thron stand, geschnitzt aus schwarzem Ebenholz, getragen von den weißen Stoßzähnen eines Elefanten, gekrönt mit dem ausgebleichten Schädel eines uralten Feindes. Dort, wo er hätte Gebieter sein sollen, über viele hundert Krieger, Weiber, Kinder und Sklaven. Dort, wo sein Volk Felder bestellte, Yams anpflanzte, und wo die Götter schwarze Gesichter hatten. Dort, wo die Berge wie die Rücken schlafender Riesen aus der Erde ragen. Er trägt das Zeichen des Löwen im Gesicht.
Die Weißen halten es für abscheuliche Narben. Drei riesige Striemen auf jeder Backe, die sich wie tektonische Verwerfungen über die dunkle Haut erheben. Das Erkennungszeichen eines Barbaren, so denken die Weißen, dem man mit vergifteten Dornen die Haut aufgeritzt und entstellt hat. Es wird den Preis drücken. Man nimmt nicht gern die mit den Zeichen ihres Stammes, mit den verstümmelten Ohren, den verlängerten Hälsen, den geweiteten Lippen. Sie wissen nicht, daß Ingmale der Sohn des Königs Umgume ist.
Jetzt ist er Sklave Nummer 66 an Bord der Bonne Chance – finis, basta, drauf gespuckt. Einer ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, einer ohne Vorfahren und ohne Kinder. Ein Sklave des weißen Mannes. Vor 38 Tagen hat das Schiff den Hafen von Sénégambia verlassen, mit leichter Brise im Rücken und Kurs auf Sainte-Domingue, der kolonialen Perle des französischen Reichs. Mit 187 Mann an Bord. 17 Seeleuten und 170 Sklaven, die Kopf an Kopf, Zehe an Zehe unter Deck liegen.
Das Schiff rollt und stampft durch atlantische Sturmzonen. Wellentäler, die tiefer sind als die Schluchten des Kongo, verschlingen den Rumpf und jagen ihn schwankend empor auf die Kämme von tosenden Brechern.
Die Luken sind dicht, die Deckroste verschlossen. Es ist stockfinster im Bauch der Sklavenbrigg. Seit Stunden, seit Tagen, seit einer Woche? Die Gefangenen atmen keine Luft mehr, sie atmen Schwaden von üblen Gerüchen. Die Eimer, über denen sie ihre Notdurft verrichten, quellen über, sind umgefallen, rollen von Luv nach Lee und überziehen die Männer mit einer stinkenden Brühe. Die Planken, auf denen sie liegen, sind blutig wie ein Schlachthausboden. Jeder zweite von ihnen ist ein Opfer der roten Ruhr und entleert seinen Darm schon lange nicht mehr in die herumrollenden Eimer.
Ingmale hat die Stunden in Atemzüge eingeteilt. Die Stunden vergehen in quälender Langsamkeit, denn er atmet nur selten. Er glaubt, daß er mit dem Gestank den Tod einatmet. Der Mann, mit dem er seine Handschelle und seine Fußkette teilt, ist längst verreckt. Die Ratten, deren Krallen dem schwankenden Schiffsboden trotzen, schleifen sich kratzend zu ihm heran. Ingmale rasselt mit den Ketten, wenn er atmet, um sie sich vom Leib zu halten. Er würde sie gerne essen, aber er kann sich nicht bewegen in der drangvollen Enge, die Ellbogen eines lebenden Nachbarn bohren sich schmerzhaft in seine Rippen.
Die Ratten wittern das eitrige, wunde Fleisch unter den Eisenringen. Wenn Ingmale schläft, nagen sie an den blankliegenden Knochen seines toten Gefährten. Ingmale schläft selten. Er ist anders als die anderen. Das Knirschen des Rumpfes, das Knarren von Tauwerk und die brausende See übertönen nicht das Wehgeschrei und das Winseln der Kranken und Sterbenden. Einige sind wahnsinnig vor Durst, die Matrosen haben sie seit Beginn des Sturmes vergessen. Wenn der Wind sich legt, werden sie unter Deck kommen und die Toten heraussuchen und die Kranken. Und man wird sie über Bord werfen, zu den Haien, die eben noch Lebenden und die Toten. Das Wasser ist bereits knapp genug, der Sturm hält sie auf, und ein kranker Neger ist eine Gefahr für den Rest der wertvollen Fracht. Schwarzes Elfenbein. Dreißig Pfund winken pro Stück. Auch für Sklave Nummer 66.
Ingmale kennt seinen Preis natürlich nicht, aber er weiß, er ist anders, er ist der Sohn eines Königs. Das hält ihn am Leben. Das und der schwarze Saphir. Der Stein der Götter, Zeichen seiner Unberührbarkeit, Zeichen seiner Unsterblichkeit. Er hat ihn vor seinen Häschern verborgen gehalten. Trickreich, findig. Er nahm ihn in den Mund, wenn die Araber ihm den Arsch zerteilten, um den Weißen zu zeigen, daß er gesund, kein Opfer der blutigen Ruhr und nicht mit einem Wachspfropfen verstopft sei, um sie zu täuschen. Er steckte ihn in den After, wenn man kam, um ihm das Maul aufzureißen und den weißen, harten Schmelz seiner Zähne zu loben. Und er verschluckte ihn, wenn man kam, um beides auf einmal zu prüfen. Der Stein ist viele Male durch ihn hindurchgewandert.
Manchmal glaubte er zu spüren, wie er ihm die Därme von innen aufschlitzte, aber er kam immer wieder zum Vorschein. Er ist unversehrt, und er wird Ingmale all das Unfaßbare überleben lassen. Die Weißen würden es die Hölle nennen, wenn sie nicht wüßten, daß ihre Ladung nicht zur menschlichen Rasse gehört.
Ingmale kennt keine Hölle. Er hat keinen Namen für das, was mit ihm und den anderen geschieht, aber er überlebt es.
Die Brigg überquert den Atlantik in achtundvierzig Tagen. Die ersten Möwen umkreisen kreischend die Rahen. Der Sturm legt sich nach zehn Tagen.
Die Luken werden geöffnet, der Bordarzt kommt herab, um die Toten zu zählen. Alle zehn Minuten muß er eine Pause machen. Hartgesottene Seeleute hieven ihn an Deck, weil er den pestilenzischen Gestank nicht ertragen kann. Er erbricht sich über die Reling und steigt wieder hinab. Er hat eine Arbeit zu erledigen, bevor man die Überlebenden an Deck holen, mit Wasser und Essig übergießen, ihre Schädel rasieren und ihren Zustand überprüfen kann.
Siebenundzwanzig halten der Überprüfung nicht stand und werden den Haien übergeben, die sich über das knochige Mahl nicht minder ärgern wie ein Plantagenbesitzer, der sich einen halbtoten Nigger hat aufschwatzen lassen.
Am Ende gehen auf der französischen Insel Sainte-Domingue, das die Eingeborenen Haiti, gebirgiges Land, nennen, zweiundsiebzig Sklaven von Bord. Gekleidet in rauhe Nesselhemden, paarweise aneinander gekettet in leidlichem Zustand, einige mit Wachspfropfen im Hintern, das farblos gewordene Haar mit Tinte nachgefärbt, die Zähne künstlich gebleicht, gestärkt mit dünnem Rum, die Mienen für immer erstarrt, obgleich sie das Schlimmste noch vor sich haben.
Ingmale ist gut in Schuß. Trotz der Narben im Gesicht das beste Pferd im Stall. Man pfercht ihn mit den anderen in einen Lattenverschlag, die Holzwände sind doppelt so hoch wie die Männer, oben ist der Himmel zu sehen. Ein feuchter, türkisfarbener, tropischer Himmel. Die Luft atmet sich köstlich und ist erfüllt vom Duft der Zitronenbäume. Eine trügerische Insel, die so aussieht, als habe sie Erbarmen.
Ohne Vorwarnung wird das Gatter in der Nacht geöffnet – oder ist es der frühe Morgen? Unter Flüchen, Geschrei und Kreischen drängen und stürzen Männer in vornehmen Röcken und Kniehosen herein. Sie tragen rohlederne Peitschen und Hanfseile, stürmen wie blind auf die verängstigten Schwarzen los und binden wahllos welche zusammen. Sie haben sich gesichert, was ihnen unter die Finger kam, und nun beginnt das Feilschen mit den Händlern.
Ingmale wird umlagert, schon strecken sich derbe Pranken nach seinem Kiefer aus. Ingmale hat den Stein längst verschluckt. Man klappt seinen Mund auf, erforscht seinen Schlund bis tief in den Rachen. Man nimmt keine Rücksicht auf Schmerzempfinden oder Gefühl oder Scham.
Er wird es überleben. Das in jedem Fall. Er versteht nur wenig von dem, was die Männer schreiend verhandeln. Auf dem Weg von der Wüste, durch den Dschungel und über den Fluß seiner ehemaligen Heimat hat er nur einige Brocken Französisch gelernt. Aber sie schmeckt ihm nicht, diese rasselnde Sprache, sie fließt nicht weich und dunkel durch seine Kehle wie das Bantu, schmiegt sich nicht an seinen Gaumen wie seine eigenen Gesänge.
Die Dämmerung steigt lavendelfarben auf, als Sklave Nummer 66 einen Besitzer gefunden hat. Es ist ein derber Mann mit einem roten Netz von Adern auf der Nase und Furchen im Gesicht, die Ingmale an die Äcker seiner Heimat erinnern, wenn Dürre herrscht. Grau und verkrustet. Der Mann hat ein Pferd dabei. Er sitzt auf. Ingmale trägt einen Eisenring um den Hals, von dort führt ein Lederseil bis zum Sattelknauf seines neuen Herrn. Die Hände sind ihm auf den Rücken gefesselt. Der Master drückt seine Fersen in die Flanken des Pferdes, es zuckelt los, ein Rucken, das sich vom Sattelknauf bis zum Eisenring mitteilt. Ingmale stolpert kurz, dann begreift er:
Er hat keine Wahl, er muß dem schaukelnden Hintern des Pferdes folgen. Er, der Sohn des Umgume, Sohn der Wüste und Herr des Regenwaldes. Der Stein schaukelt in seinen rumgetränkten Magensäften. Ingmale spürt ihn, und der Stein gibt ihm Kraft. Er ist unverwundbar.
Es geht bergauf in die Wälder. Ingmale erkennt Pflanzen seiner Heimat und den Schrei eines Vogels. Doch alles bleibt ihm fremd. Fremd wie das schrille Pfeifen in den Zuckerrohrfeldern, die sie am Abend erreichen. Bei Einbruch der Dunkelheit zieht die First Gang, die erste Garde der Feldarbeiter, an ihnen vorbei. Mit gesenkten Häuptern, die schwarzen Rücken nackt, die Muskeln hart gespannt vor Schmerz, Arbeit und Kummer. Auf einigen klafft wundes Fleisch, zerschnitten von rohledernen Peitschen. Ingmale sieht die Rücken, kennt nun sein Schicksal.
Man pfercht ihn zu den anderen Afrikanern. Denen, die noch wild und ungezähmt sind, denen, die man den Tieren zurechnet und die noch nicht das Brandzeichen des Besitzers tragen.
In dem Verschlag herrschen Hunger und Haß. Man stürzt sich wie ein Rudel Hunde auf die Schale mit schwarzäugigen Kartoffeln. Nur zwei verharren stehend, an eine Wand gelehnt. Ingmale und ein junger Mandingo, fast noch ein Kind. Ingmale schenkt ihm einen Blick der Anerkennung, der Knabe fängt ihn freudig auf und nickt. Ingmale braucht kein Essen, er trägt den Stein im Magen. Er ist unverwundbar. Aber nur für eine einzige Nacht.
Am nächsten Morgen wird vor der Baracke das Feuer geschürt, das Brandeisen in die lodernden Flammen getaucht. Von fern, aus den Zuckerrohrfeldern, weht traurig der Gesang der Feldarbeiter herüber. Sie wissen es, sie kennen es, sie haben es erlebt. Sie sind Gefangene der weißen Hölle. Wer nicht mehr singt, ist schon tot.
Das Eisen zischt, so rot glüht es. Ingmale wird mit den anderen vor die Hütte gestoßen. Jeder Tag, den sie nicht arbeiten, ist ein verlorener Tag. Der Mandingoknabe stellt sich an die Seite Ingmales. Sie haben keinen Blick für die anderen, nur für den Mann, der das Brandeisen zum Zischen bringt.
Der Mann ist schwarz. Schwarz wie sie und ein Koromantee. Einer der stolzesten Krieger Afrikas. Ingmale hätte es als Ehre empfunden, in seinem Heimatland gegen ihn kämpfen zu dürfen. Aber er darf nicht kämpfen. Er muß niederknien im hellen Staub, die Hände auf den Rücken gefesselt. Man reißt ihm grob die Hemdbrust auf. Der Koromantee hantiert mit dem Eisen elegant wie ein spanischer Degenfechter. Ein Flämmchen tanzt auf dem Stempel, leckt genüßlich den geschwungenen Buchstaben. Der Koromantee schaut Ingmale ins Gesicht. Er erkennt das Zeichen des Löwen, er lächelt nicht böse, aber verächtlich. Er spuckt auf das Eisen, bevor er es auf Ingmales Brust drückt. Der Geruch von verbranntem Fleisch ist alles, was Ingmale wahrnimmt. Es ist sein eigenes Fleisch, das verbrennt, und in diesem Moment entschließt sich der Sohn des Umgume, lieber zu sterben als so weiterzuleben.
Der Mandingojunge fühlt seinen Schmerz, er öffnet seinen Mund, so als wolle er den Schrei ausstoßen, der sich nicht von Ingmales Lippen löst. Dann erkennt er, welchen Entschluß der Sohn des Umgume gefaßt hat, und schweigt.
Es gibt viele Möglichkeiten, auf einer Plantage zu sterben. Man kann sich mit einer der vielen Krankheiten infizieren, der Ruhr, der Tuberkulose, der Dschungelpest, dem Gelben Fieber. Oder man schließt sich den Dreckfressern an, die heimlich Lehm und Erde essen und Eisenmasken tragen müssen, wenn man sie dabei erwischt. Man kann auch Hand an sich legen, wenn man es nur gründlich und entschlossen genug tut. Geht man zaghaft zu Werke, und gelingt es nicht gleich, ist die Strafe grauenhaft. Fünfzig Peitschenhiebe sind nichts dagegen.
Ein Sklave, der sich selbst vom Leben zum Tode befördern will und dabei versagt, wird beim Ohr gepackt und damit an einen Baum genagelt. Dort steht er eine halbe Stunde, bevor man ihn losschneidet, unter Verlust des Ohres. Eine weitere halbe Stunde ist nötig, um auch das andere Ohr auf diese Weise zu entfernen.
Ingmale wählt einen anderen Weg. Er schläft nicht, er ißt nicht, er schweigt, und er arbeitet. Die Arbeit ist mörderisch genug. Er empfängt stumm die Schläge des erbosten Aufsehers, die ihn nur näher an sein ersehntes Grab heranführen. Der kleine Mandingo bewundert seinen Mut. Es ist der Mut des afrikanischen Löwen. Nach einem Monat ist Sklave 66 tot. Die anderen begraben ihn als Helden. Sie haben verstanden. Sie wickeln Ingmales ausgezehrten Körper in rote Baumwolle und legen ihn ins Grab. Sie schaufeln Erde darauf und nehmen Abschied mit Gesängen.
Es ist die Nacht nach seinem Begräbnis, als eine Ibo-Frau zu ihm hinausschleicht. Mit bloßen Händen scharrt sie die Erde aus der Grube, arbeitet verbissen, bis sie die rote Baumwolle freigelegt hat, sie faltet das Tuch mit sanften Händen auseinander. Ingmale ist mit offenen Augen gestorben. Er blickt sie an. Sie tastet nach seinen kalten, harten Königsnarben. Dann greift sie ein Zuckerrohrmesser und trennt mit einem harten Schnitt seinen Kopf vom Rumpf.
Die Geister sollen seine Seele nicht holen. Sie schleudert das Haupt aus der Grube. Dumpf schlägt es auf, hüpft über den Boden, der Kiefer zerspringt, die Zähne brechen und geben den Saphir frei. Den schwarzen Saphir. Die Ibo-Frau nickt langsam. Sie weiß, wen sie zu Grabe getragen haben. Ingmale, den Sohn des Umgume. Der Tod ist sein Triumph, der Stein sein Vermächtnis, er wird viele Wiedergänger haben.
Der Saphir ist geheiligt und mit Blut getauft. Sie weiß, wem sie den Stein geben wird. Dem Mandingoknaben. Er trägt Afrika noch in seinem Herzen, und damit Hoffnung. Ingmale hat ihn erwählt. Er wird leben, ewig leben, solange er den Stein bei sich trägt. Sein ist die Rache. Sein Name ist Macandal. Viele werden ihm folgen. Schwarze Rebellen. Auf Jamaica, auf Haiti, auf Saint Lucia, auf Tobago, auf Grenada. Die Weißen werden allein schon ihre Namen fürchten.
Sie und die geheime Bruderschaft Ingmales, Sohn des Umgume, der den schwarzen Saphir bei sich trug und durch seinen Tod unsterblich wurde.