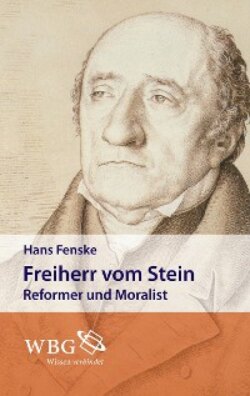Читать книгу Freiherr vom Stein - Hans Fenske - Страница 11
IV. Weitere Tätigkeit in den westlichen Besitzungen Preußens
ОглавлениеAuf den Plan einer Frankreich-Reise, die ja ein zeitweiliges Ausscheiden aus dem Dienst bedingt hätte, kam Stein nicht mehr zurück. In der Radikalisierung der Revolution sah er einen Hang zu überspannten Grundsätzen. Was sollte er da noch lernen? Mit der französischen Kriegserklärung an den habsburgischen Herrscher und designierten deutschen Kaiser Franz II. im April 1792, die faktisch Preußen mitbetraf, da die Hohenzollernmonarchie seit kurzem ein Defensivbündnis mit Österreich hatte, änderte sich die Situation vollkommen. Es war gewiss kein Zufall, dass Stein jetzt erklärte, er ziehe die deutsche Sprache der französischen, in der er bis dahin seine Korrespondenz überwiegend geführt hatte, vor, weil es dann weniger zu Missverständnissen komme und weil er gewohnt sei, über ernsthafte Dinge in seiner Muttersprache nachzudenken. Konsequent verwirklichte er diese Absicht jedoch nicht. Er hoffte auf einen baldigen Sieg über Frankreich, sah sich aber schnell getäuscht. Der Krieg, in den auch das Reich, die Niederlande, England, Spanien und einige italienische Staaten eintraten, brachte heftige Kämpfe von der Nordsee bis Italien, verlief sehr wechselhaft und dauerte bis 1797. Preußen allerdings zog sich schon im Frühjahr 1795 sehr zum Unwillen Steins aus dem Kampf zurück und vereinbarte im Frieden von Basel eine Neutralisierung Norddeutschlands.
Als die Franzosen im Herbst 1792 bis an den Rhein vorstießen und Mainz eroberten, taten Stein und sein Bruder Johann Friedrich sehr viel, um die deutschen Fürsten zum entschlossenen Widerstand zu ermutigen. Stein schloss sich für geraume Zeit dem preußischen Hauptquartier an. Dann ging er an den Niederrhein zurück. Im Februar 1793 wurde er zum Präsidenten der beiden Kammern für Cleve und Mark ernannt, als Wohnsitz erhielt er das ehemalige Herzogsschloss in Cleve angewiesen. Bei seiner Tätigkeit hatten kriegsbedingte Arbeiten jetzt einen großen Anteil. Als die Alliierten im Juni die Belagerung von Mainz begannen, kehrte er für eine Weile ins Hauptquartier zurück. Dann hielt er sich, unzufrieden mit dem seines Erachtens mangelnden Elan der Verbündeten und dem Gang der Dinge, in Nassau auf, begab sich aber Ende Juli wieder nach Mainz, um bei der Kapitulation der Stadt anwesend zu sein. Anschließend reiste er nach Hamm und nahm seine Dienstgeschäfte wieder auf. Diese Tätigkeit setzte er im Spätherbst in Cleve fort.
Sein Urteil über die Franzosen war jetzt sehr kritisch. Er sprach von ihrem unruhigen Bestreben, ihre verderblichen Grundsätze auszubreiten, von ihrer Anarchie und Sittenlosigkeit und nannte sie eine „scheußliche Nation“.14 In einer Denkschrift über den Zustand des Herzogtums Geldern, das seit 1713 zu Preußen gehörte, erinnerte er im November 1793 daran, dass Geldern, Cleve und Mark in der langen Geschichtsperiode von Kaiser Ferdinand I. an, also seit der Mitte des 16. Jh.s, in zahlreichen Kriegen „der Tummelplatz der Spanier, Holländer, Franzosen“ gewesen und verwüstet worden seien.15 Für jetzt sah er einen Krieg von mehreren Jahren voraus. Nach wie vor war er siegesgewiss. Zwar bezweifelte er – in einem Brief an Reden im Mai 1794 –, „ob man ganz Frankreich wird erobern und bändigen können“, aber er hielt es für denkbar, „daß man wird einen guten Teil davon wegnehmen und Paris, den Sitz aller Scheußlichkeiten, vernichten können“, und er gestand, dass er dies Schauspiel zu sehen wünschte.16
Es kam anders. Ein neuerlicher Vorstoß der Franzosen zwang Stein im Oktober 1794 zum Verlassen Cleves. Fortan amtierte er meist von Hamm aus, bis er im Juni 1796 auch das Präsidium der Kammer in Minden übertragen bekam und dort seinen Sitz nahm. Mit dem Frieden von Basel, in dem Preußen das Verlangen Frankreichs nach der Rheingrenze prinzipiell anerkannte, war er höchst unzufrieden. Er hielt ihn für einen perfiden Verrat an Deutschland, der überall im Reich Bitterkeit gegenüber Berlin errege. Zwar durfte Frankreich die linksrheinischen preußischen Gebiete nur militärisch besetzen, aber es zog sofort die Zivilverwaltung an sich und bediente sich uneingeschränkt auch der materiellen Ressourcen. Von dieser Missachtung des Friedensvertrags ließ es sich auch durch wiederholte preußische Proteste nicht abbringen. Im Herbst 1797 nahm es die Annexion faktisch vor. Wenig später gab auch Österreich in einem Geheimartikel des Friedens von Campo Formio das linke Rheinufer preis. In Berlin, wo am 16. November Friedrich Wilhelm III. auf den Thron gelangte, musste man sich nun eingestehen, dass Frankreich sich am Rhein behaupten werde. So erklärte die preußische Delegation auf dem Friedenskongress in Rastatt Mitte Februar 1798 den Verzicht Preußens auf seinen Besitz links des Flusses, bedang sich aber eine angemessene Entschädigung aus. An der Debatte über diese Entschädigungen nahm auch Stein mit drei Heinitz vorgelegten Denkschriften teil. Er forderte am 1. Februar einen umfassenden Gebietserwerb in Westfalen ohne Rücksicht auf die Wünsche anderer deutscher Staaten, um so eine Grenzprovinz, eine „Vormauer des nördlichen Deutschland“, zu schaffen.17 Auf Heinitz’ Rückfrage wiederholte er am 11. Februar, „daß es notwendig sei, die zerstückelten Kräfte Deutschlands in den Händen einer der militärischen Mächte zu konsolidieren, um seine Widerstandsmittel gegen die vorwiegende Übermacht Frankreichs zu vermehren und seine nationale Unabhängigkeit zu sichern.“ Dringend bat er Heinitz, diesen Gesichtspunkt dem Departement der Auswärtigen Angelegenheiten im Einzelnen auseinanderzusetzen.18 Zwei Tage später fasste er nach. Nachdem Frankreich infolge politischer und militärischer Fehler der Verbündeten das Übergewicht erlangt und sich durch einen Staatsbankrott von einer ungeheuren Schuldenlast befreit habe, sei es notwendig, „daß Deutschland sich in gleichem Maße verstärke und seine Widerstandskraft vermehre, damit es seine nationale Unabhängigkeit erhalten könne, was nur möglich ist durch die Vereinigung seiner Kräfte, die eine fehlerhafte Verfassung zerstückelt hat.“ Dann ging Stein über die beiden früheren Denkschriften hinaus. Hatte er bisher nur einer kräftigen Arrondierung Preußens im Norden das Wort geredet, so erklärte er jetzt: „Ich betrachte die Vergrößerung der beiden militärischen Mächte als ein für Deutschland notwendiges und wünschenswertes Ereignis und die Säkularisation als ein Mittel, das uns dieser vollständigen Vereinigung näherbringt.“19 Er setzte sich jetzt also für eine Hegemonie Preußens im Norden und Österreichs im Süden ein und nahm damit einen Gedanken vorweg, der in den deutschlandpolitischen Debatten des 19. Jh.s wiederholt vorgetragen wurde. Seine Argumentation fand in Berlin freilich keine Resonanz.
Einen großen Teil seiner dienstlichen Tätigkeit seit 1792 musste Stein den Problemen widmen, die aus der Konfrontation mit den Franzosen erwuchsen. Sehr gelegen war ihm an der Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten in seinem Amtsbezirk. So forcierte er den Wegebau und sorgte für die Beseitigung der Binnenzölle. Ebenso wandte er sich sozialen Fragen zu, der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten, der Fürsorge für Erwerbslose und dem Armenwesen. Intensiv beschäftigte er sich mit der Lage der Landbevölkerung, insbesondere in Minden. Hier hatten die sogenannten Eigenbehörigen ihrem Gutsherrn Dienste und Abgaben zu leisten. Unter den Abgaben waren die beim Sterbfall besonders ärgerlich und für die Entwicklung der Höfe hemmend. Über die Änderung dieser Verhältnisse wurde schon seit einiger Zeit gesprochen. Stein stellte sich ganz auf die Seite der Reformer. Die Belastung durch den Sterbfall, die Hälfte der mobilen Habe ohne Anrechnung der Schulden, erklärte er in einer großen Denkschrift vom 1. Juni 1797 für betriebs- und volkswirtschaftlich höchst nachteilig. Dadurch sei der Zustand der Eigenbehörigen ungewiss, und der Erwerbsfleiß werde erstickt. „Übereinstimmend mit der Erfahrung und der Meinung aller Schriftsteller“, so fasste er zusammen, „ist der Satz, daß der Zustand des Landsmannes, der ihm persönliche Freiheit und Eigentum sichert, am zuträglichsten ist für sein individuelles Glück und für die möglichste Beförderung seines Erwerbsfleißes.“20 Freilich plädierte er nicht für einen einfachen Wegfall der Abgaben, er wollte, dass die Gutsherren entschädigt würden; diese Leistung konnte in Form einer Rente erbracht werden. Bei einer gesetzlichen Regelung der Materie sollten auch die Stände befragt werden. Wie Stein, so wirkte auch Heinitz für die Bauernbefreiung.
In der preußischen Bürokratie gab es etliche reformwillige hohe Beamte, wie Stein und Heinitz es waren. In der Kommission, die Friedrich Wilhelm III. bald nach dem Antritt der Herrschaft zur Beratung über die notwendigen Veränderungen im Staat einsetzte, hatten diese vorwärtsdrängenden Kräfte jedoch keine Mehrheit. So kam die heilsame Revolution von oben nach unten, von der ein preußischer Minister, wohl Karl Gustav von Struensee, im Sommer 1799 gegenüber dem französischen Geschäftsträger sprach, nur langsam voran. Der wichtigste Schritt dabei betraf die etwa 50.000 spannfähigen Bauern auf den Staatsdomänen in den altpreußischen Provinzen (mit Ausnahme Schlesiens). Sie erlangten ab 1799 die persönliche Freiheit und das Eigentum an ihren Höfen. Auch wurden zwischen 1800 und 1802 gewisse Verwaltungsreformen in den Marken, in Pommern, Südpreußen, Altpreußen und in Westfalen vorgenommen.
In der Nacht zum 1. März 1799 überschritten französische Truppen den Rhein an zwei Stellen und eröffneten damit erneut den Krieg gegen Österreich – ohne Kriegserklärung, sie erfolgte erst am 12. März, als die Kämpfe schon in vollem Gange waren. Mit Österreich war Russland locker verbunden, dieses wiederum mit England, das seit Jahren ununterbrochen mit Frankreich im Kampf stand; seit Ende 1798 bestand ein englisch-russisches Bündnis. Der Koalition schlossen sich weitere Staaten an, nicht jedoch Preußen, das wegen der mannigfachen französischen Verletzungen des Friedens von Basel sehr wohl Grund zur Wendung nach Westen gehabt hätte. Stein war betrübt, „uns in einem Zustand der Starrsucht zu sehen, während man mit Nachdruck die Ruhe Europas auf den alten Grundlagen wiederherstellen konnte“, und meinte, dass „unser Staat“ aufhöre, „ein militärischer Staat zu sein“, wie er Ende April an die Hofdame Caroline von Berg, eine vertraute Korrespondenz-Partnerin, schrieb. Über die Erfolge des jungen Erzherzogs Karl „und seines braven Heeres, welche jetzt Deutschland von dieser Räuberhorde, der sogenannten Französischen Armee, gereinigt haben“, freute er sich sehr.21 Im Laufe der nächsten Monate wuchs seine Zuversicht. Im Oktober sah er die Rückgewinnung des linken Rheinufers in den nächsten fünf oder sechs Monaten als unfehlbar an. Dann aber wendete sich das Blatt, Frankreich, seit dem Staatsstreich am 9. November 1799 unter Führung Napoleons, ging wieder in die Offensive und konnte den Krieg bis Ende 1800 für sich entscheiden. Am 9. Februar 1801 schlossen Frankreich und Österreich, dieses zugleich für das Reich, in Luneville Frieden. Er erfüllte alle französischen Wünsche. Die Republik gewann die Rheinlinie nun auch völkerrechtlich. Nach Art. 7 waren die linksrheinischen Verluste der weltlichen Territorien vom Reich gemeinsam zu tragen. Über die Durchführung der Entschädigung sollten später Vereinbarungen zwischen den am Friedensvertrag beteiligten Mächten getroffen werden. Damit sicherte sich Frankreich ein Mitspracherecht dabei, wie das Reich die Kompensationsfrage regelte. Ein Staatsvertrag zwischen Preußen, das als Glied des Reiches von Luneville mitbetroffen war, und Frankreich setzte am 23. Mai 1802 fest, welche Entschädigung Preußen für seine Verluste auf dem linken Rheinufer erhalten sollte. Es bekam beachtliche Gebietszuweisungen, wenn auch nicht in dem Umfang, die Stein 1798 gewünscht hatte. Formell bedurfte dieser Vertrag noch der Zustimmung des Reiches, aber es war nach der nunmehrigen Machtstellung Frankreichs keine Frage, dass sie erteilt werden würde. So erfolgte die Inbesitznahme der verschiedenen geistlichen und kleinen weltlichen Territorien schon viele Monate vor dem Hauptdeputationsschluss vom 23. Februar 1803. Für die Integration dieser Gebiete bildete Friedrich Wilhelm III. eine besondere Kommission.
Im Juni 1802 erfuhr Stein, dass er bei der Eingliederung der westfälischen Erwerbungen – das waren vor allem das Bistum Paderborn und der kleinere Teil des Bistums Münster – beteiligt sein sollte, unter Beibehaltung seiner bisherigen Positionen. Sogleich begann er, sich mit den nun zu lösenden Fragen zu befassen. Seinen Dienstsitz wollte er am liebsten in Münster nehmen. Im Juli erbat er sich Urlaub bis zum Beginn der eigentlichen Organisationsarbeit und ging nach Nassau. Angesichts der Heimat meldete sich der Wunsch, „noch einige Jahre zu dienen, wenn ich gemeinnützig sein kann, dann meinen Abschied zu nehmen und für mich und die Meinigen zu leben.“22 Den Pfarrer in Frücht wies er an, für einen ordentlichen Besuch der Schule zu sorgen und notfalls Bußgelder zu kassieren. Über die Situation auf dem linken Rheinufer orientierte er sich sehr genau. Fast täglich gingen ihm von dort Nachrichten über die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu. Er entschloss sich, seine Besitzungen jenseits des Flusses zu verkaufen, da er für die Region unter französischer Herrschaft einen Verlust an Wohlstand erwartete. Den Erlös verwandte er für den Ankauf einer Herrschaft in Südpreußen, also in dem Teil Polens, der 1793 an Preußen gekommen war. Gemeinsam mit dem Freiherrn von Troschke, einem schlesischen Gutsbesitzer, erwarb er 1802 die an der Warthe gelegene Herrschaft Birnbaum im Kreis Meseritz. Bei seinen dienstlichen Obliegenheiten bedachte er die künftige Organisation Westfalens gründlich. Er mahnte, man solle „die alte Deutsche Verfassung, die auf Grundeigentum gebaut war und die sich in Westfalen erhalten“ habe, bewahren und nicht an ihre Stelle eine bloße Bürokratie mit ihrer bekannten Unvollkommenheit setzen. Die landständische Verfassung habe das Zutrauen der Bevölkerung und biete „ein Mittel, das Publikum immer in Verbindung mit der Landes-Administration“ zu halten. Zur Bekräftigung dessen verwies er auf die guten Erfahrungen mit der landständischen Verfassung in Cleve und Mark. Er warb auf jeden Fall für ein behutsames Vorgehen.23
Ende September 1802 traf Stein in Münster ein. Seine dortige fast genau zwei Jahre dauernde Tätigkeit nannte er in der Rückschau 1823 mild und schonend. Er ging mit der Behutsamkeit vor, die er von Nassau aus empfohlen hatte, zumal hinsichtlich der Lokalverwaltung. Eine allgemeine Säkularisation der Klöster wollte er nicht, wohl aber eine Beschränkung, um die damit frei werdenden Mittel dem Bildungswesen zuführen zu können. Im niederen Schulwesen wollte er der Kirche einen gewissen Einfluss belassen. Etwas stärker griff er bei den höheren Schulen ein, und mit der Reform der Universität befasste er sich eingehend. Die Aufhebung der Stände war bei seinem Amtsantritt schon erfolgt. So setzte er sich für die Schaffung einer Ersatz-Institution ein.
Im Dezember 1803 teilte der Verwaltungschef Steins aus Nassau mit, dass die Mediatisierung aller reichsritterlichen Besitzungen, also auch der Steinschen, zu befürchten sei. Stein wies ihn sofort an, die wichtigsten Dokumente nach Koblenz zu bringen, sich auf nichts einzulassen und zu protestieren. Als er Kenntnis von der bald erfolgten Mediatisierung erhielt, brauste er auf. Er erklärte sie gegenüber seinem Amtmann als rechtswidrig und kündigte an, er werde nie wieder nach Nassau kommen, sollte die Reichsritterschaft tatsächlich beseitigt werden. „Ich werde nie einen Räuber für meinen Landesherrn erkennen.“24 Am gleichen Tag, am 13. Januar 1804, richtete er einen scharfen Protest an den Fürsten von Nassau-Usingen. Er sprach von gesetzloser Übermacht und sagte, Deutschlands Unabhängigkeit werde durch die Auflösung der Reichsritterschaft wenig gewinnen. Viel sinnvoller sei es, die kleinen Staaten mit den beiden großen Monarchien, von denen die weitere Existenz Deutschlands abhänge, zu vereinen; „die Vorsehung gebe, daß ich dieses glückliche Ereignis erlebe.“ Dann warf er den deutschen Fürsten mit Ausnahme des Herzogs von Braunschweig vor, im Existenzkampf Deutschlands versagt zu haben. Auch in diesem Schreiben kündigte er an, er werde dem Aufenthalt in Nassau fortan entsagen.25 Der nassauische Minister Marschall zu Bieberstein stellte dazu in einem Memorandum fest, Stein habe die persönliche Achtung gegen seinen Landesherrn beiseite gesetzt und sich nicht entblödet, die deutschen Fürsten auf eine ins Lächerliche fallende Art anzugreifen. Das Schreiben sei deshalb nicht zu beantworten.