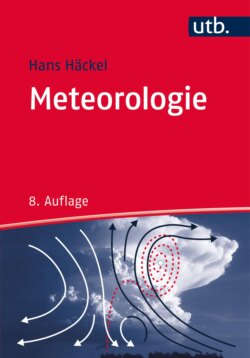Читать книгу Meteorologie - Hans Häckel - Страница 18
Kohlendioxid (CO2)
ОглавлениеDas atmosphärische Kohlendioxid ist die Quelle, aus der die grünen Pflanzen den für den Aufbau ihrer Körpersubstanz benötigten Kohlenstoff beziehen. Da alle tierischen Lebewesen einschließlich der Menschen letzten Endes von den Pflanzen leben, ist dieses Spurengas als Grundstoff jeglichen organischen Materials auf der Erde zu sehen.
Der Assimiliations- oder Fotosyntheseprozess, der diesen Stoffaufbau ermöglicht, benötigt Sonnenstrahlung als Energiequelle und kann deshalb nur tagsüber ablaufen. Gleichzeitig setzen die Pflanzen jedoch – genauso wie auch die tierischen Lebewesen – ständig durch Veratmung Kohlendioxid frei. Man nennt diesen Vorgang Respiration. Einzelheiten dazu findet man z. B. bei Larcher (2001). Betrachten wir beide Vorgänge zusammen, so ergibt sich das folgende Gesamtbild: Am Tag entnehmen die Pflanzen durch Assimilation aus der Luft mehr Kohlendioxid, als sie durch Respiration zurückgeben. In der Nacht, wenn keine Assimilation stattfindet, wird die Luft wieder mit Kohlendoxid angereichert. Als Folge davon findet man insbesondere in ländlichen Gegenden in Bodennähe einen ausgeprägten Tagesgang (Tagesgang ist der meteorologische Fachausdruck für Tagesverlauf) der CO2-Konzentration mit einem Maximum in der Nacht und einem Minimum am Tag. Besonders groß ist die Tag-Nacht-Schwankung während der Hauptvegetationszeit von Mai bis September (Abb. 2).
Abb. 2 Tagesgang der Kohlendioxid-Konzentrationen in einer ländlichen Gegend (nach Oke, 1992).
Der Jahresgang der CO2-Konzentration erklärt sich aus der jahreszeitlich wechselnden, also der außertropischen Vegetation der jeweiligen Erdhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel zeigt er ein Maximum in den Monaten März bis April nach der Winterruhe und ein Minimum zum Ende der Vegetationszeit im Oktober oder November. Während der Wachstumsperiode wird der Atmosphäre kontinuierlich CO2 entzogen und ab Herbst durch Veratmung wieder zugeführt. Mit Beginn der Heizperiode kommt es darüber hinaus zu einer verstärkten anthropogenen Kohlendioxidfreisetzung. Auf der Südhalbkugel fällt das Maximum aus analogen Gründen in die Monate Oktober oder November und das Minimum in den April oder Mai. Da die Nordhalbkugel sehr viel mehr vegetationsbedeckte Festlandsfläche besitzt als die Südhalbkugel ist leicht einzusehen, dass die Amplitude der Jahresschwankung auf der nördlichen Hemisphäre deutlich größer ausfällt als auf der südlichen. Abb. 3 zeigt den Jahresgang der CO2-Konzentration in den verschiedenen geografischen Breiten der Erde in stark schematisierter Form. 25
Abb. 3 Jahresgang der CO2-Konzentration (stark schematisiert).
Würde man das täglich (1990) weltweit freigesetzte Kohlendioxid zu Trockeneis verarbeiten und in Güterwagen verladen, würde man dazu einen Zug mit einer Länge von 2 500 km benötigen. Das entspricht der Strecke Paris – Moskau (Kerner, 1990). Die Natur hat zum Aufbau derjenigen Menge fossiler Brennstoffe, die die Menschheit in einem einzigen Jahr verfeuert, etwa 2 Mio. Jahre gebraucht (Schneider, 1990).
Wie inzwischen allgemein bekannt ist, werden von Jahr zu Jahr mehr Kohle, Erdöl und Erdgas verbrannt, was zu einer ständig wachsenden CO2-Belastung der Atmosphäre führt. Heute werden auf diese Weise jährlich über 30 Gt (1 Gt = 109 t) produziert. Das bedeutet, dass täglich um die 60 Mio. Tonnen in die Atmosphäre abgelassen werden.
Beiträge der verschiedenen Quellen zum anthropogen verursachten CO2-Ausstoß in Deutschland (in %):
| Haushalte: | 14,9 |
| Industrieprozesse: | 2,7 |
| Flugverkehr: | 3,5 |
| Straßenverkehr: | 17,9 |
| übriger Verkehr: | 1,4 |
| Kleinverbraucher: | 6,9 |
| Industriefeuerungen: | 16,3 |
| Kraft-, Heizwerke: | 36,4 |
(nach versch. Quellen)
Seit dem Beginn der Industrialisierung Mitte des 18. Jahrhunderts ist der Kohlendioxidgehalt der Luft von damals 280 ppm mit kontinuierlicher Beschleunigung auf den heutigen Wert von etwa 400 ppm gestiegen (371 ppm betrug die Konzentration im Jahr 2001). Während sich die Steigerungsrate anfänglich um 0,2 ppm pro Jahr bewegte, liegt sie heute bereits bei über 1,6 ppm pro Jahr; diese Zunahme ist auch in Abb. 3 in stark schematisierter Form angedeutet. Dieses zusätzliche Kohlendioxid stammt aber nicht nur aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Gewaltige Mengen werden auch bei der Rodung von Wäldern und der Zerstörung des Bodens freigesetzt.
Damit erfährt der ohnehin schon komplizierte globale Kohlenstoffkreislauf noch eine anthropogen bedingte Erweiterung. Er ist in Abb. 4 in vereinfachter Form dargestellt. Die in den einzelnen Speichern (Atmosphäre, Ozeane, Festländer und Erdkruste) enthaltenen Mengen sind in Klammern gesetzt und in 109 t Kohlenstoff angegeben. Die Pfeile beschreiben die Kohlenstofftransporte. Die durchgezogenen stellen natürliche Ströme dar, die gestrichelten bezeichnen die auf menschliche Aktivitäten zurückgehenden. Ihre Einheit ist 109 t Kohlenstoff pro Jahr. Die ergiebigste anthropogene Quelle stellt, wie man sieht, das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas – kurz gesagt fossiler Brennstoffe – dar. Sie liefert jährlich 7 109 t Kohlenstoff. Die Waldrodungen schlagen mit 2 109 t Kohlenstoff zu Buche und bei der Zerstörung des Bodens werden 1 109 t Kohlenstoff freigesetzt. 26
Abb. 4 Globaler Kohlenstoffkreislauf (Zahlenangaben nach verschiedenen Quellen).
Eine wichtige Kohlendioxidsenke ist das Oberflächenwasser der Weltmeere. Es entzieht der Atmosphäre jedes Jahr 3 109 t anthropogen emittierten Kohlenstoff (vgl. Seite 20). Die Vegetation reagiert auf das gesteigerte Kohlendioxid-Angebot mit verstärktem Wachstum und bindet dadurch jährlich zusätzliche 2 109 t Kohlenstoff. Von den pro Jahr anthropogen freigesetzten 10 109 t werden also, wie man sieht, nur 5 109 t gebunden. Der Rest sammelt sich in ständig wachsender Konzentration in der Atmosphäre an.
Ozeane und Vegetation können nur die Hälfte des von der Menschheit künstlich freigesetzten Kohlendioxids abschöpfen. Der Rest reichert sich kontinuierlich in der Atmosphäre an. Seit Beginn der Industrialisierung hat seine Konzentration um fast 1/3 zugenommen. Sie steigt zurzeit exponentiell an.
Zu beängstigenden Konzentrationssteigerungen kommt es häufig in industriellen Ballungsgebieten, wo zeitweise Werte weit über 450 ppm gemessen werden. In einem extremen Fall hat man im Londoner Nebel sogar schon 3 000 ppm, also fast das 10fache der Normalmenge gefunden (Möller 1973; s. Seite 22).
Kohlendioxid ist Hauptverursacher des atmosphärischen Glashauseffektes – über 60 % davon geht auf sein Konto (vgl. Seite 210) – es zählt daher in besonderem Maße zu den klimarelevanten Substanzen.