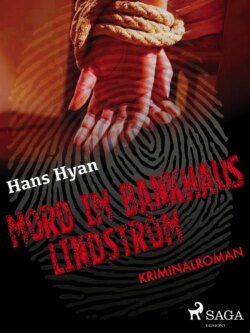Читать книгу Mord im Bankhaus Lindström - Hans Hyan - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDer alte Martin brachte den Tee in das Arbeitszimmer des Konsuls.
„Das gnädige Fräulein möchte Herrn Konsul sprechen, ehe der gnädige Herr ins Büro geht.“
Die hohe, breitschultrige Figur des Konsuls reckte sich, er sah den Diener forschend an.
„Was sagte denn meine Tochter, weshalb sie ...?“
„Das gnädige Fräulein meinte nur, sie müßte Herrn Konsul auf jeden Fall vorher sprechen.“
Indem kamen leichte Schritte durch das Nebenzimmer, und zwischen den dunklen Samtportieren erschien die blonde Marion, des Konsuls einzige Tochter.
Sie blieb einen Augenblick stehen und sah mit ihren schönen Augen aufmerksam zu ihrem Vater hin. Da spürte er, daß sie ihm wirklich Wichtiges mitzuteilen hatte.
Der alte Martin war geräuschlos gegangen; der Konsul breitete seine Arme aus ...
Dieses Mädchen da war der Mittelpunkt seines Daseins. Er selbst, schon in den Fünfzigern, hatte das Leben genossen; er war reich, besaß Macht und Einfluß, er hätte nicht gewußt, was er sich noch wünschen sollte. Aber diese Tochter, seine Marion, mit ihren einundzwanzig Jahren, war für ihn Einsatz und Gewinn seines Lebens zugleich. Er liebte sie, nicht nur wie Väter ja meistens ihre Töchter lieben — sie war ihm Weib und Kind zugleich. Den Gedanken, sie zu verlieren, dachte er überhaupt nicht aus.
Sie war verlobt mit einem Künstler, einem berühmten und wertvollen Menschen, und sie hing gewiß mit Liebe und Leidenschaft an dem erwählten Mann. Aber ihre Verbundenheit mit dem Vater konnte durch nichts übertroffen werden.
Das alles fühlte Rudolf Lindström mit jedem Nerv, und davon war seine Seele erfüllt, als Marion zu ihm trat, ihre Arme um seinen Hals legte, wie sie es schon als ganz kleines Mädchen getan hatte, und sich von ihm auf die Wange küssen ließ.
„Ja, ich muß dich sprechen, Papa“, sie zauderte sekundenlang; dann ging ein Ruck durch ihren schlanken Körper:
„Ich kann mich nicht verloben ... ich kann einfach nicht, Papa.“
Ein Lächeln irrte um seinen bärtigen Mund, als er fragte:
„Seit wann hat meine Marion solche Launen?“
Sie schüttelte ihr blondes Haupt:
„Das sind keine Launen ... das ist ...“, sie fand das Wort nicht, „das ist ...“ Sie hob die Schultern: „Das ist wahrscheinlich ... mein Schicksal ...“
Jetzt war das Kopfschütteln an ihm:
„Wie alt bist du, Marion?“
„Einundzwanzig, Papa.“
„Ich weiß es ja, aber ich frage doch ... Ihr jungen Menschen von heute lebt von lauter Entschlüssen; für euch gibt es immer nur ein Entweder-Oder. Jede Schwierigkeit heißt bei euch ‚unmöglich‘. So ist doch das Leben nicht! ... Wenn du mir gesagt hättest: du kannst dich heute nicht verloben, das würde ich begreifen. Wenn jemand noch nicht das volle Gefühl der Zusammengehörigkeit mit einem anderen Menschen hat ...“
Aber Marion verneinte:
„Das ist es ja nicht, das ist es ja nicht, Papa! Mein Gefühl für Stefan bleibt sich immer gleich. Ich liebe ihn so, wie eine Frau einen Mann lieben muß, wenn sie ihm angehören soll. Ich habe Verlangen nach seiner Nähe und nach seiner Person, und ich weiß ganz genau, daß ich glücklich sein werde, wenn ich ihn heirate ...“
Die schönen blauen Augen blickten unbeirrt auf ihren Vater:
„Nein, das ist es wirklich nicht, es ist etwas ...“
Mit einem tiefen Atemzug, als nähme sie einen Anlauf, um ein unüberwindliches Hindernis zu nehmen:
„Es ist etwas in meinem Leben, das ich ihm nicht sagen kann ... nein, auch dir nicht, Papa ... worüber ich nicht sprechen kann, wenigstens nicht, ehe ich mir nicht ganz klar geworden bin ... über den eigentlichen Vorgang ...“
„Aber Marion, das ist doch das reine Rätselraten!“ Er versuchte absichtlich, einen leichten, scherzenden Ton beizubehalten. „Du sagst, es ist etwas geschehen; aber was geschehen ist, das sagst du nicht; gleich darauf: du weißt selbst nicht, ob etwas passiert ist, was dich hindert, dich mit Stefan zu verloben. Wer soll sich denn da herausfinden!“
Marions Gesicht wurde ernster und trüber:
“Ich weiß es nicht, Papa, ich bin mir ja selbst nicht klar darüber, was ich tun muß, um von dieser furchtbaren Last frei zu werden. Du weißt, ich habe ein heiteres Naturell, mir liegt nichts ferner als Kopfhängen und Grübeln; ich will gar nicht unglücklich sein! Leben will ich! Gesund sein und lachen! ... Aber das weißt du doch auch, Papa, man kann nicht immer, wie man will. Vielleicht ... kann ich nur in der Entfernung von dir das tun, was ich muß.“
Sie wandte sich ab und ging an das Fenster; dort zog sie die üppigen Stores beiseite und blickte hinaus in die neblige Morgenfrühe der Allee, in der die Villa Lindström zwischen anderen Landhäusern reicher Leute inmitten eines großen Gartenlandes lag.
Der Konsul hatte sich in dem Ledersessel zurückgelehnt und sagte zärtlich und eindringlich, wie manchmal in früheren Jahren, wenn Marions Widerspruchsgeist sich regte:
„Du weißt, Liebling, ich kann dir ernstlich nichts abschlagen. Aber weil du meine Schwäche dir gegenüber kennst, hast du auch die Pflicht, mich nicht vor Entscheidungen zu stellen, bei denen ich dir einfach nicht nachgeben kann. Das mußt du doch einsehen, daß du heute, am Morgen deines Verlobungstages, wo alles vorbereitet ist, wo wir hundert Gäste erwarten, nicht plötzlich sagen kannst: ‚Ich verlobe mich nicht!‘ “
Marion war zu ihm getreten, hatte den Arm um seinen schon etwas ergrauten Kopf gelegt und setzte sich nun, wie sie es als Kind oft getan hatte, auf des Vaters Knie:
„Du hast ja recht, aber ...“ Sie schwieg.
„Aber ...?“ fragte er.
Sie blickte ihn zweifelnd und unsicher an, endlich sagte sie:
„Ich verspreche dir, nichts zu überstürzen ... Ja, ich werde mich verloben, heute abend ... nicht, weil ich diese Verlobung wünsche, aber ... das sehe ich ein, und darin gebe ich dir recht, ich hätte Stefan meinen Entschluß schon früher mitteilen sollen ... das war ein doppeltes Unrecht ... Ich habe ihm verheimlicht, was er wissen muß, und ich habe ihm nicht einmal gesagt, daß ich nicht die Seine werden kann, wenn dieses Unglück ...“
Sie drückte ihre schmalen Hände an die Augen, als wollte sie aufschluchzen, aber sie weinte nicht. Im Gegenteil, ihre Stimme und ihre Muskeln wurden fester und straffer. Sie beugte den Kopf:
„Ich muß dahinterkommen, Papa, und du kannst dich auf mich verlassen, daß ich das, was mir heute, jetzt so unfaßbar ... so unergründlich erscheint, daß ich das herausbekomme und daß ich mich von allem freimache.“
Sie drückte seinen Kopf fest und leidenschaftlich an ihre Wange, und da er weiter fragen wollte, wehrte sie ab:
„Nein, nein, ich kann dir jetzt nichts sagen, heute nicht und morgen auch nicht ... Du darfst mich auch nicht fragen.“
Der Fernlautsprecher schnarrte. Dann kamen aus dem Apparat die Worte:
„Herr Generaldirektor wollen doch bitte sofort in die Bank kommen, es ist eingebrochen worden!“
Überrascht fragte der Konsul:
„Bei uns ... in der Bank ...?“
Er hatte den Lautsprecher abgestellt und den Hörer ans Ohr genommen:
„Matschunke, Sie sind es ... nun sagen Sie doch ...! Nein, ich komme sofort herunter ... den Doppelschlüssel zum Tresor, ja, den bring’ ich mit ...!“
Er legte den Hörer fort, wandte sich zu der gespannt aufhorchenden Tochter:
„Was sagst du dazu, Marion ...! Ja, ich ruf’ dich gleich an, von der Bank aus ...“ Der Konsul war jetzt schon ganz in seiner Bank und mit dem Einbruch beschäftigt. „Und im übrigen, Marion, ich komme früh nach Hause heute, da können wir ja alles noch einmal in Ruhe durchsprechen ... und du bist meine vernünftige Tochter ... nicht wahr, du siehst, in diesem Augenblick ... da weiß ich wirklich nicht, wo mir der Kopf steht ...“
Der alte Martin war hereingekommen, hatte seinem Herrn Mantel und Hut gebracht, und der Konsul war aus dem Zimmer, ehe Marion noch viel fragen konnte. Sie war auch so beschäftigt mit ihren eigenen Gedanken, daß ihr dieser Einbruch, der sie sonst gewiß interessiert hätte, im Augenblick recht bedeutungslos erschien.
Es gab ja eine Versicherung und auch die Polizei. Marion war es von ihrem Vater gewöhnt, daß er jede Sache schnell und praktisch erledigte.
Nachdenklich ging sie wieder hinüber in ihr Zimmer.