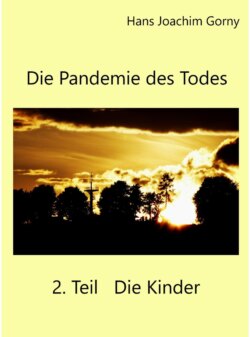Читать книгу Die Pandemie des Todes 2.Teil Die Kinder - Hans Joachim Gorny - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Schlange Pferde
ОглавлениеIn einer Welt in der die Menschen nur noch spärlich vertreten sind und eine unbedeutende Rolle spielen, sorgt jeder Unbekannte bei seinem Erscheinen für viel Aufregung. Nach der weltweiten Pandemie ist so ziemlich alles was selbstverständlich und alltäglich war und alles was die Menschheit unterhalten hat, verschwunden. Radio- und Fernsehsender zum Beispiel. Oder Tageszeitungen und Illustrierte. Auch Sportveranstaltungen und Politiker. Sowie Promis und Königshäuser. Nicht vorzustellen, dass die Adligen aussterben konnten. Oder sitzen sie tatsächlich auf den Seychellen, wie Elfriede vermutet? Zukünftigen Kindern kann man das nur noch als Märchen erzählen und anhand von Fotos aus Büchern erklären. Auch was Theater, Musical und Zirkus waren. Und die Kinder werden es nicht glauben, dass die Menschen unsinnig viel Zeit vor Bildschirmen verbrachten und alle benötigten Informationen aus dem Internet ziehen konnten. Und, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene nächtelang an den PCs saßen und über das Internet miteinander spielten. Für zukünftige Kinder muss sich das noch abstruser anhören, als Geschichten aus dem alten Ägypten oder Rom.
Den heutigen Menschen stehen Berge von Filmen und Büchern zur Verfügung. Wobei die Bücher länger halten werden als die DVDs. Was aber, wenn spätere Mediziner ihre Erkenntnisse zu Papier bringen wollen? Oder jemand einen neuen Roman schreiben will? Noch gibt es Laptops, Drucker und Papier. Wie lange werden die Geräte halten, wie lange wird es noch Papier geben? Eines Tages ist das letzte Gerät verschlissen, der letzte Toner vertrocknet und das letzte Blatt beschrieben. Danach zählt Erfindungsreichtum. Weil die Leute auf den Höfen immer an ihre Versorgung denken müssen, reichen ihnen zur Unterhaltung bislang Filme, Bücher und Partys.
Doch das ändert sich.
Katy hat sich einen Hund zugelegt. Es ist der lauteste Kläffer den der Erdball je erlebt hat und heißt Strom. „Der Steht immer unter Strom“, sagte Otmar, als er fragte, ob jemand den missratenen Köter haben will. Solange sich Katy mit ihm beschäftigt, bleibt der Hund friedlich und ruhig. Sobald ein Fuchs, Mensch oder auch nur ein Vogel seine Aura stört, flippt er aus. Deshalb ist er als Wachhund nicht geeignet, nachts wäre nie Ruhe.
Dieser Hund Strom kläfft eines Abends wie ein Gestörter vor dem Haus herum. Zu spät hören sie die Motorengeräusche. Einige Bewohner stürmen zum Gewehrschrank, einige an die Fenster. Vor der Haustür parkt ein riesiger roter Möbellaster. Auf der Seitenwand steht in gelber verschnörkelter Schrift:
Zirkus Zarazani
Dahinter parkt ein Wohnmobil. Aus dem Führerhaus des Lasters springt ein dünner, langer Mann. Gekleidet in sehr individuelle bunte Klamotten. Ein Afrikaner. Schwarz wie Kohle.
Tom geht hinaus. „Guten Abend. Was für eine Überraschung.“
„Bin ich hier in einer Kaserne gelandet?“ fragt der Schwarze lächelnd und zeigt in Richtung der Militärfahrzeuge.
Mit verkniffenem Gesicht meint Tom: „Das sind die Überbleibsel eines Besuches.“
„Ich bin Richard der Zirkusdirektor. Dort ist meine Assistentin Simone.“
Er zeigt zum Wohnmobil. Eine weizenblonde Frau, gewandet mit einem wehenden feenartigen Kostüm, steigt aus.
„Das hört sich interessant an“, ist Tom begeistert. „Wir sind gerade beim Abendessen. Wollt ihr euch zu uns setzen?“
„Das hört sich gut an“, freut sich der Zirkusdirektor. „Sehr gerne.“
Er winkt seine Partnerin herbei, die ebenso freundlich die Gruppe begrüßt. Hinter den Vorhängen verschwinden die Gewehre und werden wieder in den Schrank gestellt. Mette funkt Zora, Freddy und Elfriede herbei, die sonst nur noch zum warmen Mittagessen erscheinen.
„Nehmt Platz“, sagt Tom. „Wo kommt ihr gerade her?“
Der schwarze Richard, er spricht den Namen deutsch aus, und Simone, setzten sich auf die ihnen angebotenen Stühle.
„Wir kommen gerade aus Freiburg“, erzählt Richard. „Dort haben wir drei Vorstellungen gegeben. Die Leute gaben uns den Tipp, dass hier irgendwo auf einem Bauernhof Leute leben.“
„Waren die Freiburger friedlich?“ fragt Max.
Simone antwortet mit der österreichisch gefärbten hellen Stimme eines Kindes. „Wenn wir kommen, sind alle friedlich. Denn sie wollen unterhalten werden.“
„Und womit lasst ihr euch bezahlen?“ interessiert Marion.
Richard grinst. „Mit Ersatzteilen, Naturalien. Leckerem Essen. Alles andere macht ja keinen Sinn.“
„Ich hätte da eine Technische Frage“, kommt es von Tom. „Welches Diesel benutzt ihr? Unseres ist inzwischen unbrauchbar. Das alte Zeug verbrennen nur noch alte Militärfahrzeuge.“
„Wir fahren mit Benzin. Der Laster und der Caravan. Wir sind immer auf der Suche nach Benzin mit einer möglichst hohen Oktanzahl. Das hält scheinbar ewig.“
Während der Ausfragerei werden ihnen Brettchen, Besteck, Brot, Wurst und Käse zugeschoben.
„Seid ihr schon lange zusammen?“
Freimütig erzählt Simone: „Wir haben uns vor zwei Jahren in Österreich getroffen. Richard gab in Klagenfurt den Überlebenden eine Vorstellung. Damals reiste er noch mit einem VW-Bus. Ich habe ihm gezeigt was ich kann. Danach haben wir uns zusammen getan. Als Künstlerin alleine unterwegs ist einfach zu gefährlich.“
Abwechselnd erzählen Richard und Simone von ihrer zweijährigen Tournee. In die osteuropäischen Weiten hätten sie sich nicht getraut. Gerne wären sie nach Skandinavien und Großbritannien übergesetzt. Sie fanden aber kein einziges Schiff und die Brücke nach Schweden hat einen Knacks. Aber sonst hätten sie in jedem europäischen Land gespielt, behaupten sie. Immer auf der Suche nach Menschengruppen. Selbst in den ehemaligen Millionenstädten sei es schwierig, größer Menschengruppen zu finden. Es gäbe ziemlich viele Einsiedler oder allein siedelnde Pärchen. Auch gleichgeschlechtliche. Die Einsiedler wären meist uninteressiert oder sogar unzugänglich. Nicht wenige würden einen stupiden und gestörten Eindruck machen und aggressiv werden, wenn man sie anspräche. Die wollen unbehelligt auf den Tod warten.
Die Fahrerei würde immer schwieriger, weil die Straßen zuwuchsen. Meistens müsse man Schritt fahren, weil die Schlingpflanzen die Fahrbahnen überwuchern und bei schneller Fahrt sich um die Achsen wickeln. Hecken lassen oft nur noch einen Pfad offen, den die großen Säugetiere benutzen. Säugetiere, auch exotische, gäbe es überall und in jeder Größe.
„Noch vor ein paar Jahren wog die globale Menschenmasse zehnmal mehr, als die Masse der wildlebenden Säugetiere“, behauptet Richard. „Nun hat sich der Planet doch beträchtlich zu Gunsten der Wildtiere verändert.“
Zora, Freddy und Elfriede kommen herein.
„Zirkus?“ fragt Elfriede. „Gibt’s das noch?“
Als er Zora wahrnimmt, steht Richard auf. „Ja, das gibt’s noch“, sagt er zu Elfriede, schaut aber Zora an. „Morgen Nachmittag geben wir euch eine Vorstellung. Sagen wir vierzehn Uhr. Wir müssen allerdings irgendwo unsere Bühne aufbauen.“
„Nehmt euch den Platz den ihr braucht“, bietet Tom an. Er ärgert sich, weil Zora, egal wo sie auftaucht, sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.
„Wollt ihr etwas Wein zum Abendbrot?“ fragt Elfriede die Gäste. Sie nicken.
Schon ist die ehemalige Küchenfee im Keller. Das Mädchen weiß natürlich, dass die Erwachsenen unter Alkoholeinfluss gerne erzählen. Und sie will Abenteuer hören. Zurück, stellt sie einen Roten auf den Tisch.
„Elfriede. Wo eigentlich, hängt jetzt unser Speck?“, fragt Stella.
„Der ist leider alle. Habt ihr auf eurer Reise irgendwo Schweine gesehen?“ fragt Fried den Zirkusmann.
Richard schaut zu seiner Partnerin. „Bei Worms, glaube ich, hat jemand ein Schweinestall. Sind bei euch auch so viele tote Wildschweine herumgelegen?“
Die Zirkusleute lassen es sich gutgehen. Dafür unterhalten sie ihre Gastgeber bis tief in die Nacht mit ihren Erlebnissen.
Als am nächsten Tag Elfriede kurz nach zwölf vom Unterricht kommt, beenden die Künstler gerade ihr Frühstück und beginnen mit dem Aufbau. Morgens noch, sah es nach Regen aus. Nun schwebt eine dünne Wolkendecke vor der Sonne. Ein Zirkuszelt wird keins errichtet. Der Möbellaster bietet alles was der Zwergzirkus benötigt. Richard fährt ihn hinter das Haus auf eine ebene Stelle. Senkt die rückwärtige Hebebühne etwas ab, öffnet die Hecktüren weit. Auf ihren Innenflächen befinden sich zwei Gemälde. Links, ein Clown mit buntem Hütchen, riesigen Ohren und roter Knollennase. Rechts, die Silhouette eines Feuerspuckers. Um die Plattform herum drapiert Simone ein blaues Tuch mit gelben Sternen, macht so aus der Hebebühne eine Art Theaterbühne. Richard lehnt noch eine Holztreppe dagegen. Etwa zwei Meter im Laderaum, hängt ein mit bunten Kreisen bemalter Vorhang. Fertig ist die Arena. Tom und die Männer tragen Dielen und Kisten herbei und basteln Zuschauerränge.
Schon um halb zwei sind die provisorischen Bänke besetzt. Hasans Gruppe ist mit Kind und Kegel vertreten. Niemand ist krank zuhause, neugierig erwarten sogar die drei Säuglinge die Vorstellung. Zora sitzt auf der hintersten Bank. Sie befürchtet, weil sie das in ihrer Jugend schon mehrmals erlebt hat, in die Vorstellung miteinbezogen zu werden.
Zirkusmusik erschallt. Der Vorhang geht auf. Richard begrüßt im Clownskostüm sein Publikum, stellt seine Assistentin Simone vor, die ein Ballettkleidchen trägt. Sie ist eine winzige Person und reicht ihm gerade bis zur Brust. Richard holt aus seinen weiten Taschen Bälle und beginnt zu jonglieren. Erst mit drei, dann mir vier. Fünf Bälle jonglierend geht er die Treppe hinunter. Jongliert mehrere Figuren, schleicht dabei an den Zuschauern vorbei, lässt manchmal einen Ball scheinbar auf einen Kopf herabplumpsen. Fängt ihn aber im letzten Moment auf. Hinter dem Vorhang kommt Simone hervor, tritt auf die Bühne, spielt mit einem Diavolo, lässt ihn kreisen und springen, die Zuschauerköpfe drehen sich mit. Unbemerkt wechselt Richard sein Handwerkszeug, jongliert jetzt mit Keulen. Danach verschwindet er hinter dem bunten Vorhang, zieht dabei einen Schwarzen davor. Drinnen ist nun alles finster. Die Musik wechselt zu einem dumpfen Grummeln. Mit vier Fackeln kommt er wieder heraus, Simone zündet sie an. Er jongliert, lässt eine nach deren anderen auf seiner Schuhspitze stehen und kickt sie wieder hoch. Drei schiebt er nacheinander in seinen Mund und verschluckt die Flammen. Genüsslich reibt er sich über den Magen. Zur vierten trinkt er Flüssigkeit und prustet sie vor dem schwarzen Hintergrund über die Fackel, was einige beeindruckende Stichflammen verursacht. Rückwärts, sich für den stürmischen Beifall verneigend, geht er hinter den Vorhang. Anschließend gibt Simone bei orientalischer Musik die Schlangenfrau, vollführt auf der Bühne schlimme Verrenkungen.
Pause. Die Zirkusleute bauen zwei Ständer auf, spannen in Kopfhöhe ein Drahtseil. Doch nach der Pause kommt zuerst Richard im schwarzen Frack und mit Zylinder auf die Bühne. Lässt Bälle, Tücher und eine Plastikrose verschwinden und wieder auftauchen. Geht hinunter und zeigt den Kindern Kartentricks. Holt ihnen Bonbons aus den Ohren und aus Marions Ausschnitt die Rose. Plötzlich steht Simone mit Schirmchen auf dem Seil, hüpft hin und her und ihr Ballettröckchen hüpft mit. In der Zwischenzeit baut unten Richard drei Hocker und einen kleinen Parcours auf. Unauffällig geht er zum Wohnmobil. Nach einem Spagat auf dem Seil klettert Simone herab. Die Musik wird lustig. Richard kommt mit drei kleinen weißen Pudeln zurück, die aufgeregt Simone begrüßen und abküssen. Wie Raubtiere sitzen sie auf den Hockern, springen über Hindernisse, durch Reifen, schlagen Salto. Die Zuschauer klatschen frenetisch. Drei Mal kommt das Pärchen hinter dem Vorhang hervor und verbeugt sich. Danach bleibt das Publikum sitzen und unterhält sich über die Vorstellung.
Am Tag darauf wiederholen sie die Vorstellung. Richard und Simone bleiben eine Woche. Schauen sich die Höfe, Landschaft und Tiere an, lassen keine Mahlzeit aus. Die beiden sind aber kein Paar, sie haben eine rein geschäftliche Beziehung, stellt sich heraus. Denn Richard übernachtet in Katys Wohnung und nutzt ihren Service. Simone nächtigt lieber in gewohnter Umgebung im Wohnmobil. Morgens und abends üben sie neue Tricks und Kunststücke. Abends deshalb, weil die Kinder um den Laster herumlungern. Das eine oder andere will wissen, wie Jonglieren und Feuerschlucken geht. Elfriede übt jeden Tag Diavolo. Für die Kinder spannt Simone in Kniehöhe ein Seil. Sie sollen sich davon überzeugen, dass Seiltanz nicht leicht ist. Die Künstlerin schafft es auf einem Stuhl sitzend, mit zwei Stuhlbeinen auf dem Seil, zu balancieren. In der Höhe traue sie sich noch nicht, verrät sie. Im Nachhinein ist das die Nummer die am meisten erstaunte. Die Künstler nutzen auch Zoras medizinische Fähigkeiten und lassen sich von ihr durchchecken, bevor sie den Hof verlassen. Als der Zirkus Zarazani zu den Religiösen weiterfährt, kann Elfriede schon mit vier Tennisbällen jonglieren.
Danach kennen die Kinder nur noch ein Spiel: Zirkus. Zuerst beknien sie die Erwachsenen, Taxidienste zu leisten, denn es stehen einige „Einkäufe“ an. Gemeinsam suchen sie Geschäfte, in denen es Zauberkästen, Jonglierbälle und Diavolos geben könnte. Dabei trauen sie sich sogar bis nach Lahr und Emmendingen. Begegnen aber niemandem. Wann immer es geht, treffen sich die Kinder um Nummern zu besprechen und zu üben. Die Erwachsenen freuen sich, weil alle so gut miteinander auskommen. Die Hunde freuen sich weniger. Die Freiheit gewohnten Tiere, halten von Dressur wenig oder gar nichts. Nach der ersten verbrannten Hand verbietet Hasan lautstark das Hantieren mit Feuer. Die Kinder haben Feuerschluckverbot. Trotzdem bekommen in der Folgezeit die Erwachsenen einige Vorstellungen geboten.
Der Zirkus hat auch die Erwachsenen kulturell auf trapp gebracht. Einige gründen eine Theatergruppe.
„Früher, nach dem Weltkrieg“, erinnert sich Otmar an Erzählungen seines Vaters, „gab es in jedem Dorf mindestens eine Theatergruppe. Die Leute liebten Freizeitvergnügen die sie nicht viel kosteten. Die Aufführungen fanden in den Sälen der Wirtshäuser statt oder unter freiem Himmel. Manche Dörfer hatten Freilichtbühnen. Bei Theater-Festen wurden an den Ortseingängen große Torbögen errichtet und mit Girlanden Reisig verkleidet. Die Häuser wurden mit Fahnen geschmückt, die Straßen mit gehäckseltem Gras bestreut. Bei den Festumzügen beteiligten sich Blaskapelle, Feuerwehr, Kindergarten, Schule und Vereine.“
„Dann bestanden die Zuschauer vermutlich aus den eigenen Pferden und Rindviechern“, spottet Marion.
Aber auch sie macht beim Theaterspielen mit. Um das Hirn fit zu halten. Als auch Elfriede mitmachen will, wird unter den Erwachsenen gemurrt. Das sommersprossige Energiebündel würde allen die Show stellen. Sie mache doch schon Zirkus, wird sie diplomatisch abgelehnt.
Zora hält sich von allem fern. Freddy auch. Oft hört sie in sich hinein, was der Nachwuchs macht. Er legt gerne sein Ohr auf ihren Bauch. Beide freuen sich auf das Kind. Das Ultraschallgerät aus dem Krankenhaus steht nun in ihrem Hospital. Es wäre ein Leichtes, das Geschlecht zu bestimmen. Sie wollen sich überraschen lassen. Hauptsache gesund. Und Hauptsache glücklich. Zora wie auch Freddy spüren, dass es mit ihnen und ihrer Welt weitergeht. Auf Dauer vermutlich Richtung Steinzeit. Vielleicht müssen ihre Enkelkinder in Fellen herumlaufen. Aber jede Generation hat findige Menschen hervorgebracht. Neue Erkenntnisse und Erfindungen sind vorprogrammiert. Beide vertrauen auf ihr Geschick, ihren Verstand und Fleiß. Rückschläge wird es bestimmt geben. Aus denen wollen sie lernen und die Erfahrungen an möglichst viele Kinder weitergeben. Zuversichtlich schauen sie nach vorne. Liebe macht alles schöner, farbiger und erträglicher.
Sport machen sie seit neustem zu viert. Katy will etwas für ihre Figur tun. Der magere Richard fand sie etwas schwabelieg. Sie joggen gemütlich an den Fischteichen vorbei. Zora und Katy nebeneinander voraus, Elfriede und Freddy hinterher.
„Hattest du mit dem was?“ flüstert Zora ungewohnt indiskret.
Katy schaut kurz hinter sich. „Warum denn nicht“, flüstert auch sie. „Es war im gegenseitigen Einvernehmen, wie man so schön sagt. Und hat Spaß gemacht.“
„War er nicht zu groß für dich“, und meint dabei den kleinen Richard.
Katy macht eine wegwerfende Handbewegung. „Ich habe auch schon mit anderen Schwarzen geschlafen. Der kleine Richard war eher niedlich. Der große eher bequem. Kaum zu glauben, dass einer vom Zirkus beim Sex so fantasielos sein kann.“
Zora kennt sich selber nicht mehr. Die Künstler interessieren sie mehr als andere Menschen. „Und die zwei gehen echt nie miteinander ins Bett?“
„Tja. Da hat er echt Pech mit seiner Partnerin. Er würde ihr ja gerne die Brüstchen streicheln, oder das Popöchen. Aber Simone hat null Bock auf Sex. Sie steht nicht einmal auf Frauen. Angeblich kann sie körperlich nicht. Lässt sich nicht einmal anfassen.“
Zora schüttelt sich. „Wenn da bloß kein Trauma dahintersteckt. Abends hat sie aber sehr munter draufloserzählt. Also ich würde behaupten, sie ist normal.“
Es wird steiler, Katy wird die Luft zu wenig. „Vielleicht waren sie anfangs ein Paar.“ Keuch. „Dann hat er das kleine Ding“, keuch, „vielleicht, zu hart rangenommen.“ Keuch. „Sie haben sich arrangiert“, keuch. „Zirkus ja, Sex nein“ Keuch. „Kann ich mir vorstellen.“
Es ist erstaunlich, wie leicht sich die vorlaute Elfriede unsichtbar machen kann, wenn es interessant wird. Zum Beispiel wenn Erwachsene über Sex reden. Da kann sie zwischen zwei Frauen sitzen, konzentriert zuhören und keine bemerkt sie. Elfriede redet in so einem Fall kein Wort mehr, stellt jede Bewegung ein, vermutlich auch die Atmung und die Ausdünstungen. Denn das Thema Sex ist für sie noch ein Buch mit sieben Siegeln, das sie aber unbedingt durchlesen will. Wegen der ein Jahr ältere Claudia hatte es, kurz bevor der Zirkus kam, Ärger gegeben. Das Mädchen war mit ihrem E-Bike zu Jan gefahren und hatte sich, leicht bekleidet, neben ihn ins Gras gesetzt. Sie wollte wissen wie es ist wenn man angefasst wird. Weil Claudia schöner und etwas schlanker als Emma ist, konnte Jan sich nicht bremsen. Bestastete sie von oben bis unten und Claudia hat es gefallen. Vermutlich dachte sie, mit Jan kann man es folgenlos riskieren. Er ist schweigsam, kann nicht auf drei zählen und andere junge Männer gab es gerade nicht. Schon bei ihrem zweiten Besuch wurde sie von Emma entdeckt. Claudia kann von Glück reden, dass sie mit dem Rad dort war und fliehen konnte. Jan redete auf seine unschuldige Art von einem Versehen, das Emma notgedrungen schlucken musste. Claudia hat nun eine Feindin.
So trappt Elfriede im Gleichschritt dicht hinter den zwei Frauen her und lauscht der Geschichte über die Zirkusleute. Freddy kann sich ein derbes Grinsen nicht verkneifen. Elfriede versteht: Es geht auch groß mit klein.
Der Parkplatz auf dem Heuberg ist noch frei von Wildnis. Otmar bewirtschaftet dort ein Rebstück und mäht gelegentlich. Freddy übt dort mit den drei Frauen Karate. Auch Katy will das lernen und Fried sowieso. Katy meint, wer so oft mit Männern zu tun hat wie sie, braucht manchmal überzeugende Argumente. Mit Inbrunst schlägt, stößt, kickt sie kraftvoll Löcher in die Luft. Sie ist allerdings etwas unbeweglich und daher lange nicht so geschickt wie die anderen zwei. Sport war bei ihr in letzter Zeit kein Thema gewesen. Aber Woche für Woche müht sie sich redlich, will lernen und wissen, wie man einen schwereren Man ausknocken kann. Wie alle Neulinge, rennt sie so lange zum Turm hoch, bis sie die Strecke ohne zu pausieren schafft. Joggen, Karate und Gymnastik findet sie in Ordnung, verweigert aber das Radfahren. „Habt ihr mal die Schenkel der Radsportlerinnen gesehen? Die passen in keine Jeans“, behauptet sie. Jeder merkt, Katy macht Sport um ihre Figur zu verbessern, nicht ihre Gesundheit.
Im Hospital ist Waschtag, Elfriede ist dran. Normal reine Routine, reine Langeweile, wird sie dieses Mal mit einem unvorhergesehenen Problem konfrontiert. Sie stellt fest, das Flüssigwaschmittel zieht seit neustem Fäden. Mit dem gefüllten Becher geht sie zu Zora, steckt einen Finger hinein und zieht mit ihm Fäden aus dem Becher. „Kann man damit noch waschen?“ Für das Mädchen ist es normal, dass mit der Zeit eines nach dem anderen unbrauchbar wird. Zora findet es witzig und ruft Freddy herbei. Zu dritt wetteifern sie unter Lachen, wer die längsten Fäden zustande bringt.
Fried meint dann: „Seit du schwanger bist, seid ihr so was von kindisch. Entweder freut ihr euch riesig auf das Kind, oder ihr verliert vor Sorge den Verstand. Ich jedenfalls werde mit dem Zeug keine Wäsche waschen und erst recht nicht meine.“
Sie ist nun fast so groß wie Zora. Blaue Augen unter blonden Locken, blicken in braune Augen unter roten Locken. Die eine sommersprossig und käsig, die andere, brauner Samt.
Auch er wird ernst. „Dann müssen wir es mit Pulverwaschmittel probieren.“
Zora rät: „Einer von uns sollte gleich hinfahren und nachsehen, ob es das noch gibt. Bevor es ausverkauft ist“, grinst sie noch.
„Oh bitte, lass mich das mit dem Salamander machen. Das ist ja nicht weit. Auf der Strecke kann ich nicht verloren gehen“, meint Elfriede mit einem gewinnenden Lächeln.
Normal fährt sie nur mit Begleitung. Sie fährt umsichtig und vorsichtig. Kein Hang zum Leichtsinn. Aber zum Überschwang. Zora und Fried schauen sich länger in die Augen. Als ob sie sich unterhalten würden.
„Wegen mir. Nimm aber ein Funkgerät mit. Eins mit vollen Akku“, sagt die Dunkle dann.
„Ja“, stößt die Junge ihre Rechte in die Luft. Man vertraut ihr. „Bin schon weg.“
Sie holt das Funkgerät und setzt sich in den Notarzt. Kaum in Bewegung, singt sie aus voller Kehle: „Kost Benzin auch Dreimarkzehn, scheißegal es wird schon geh‘n, ich will fahr‘n“, was sie von Marion gelernt hat. Keine Viecher auf der Straße. Bis auf eine rekordverdächtige zwei Meter lange Ringelnatter, die sich auf der Kanalbrücke sonnt. Erst im letzten Moment taucht sie ab. Elfriede weiß, wo im Markt die Waschmittel stehen. Da Ratten und andere Nager das Zeug nicht mögen, sind die Kartons unversehrt. Sie schüttelt mehrere Packungen. Wenn es drinnen rieselt, ist es noch pulvrig. Einige Sorten scheinen verklumpt zu sein. Sie lädt mehrere Produkte ein und fährt zurück. Auf der Brücke liegt wieder frech die Ringelnatter. Als Fried links einbiegt, stehen dort mehrere Pferde. Eher Ponys. Aber nicht so klein wie Shetlandponys. Links ist die Straße von einer Leitplanke begrenzt, dahinter fließt der Kanal. Rechts der Straße befindet sich ein hoher, verbuschter Rain. Die Pferde können nur in eine Richtung. Oder den Salamander überrennen. Sie bewegen sich Richtung Osten. Elfriede fährt im Schritt hinterher. Zählt die Tiere. Sieben an der Zahl. Zwei weißbraune, zwei schwarze und drei braune. Sofort verliebt sie sich in eines der Weißbraunen. Das würde sie gerne besitzen und auf ihm reiten. Langsam verfolgt sie die kleine Herde. Beim ehemaligen Campingplatz, auf dem noch unzählige Caravans stehen, hätten sie die Möglichkeit die Straße zu verlassen. Doch sie gehen daran vorbei und auf das Dorf zu. Elfriede bekommt eine Idee und einen heißen Kopf. Wenn das klappen würde. Sie funkt Freddy an, erklärt ihm den Sachverhalt. Er soll den Weg zum Dorf versperren, dann müssen die Pferde wohl oder übel zu Toms Hof einschwenken. Tagsüber steht dort die Schafkoppel leer. Wenn es gelänge die Pferde dort hinein zu lenken, hätten sie sieben bildhübsche Reittiere.
Auf mobile Weidezäune sind sie schon lange nicht mehr angewiesen, das machen nun Brombeeren. Die ersten Pflanzen die das ehemalige Ackerland und die Wiesen besiedelten, waren Brombeeren. Überall dort, wo Jan mit den Schafen und Ziegen die Landschaft beweidet, ist sie offen, jenseits davon oft undurchdringlich. Brombeeren sind auch nützlich. Sie hindern die Wölfe an freier Bewegung. Aber auch die großen Säugetiere, die dann lieber an den Straßen und Feldwegen entlangfressen und deshalb gut jagdbar sind. Das Niederwild profitiert. Zahlreiche Wildwechsel führen unter den stacheligen Ranken endlos durch Täler und über Hügel.
Es gibt ja nicht nur „die“ Brombeere. In Deutschland gedeihen dutzende Arten. Schwache, starke, kurze Dornen, lange Dornen, einjährige, zweijährige. Am häufigsten sind die dünnen Kratzbeeren. Überall wo ein Bisschen Licht auf die Erde fällt, beginnen sie sofort zu wachsen und lassen jeden stolpern. Damit Äcker und Wiesen von außen her nicht zu wuchern und kleiner werden, muss Tom zweimal jährlich mit dem Mulchgerät die Ränder abfahren. Auf diese Art entstand ein undurchlässiger Saum. Um jedes Feld, um jede Wiese stehen nun natürliche Brombeer- Zäune, die die Grasfresser abhalten. Die Ziegen fressen zwar die Brombeerblätter, aber nur am Rand. Ins Stacheldickicht selber dringen sie nicht ein. Deshalb wäre die von dichten Brombeeren umgebene Schafkoppel auch eine sichere Pferdekoppel.
Auf Freddy ist Verlass. Unter anderem schätzt Elfriede an ihm, dass er sie ernst nimmt. Die Straße ist mit einem quer stehenden gelben Postauto versperrt, die Pferde weichen nach links aus zum Schwimmbad. Manchmal bleiben sie stehen und fressen. Wiederholt funkt sie mit Tom, der einige Fahrzeuge quer stellt und Leute dahinter postiert. Inzwischen hat sich fast die ganze Gruppe versammelt, um dem Ereignis beizuwohnen. Sie fährt einige Meter vor, die Pferdchen setzen sich wieder in Bewegung. Keinesfalls will sie die Herde aufschrecken. Pferde in Panik gehen die Raine hoch, durchbrechen Wände, würden sich schwer verletzt in den Brombeeren verfangen. Deshalb bleibt sie wieder stehen und schaut ihnen hinterher, wie sie an Freddys alter Unterkunft vorbeitrotten. Sie fressen an den Blumen, die Calendula einst gepflanzt hat. Lautlos lässt sie den Salamander vorwärts gleiten. Irritiert schauen die Pferde immer wieder zurück. Sie können zwar nicht alle Farben erkennen, aber die wilde Musterung des Fahrzeugs. Nun müssten sie nach rechts in die Koppel. Quer auf dem Weg steht ein Unimog. Ein anderes Postfahrzeug versperrt den Weg hinter Toms Wohnhaus. In Panik wären die Pferde schnell an den Fahrzeugen vorbei. Sie bleiben stehen und scheinen zu sinnieren. Der schwarze Hengst will am Unimog vorbei. Tom erscheint. Neben das Postauto stellen sich Marion und Otmar. Die Pferde entscheiden sich gottlob für den Weg in die Koppel. Tom schließt sofort das Tor.
Elfriede kann es nicht fassen, sie haben nun eigene Pferde. Sie sind ihnen praktisch zugelaufen. Von allen Seiten wird sie für ihre umsichtige Tat gelobt. Nie hat sie so viel Zuspruch erfahren. Noch am gleichen Abend kommen Hasan und Roman herüber, um sich von dem Wunder zu überzeugen. Beide sind begeistert von den Tieren. Sie währen ideal zum Reiten. Doch bis das problemlos funktioniert, würde noch viel harte und unerquickliche Arbeit anstehen. Die Fluchttiere müssen erst an Menschen gewöhnt und davon überzeugt werden, dass Menschen für sie ungefährlich sind.
„Ihr solltet sie bei euch im Hof koppeln“, schlägt Hasan vor. „Dann kommt ihr jeden Tag an den Tieren vorbei und lernt euch näher kennen. Wenn sie merken, dass von euch keine Gefahr droht, kann man mit ihnen arbeiten.“
Soweit Hasans Theorie. Aber er kennt sich nur mit seinen handzahmen Hofpferden aus. Über Wildpferde weiß er nix.
Katys Hund Strom macht deutlich, wie leicht die Aktion hätte in die Hosen gehen können. Die Sache war nur deshalb so erfreulich gut verlaufen, weil sie mit ihm wandern war. Strom wäre durchgedreht und hätte die Pferde den Hügel hoch gejagt. Kaum zurück, rastet er aus. Die Pferde galoppieren in der Koppel nervös im Kreis herum. Der Hund muss nun an die Leine und an die neuen Tiere gewöhnt werden.
Mit Pfosten und Stangen bauen Tom und seine Männer an die Längswand der großen Scheune ein stabiles Gehege und zur Schafkoppel eine stabile Gasse. In die Gasse legen sie Zweige mit frischem Laub und stellen auch gefüllte Wassereimer hinein. Tatsächlich wandern die Pferde während eines Abendessens hinüber. Schnell wird hinter ihnen der neue Zaun geschlossen. Die Schafe und Ziegen dürfen wieder in ihr gewohntes Nachtquartier, wo sie sich sicher fühlen.
Nun gehen die Menschen täglich dicht an den Wildpferden vorbei, die Tiere werden entspannter. An Futter bekommen sie alles was ihr Herz begehrt. Kräuter, Heu, Hafer, Laub und Wasser. Elfriede die Pferdenärrin, geht nach einer Woche ohne Erlaubnis hinter die Stangen, weil sie ihr Lieblingspferd streicheln will. Alle sieben Pferde tänzeln unruhig umher. Sie geht auf das braunweiß gescheckte zu. Es ist ein Hengst. Er weicht aus. Sie versucht es weiter, doch das Tier steigt hoch. Mit einem Satz hechtet Elfriede zwischen den Stangen hindurch nach draußen, und verschrammt sich einen Ellenbogen. Otmar hat es gesehen. Der alte Mann, der eigentlich für ihre Ideen immer Verständnis hat, herrscht sie an. „Bist du nun von allen guten Geistern verlassen?“ Da wird ihr bewusst, dass Wildpferde völlig anders ticken. Am Abend holt Zora unsanft zwei Kieselsteinchen aus der Ellenbogenwunde. Elfriede verzieht schmerzhaft das Gesicht, Zora schimpft mit ihr. Wochenlang scheitern sämtlich Annäherungsversuche. Die Pferde wehren sich erfolgreich dagegen Haustiere zu werden.
Doch dann bekommt der Hof wieder Besuch. Zwei Männer, Paul und Sergei, beide nicht schwul, kommen mit zwei Pferden, Stan und Laurel, beide nicht mehr die Jüngsten, und einem Planwagen vorbei. Das Gespann sieht sehr romantisch aus. Zigeunerromantik. Doch stellt sich heraus, dass sie bis vor kurzem noch sesshaft waren. In Karlsruhe. Dort haben sie Richard und Simone getroffen. Wie alle anderen auch, unterhielten sie sich darüber, wer was wo macht. Richard hätte ihnen diesen Hof empfohlen. Paul und Sergei erzählen gerne, haben keine Geheimnisse und werden von der Gruppe als friedlich und normal eingestuft. Katy lädt den drahtigen Sergei in ihre Wohnung ein. Theresa lässt den weichfleischigen und glatzköpfigen Paul bei sich wohnen. Und dabei bleibt es. Die zwei Männer erweisen sich als nützlich. Zwar war Paul Versicherungsvertreter, aber auch Hobbyhandwerker. Der jüngere Sergei hat eine abgeschlossene Sanitärausbildung. Versteht also etwas von Rohren. Beide verstehen auch etwas von Pferden. Sergei will den schwarzen Hengst zureiten.
Auf ihren Vorschlag hin wird eine zweite Koppel angebaut. Mit Hilfe von Stangen trennen sie den Hengst von den andern Pferden und treiben ihn in die neue Koppel. Angstfrei begibt sich Sergei hinein, packt ohne Vorrede den Hengst in der Mähne und schwingt sich hinauf. Der Hengst bockt, springt und dreht sich, als ob ihm der personifizierte Teufel im Nacken sitzen würde. Dabei ist das Tier der Teufel selbst. Es drückt Sergei brutal an die Scheunenwand und reibt ihn sich vom Rücken. Bevor die Beobachter mit Stangen dazwischen gehen können, kommt er auch noch unter die Hufe
Der Notarzt wird gerufen. Die Hufe haben Sergei das linke Schien-und Wadenbein gebrochen, stellt Freddy fest. Auch sonst sieht Sergei sehr ramponiert aus. Vorsichtig wird er auf die Trage gelegt und ins Hospital gefahren. Zora und Freddy bekommen ihren ersten schweren Unfall auf den OP-Tisch. Nun muss sie das machen, was sie am unliebsten macht. Einem weitgehend Fremden eine Vollnarkose verpassen.
Eile ist geboten. Zora muss die Knochen richten, bevor alles anschwillt und sie nichts mehr ertasten kann. Kümmert sich gleichzeitig um Knochen und Betäubung. Freddy drückt Sergei die Maske aufs Gesicht. Elfriede und Heidi sind nachgekommen. Beide sollen lernen wie das mit der Betäubung geht. Der Unterschenkel schwillt schon alleine dadurch an, weil Zora so viel an ihm herumzerrt und drückt. Freddy tupft ihr mehrmals den Schweiß aus dem Gesicht. Als sie mit ihrer Arbeit zufrieden ist, kontrolliert er, ob die Gebeine sich in der richtigen Flucht befinden. Letztlich wird das Bein geschient. Einen Gips soll Sergei erst in fünf Tagen bekommen. Wenn die Schwellungen verschwunden sind. Nach dem Erwachen hat er zuerst Durst, dann dürfen Paul und Katy zu ihm, danach kommen die Schmerzen. Er bekommt Tabletten. Heidi erklärt sich bereit, Nachtwache zu halten. Nach drei Tagen sind die Schmerzen abgeklungen.
Die Mannschaft des Hospitals beschließt, sich beim Angeln zu entspannen. Fisch soll mal wieder auf den Tisch. Elfriede will unbedingt mit. Heidi übernimmt den Patienten. Sie fahren aber nur um die Ecke zu den Fischteichen. Nach dem Hochwasser musste Tom den Anfahrtsweg wieder herrichten. Durch den weggespülten Damm hat sich das Volumen der unteren Teiche stark verkleinert. Nach dem nächsten Hochwasser könnten sie schon verlandet sein. Aus dem ausgelaufenen Teich bei der Hütte ist eine Schilf- und Rohrkolbenfläche geworden. Sie setzen sich an den oberen Teich. Machen es sich in warmer Kleidung auf Campingstühlen gemütlich, stellen einen Vesperkorb und Thermoskannen neben sich.
Elfriede redet am Stück, bewegt ihre Angel ständig hin und her, fängt ein Fisch nach dem anderen. Redet von Pferden, ihren Zukunftsplänen und über die anderen. Zora erträgt die Dauerberieselung mit stoischer Ruhe. Freddy zeigt nach kurzer Zeit Nerven. Er versucht ihren Redefluss mit Fragen zu unterbrechen.
„Hast du früher geangelt? Mit deinem Papa oder deinen Brüdern vielleicht? Wer so viele Fische fängt, muss doch Erfahrung haben.“
Auf einmal schweigt sie. Von Elfriede kommt vorerst gar nichts. Freddy macht sich Vorwürfe. Er ist zu weit gegangen, denkt er. Nach dem Vorleben zu fragen, ist immer eine heikle Sache. In der Regel wird das vermieden. Viele wollen nicht darauf angesprochen werden, weil es sie sofort traurig macht. Nicht wenige befürchten Depressionen. Die meisten halten es für überlebenswichtig, nur an das Heute und die Zukunft zu denken. Fried weicht aus mit einer Gegenfrage.
„Hast du früher mit deinem Papa oder deinen Brüdern geangelt?“ Dabei schaut sie stur auf die Wasserfläche.
Nun schweigt Freddy. Zora überlegt schon, wie sie die gute Stimmung wiederherstellen kann, als er doch antwortet.
„Ich hatte tatsächlich Brüder. Zwei. In unserer Familie war ich der einzige normale. Mein Vater war Theaterintendant, meine Mutter Opernsängerin, der mittlere Bruder war Profifußballer, mein jüngster, Schlagersänger.“
„Wow“, sagt Zora.
Elfriede zweifelt. „Und das soll man glauben?“
„Beweisen kann ich es nicht. Es ist deine Entscheidung ob du mir glaubst. Aber geangelt habe ich nie. Mit meinen Brüdern war diesbezüglich nichts anzufangen. Der eine opferte seine Zeit der Musik, der andere verbrachte sie auf dem Sportplatz.“
„Und weshalb warst du der einzige normale in der Familie?“ will Zora doch wissen.
„Ich hatte als einziger ein geregeltes Leben und konstantes Einkommen und bin zudem ohne Abitur ausgekommen. Als alle gestorben sind, war ich mit einer Freundin zusammen. Keine große Liebe, keine Kinder. Ich habe weder die Nähe meiner Eltern gesucht, noch die der Brüder. Jeder ist für sich an seinem Wohnort gestorben. Ich habe mich später vergewissert und alle Wohnungen abgeklappert. Auch die von Bekannten und Freunden. Und ich sage euch, die Viren waren gründlich. Als Rettungssanitäter hätte ich eigentlich als erster sterben müssen. Bei uns im Krankenhaus lagen auf einmal überall Leichen. Auch Personal. Die Leute sind schneller gestorben als man sie entsorgen konnte. Noch mehr Infizierte zu holen machte einfach keinen Sinn mehr. Da habe ich mich abgenabelt und verkrochen.“
„Und deine Freundin?“ fragt Elfriede.
„Die hat mich gemieden, weil sie nicht angesteckt werden wollte und ist trotzdem gestorben. Und jetzt will ich wissen, wo du angeln warst.“
Elfriede nickt mehrmals vor sich hin. Als ob sie Freddys Erzählung rekapitulieren würde. Dann:
„Ich war mal mit meinem Kindermädchen angeln. Schwarz. Das war vielleicht eine schöne Zeit. Ihr werdet es nicht glauben, ich kann zwar Deutsch sprechen und lesen, aber immer noch nicht richtig schreiben. Mein Vater war ein hoher EU-Beamter und Franzose. Meine Mutter arbeitete für ein französisches Modemagazin und war Deutsche. Die ersten acht Jahre meines Lebens habe ich in Straßburg verbracht. Dann sind wir, fragt mich nicht wieso, nach Kehl gezogen. Von meinen Eltern habe ich nicht viel gehabt. Aber ich hatte Kindermädchen. Die Straßburger Mädchen habe ich jeden Tag zur Verzweiflung gebracht. Die sollten mich zu einer feinen Dame erziehen. Aber ich war zu zappelig und habe mich ständig schmutzig gemacht.
Die letzte, Conny, die aus Kehl, war sehr geschickt. Sie hatte zwar keine Schulbildung und keinen Beruf erlernt, war aber trotzdem clever. Nachdem sie gemerkt hat was mit mir los ist, formulierte sie eine Abmachung, mit der wir beide sehr gut gefahren sind. Sie sagte: „Ab jetzt mache ich das was du willst und habe nur noch schöne Tage.“ Wir haben uns verschworen. Nach dem Unterricht sind wir durch die Stadt gezogen, auch durch Straßburg, waren Eis essen, in Kinos und haben bis in die Puppen, wie sie sagte, Fern gesehen. Wenn ich am nächsten Morgen zu müde für den Unterricht war, hat sie mir eine Entschuldigung geschrieben. Dann sind wir zum Beispiel angeln gegangen. Oder haben Lagerfeuer gemacht. Da ich leicht lerne, waren die Noten nie schlecht, Conny lobte mich über den grünen Klee, die Eltern waren zufrieden. Dabei waren wir die wahrsten Herumtreiberinnen. Wir kannten sogar Obdachlose.
Und dann kam der Todesengel. Wo meine Eltern gestorben sind, weiß ich nicht. Sie haben uns oft angerufen und gemailt und irgendwann nicht mehr. Eines Montagmorgens stand Conny unten auf der Straße und rief herauf, sie könne nicht mehr kommen. Sie hätte sich angesteckt. Ich müsse nun alleine zurechtkommen. Danach habe ich wochenlang aus der Speisekammer gelebt. Hab erlebt, wie ein Fernsehsender nach dem anderen ausfiel, das Internet abgestellt wurde und zuletzt die Radioprogramme verstummten. Irgendwann trieb mich der Hunger in den nächsten Supermarkt. Ich habe mir eine schöne Wohnung genommen, eine Fantasiewelt ausgedacht und gewöhnte mich ans kalte Waschen. Sehr oft machte ich ein Lagerfeuer, dachte dabei an Conny und hab geheult. Ich bin richtiggehend verwildert. Mit Mofas erkundete ich die Gegend, immer weiter weg, bis ich in Lahr auf die Religiösen gestoßen bin. Aber da war ich schon sehr verwahrlost.“
Auf welche Art sie überlebte, alleine oder mit anderen, mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, will sie scheinbar nicht erzählen. Zora und Freddy warten still auf mehr. Sie wollen Elfriede Gelegenheit geben, schlechte Erlebnisse, die es bestimmt gegeben hat, loszuwerden. Doch das Mädchen schweigt sich aus.
Schließlich: „Schön, dass wir das wissen, Diplomatentochter“, meint Zora anerkennend.
„Und jetzt deine Angelerlebnisse“, fordert die Diplomatentochter.
„Hab keine“, behauptet die ehemalige Medizinstudentin.
„Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Was waren deine Eltern, was hast du früher gemacht? Dass du von hier bist, weiß ich inzwischen. Du bist hier auf das alte Gymnasium gegangen.“
„Ich war wie du das einzige Kind. Meine Eltern arbeiteten im Europapark. Ich habe immer Freikarten bekommen. Als Kind kannte ich den Park in und auswendig.“
„Cool“, findet Elfriede. „Ich war mal mit Conny drin. Bei schlechtem Wetter, mitten in der Woche. Weil sie eine Entschuldigung geschrieben hat. Wir hatten die Bahnen praktisch für uns.“
Zora lächelt. „Nachdem ich beschloss Ärztin zu werden, habe ich nur noch gebüffelt und Sport getrieben. Der Park hat mich nicht mehr gereizt. Ich hatte ihn einfach zu häufig besucht. Dann habe ich in Heidelberg studiert, ein paar Kerle ausprobiert, war aber nie verliebt. So einen wie Freddy, ohne Abi“, sie grinst zu ihm hinüber, „gab es dort nicht.“
Auch Tom hat kein Abi, weiß Elfriede. Ist das Zoras Masche?
„Und bist du in Heidelberg geblieben?“
„In der Pandemiepause schickte mich mein Vater zu seinen Eltern nach Berlin. Dort habe ich mich in einem Zimmer eingeschlossen. Als meine Großeltern sich infizierten, sind sie selbstlos in den Keller und dort gestorben. Sonst wäre ich vermutlich gar nicht hier.“
Da war sie, die Vergangenheit die traurig macht. Die drei schauen auf die Wasseroberfläche, auf ihre Blinker, ob sich was bewegt.
Elfriede redet dann weiter. „Das ist ja toll. Und dann bist du in deine Heimat gefahren und Tom hat dich auf der Autobahn aufgelesen.“
„Das war der erste annehmbare Mann, der mir in meinem Leben begegnet war.“ Dann flüstert sie, aber so, dass es Freddy hört. „Ich wusste ja nicht, dass es noch bessere gibt.“
Er lacht. „Dass es auch Männer gibt die nicht angeln können“, weil bei Fried wieder einer angebissen hat.
„Aber wieso bist du nicht in Berlin geblieben?“ bohrt Elfriede weiter.
„Ja. Wieso eigentlich nicht?“ will auch Freddy wissen. „Wieso kehrt eine Frau wie du der Hauptstadt, in der es alles gibt, den Rücken und geht in diese ländliche Gegend?“
„Hier bin ich geboren. Hier kenne ich mich aus. Hier weiß ich was mich erwartet. Baden ist zwar ein winziger Landstrich. Aber er ist der wichtigste Landstrich der Erde.“
„Da bin ich mal gespannt wieso“, unterbricht Freddy. „Freiburg ist vielleicht die südlichste und angenehmste deutsche Großstadt. Das war‘s aber schon.“
Zora lächelt süffisant. „So ein Nordlicht wie du hat doch keine Ahnung. In Baden wurden das Fahrrad und das Auto erfunden. Aus Baden kamen solche Giganten wie Jürgen Klopp, Oliver Kahn, Jogi Löw, Steffi Graf und Boris Becker. Ein Badener hat sogar Amerika erfunden. Da bist du platt.“
Elfriede kräuselt ihre Nase. „Wie kann man Amerika erfinden?“
„Der Entdecker und Navigator Amerigo Vespucci hatte damals die amerikanischen Küsten erforscht. In Offenburg lebte der Kartograph Martin Waldseemüller. Der hat aus Vespuccis Daten die erste Weltkarte gemacht und den neuen Kontinent, zu Vespuccis Ehren, America genannt. Mit A am Schluss, weil Kontinente weibliche Namen tragen.“
Freddy schaut fasziniert. „Was unsere Frau Doktor so alles weiß.“
An Elfriede gewandt erklärt Zora: „Ettenheim hat tausend Jahre lang zu Straßburg gehört. Bis Napoleon es badisch gemacht hat. Als Straßburgerin bist du hier also richtig.“
„Damit werde ich mich noch näher beschäftigen“, verspricht sie.
Die Fische sind für alle gedacht und kommen in Toms Küche, um die eigene vorm Fischgeruch zu verschonen. Die Küche wird inzwischen Kantine genannt. Seit die vier ehemaligen Soldatenfrauen integriert wurden, ist die Küche zu klein für alle. Das Essen wird nun buffetartig auf dem Herd und der Arbeitsfläche bereitgestellt. Ab zwölf kann dann jeder vom Stapel einen Teller nehmen und sich schöpfen. Kommen alle auf einmal, zum Beispiel weil es draußen regnet, müssen sich die späteren ins Wohnzimmer setzten und warten, bis es Platz gibt. Essen im Wohnzimmer ist verboten. Außer Zora, Freddy und Fried, beteiligen sich alle am Küchendienst. Dadurch haben Stella und Tom immer eine saubere Küche. Und die anderen auch, weil sie zuhause nicht kochen müssen.
Der Patient bekommt Täglich Besuch. Von Katy, von Paul, Tom, Hasan. Nachts bemuttert ihn die Krankenschwester Heidi. Morgens wird Sergei erst spät wach. Er schlafe schlecht, beklagt er sich. Am sechsten Tag fährt das Hospitalpersonal mit ihm hoch zum Krankenhaus. Sie röntgen das Bein. Alles in Ordnung. Dann wird es eingegipst. Am siebten Tag findet Elfriede im Müll einen gefüllten Kondom.
„Ihr braucht sowas ja nicht. Kann es sein, dass er von unserem Patienten stammt?“ Zora und Freddy schauen sich an. Sie wissen, dass Heidi gerne Nachtwache schiebt und Sergei lange braucht um aufzuwachen.
„Der gehört Sergei“, behauptet Freddy einfach. „Bring ihm den.“
Elfriede stülpt einen Gummihandschuh über, fast den Kondom mit den Fingerspitzen an und legt ihn dem Patient auf den Nachttisch. „Das hättest du auch einer Samenbank spenden können“, ihr Kommentar.
Abends gesteht Heidi: „Wir sind ein Liebespaar. Ich will, dass Sergei in mein Zimmer verlegt wird. Es ist nicht nötig, dass er hier noch länger liegt.“
„In deine Wohnung?“ fragt Zora vorsichtshalber. „Nicht in Katys?“
„Er ist jetzt mein Freund. Die Leute können ihn auch bei mir besuchen.“
„Gibt das keinen Ärger? Weiß das Katy?“
„Seit heute“, behauptet Heidi.
Hinter Heidis Rücken meint Freddy: „Wir sollten froh sein, dass sie einen festen Freund hat. So lässt sie hoffentlich während ihrer Nachtwachen die Finger von zukünftigen Patienten.“
Am nächsten Morgen bringen sie Sergei in Heidis Wohnung hoch. Für die Frauen der Gruppe ist das ein positives Zeichen. Es ist also möglich, der Berufsnutte eine Beute zu entreißen. Sie hatten befürchtet, dass Katy jeglichen Männerzulauf bezirzt, verführt, bei sich einquartiert und den anderen nichts lässt. Die Frauen sind beruhigt, dass auch andere eine Chance haben.
Derweil beschäftigen sich die Pferdefreunde mit dem Problem der Zähmung. Was Sergei geschah, darf kein zweites Mal passieren. Alle die sich Pferdekenner schimpfen setzen sich zusammen. Nach stundenlanger, teils kontroverser Beratung, einigen sie sich auf einen Plan, wie aus den wilden Pferden Haustiere gemacht werden sollen. Zuerst fahren sie mit Traktoren und Anhängern ins Nachbardorf, auf das Gelände des Altdorfer Reitvereins. Dort bauen sie in den Ställen sieben Pferdeboxen ab. Die werden in Otmars Scheune an der Längsseite wieder aufgebaut. Es werden Zaumzeug und Sättel organisiert, Pflegeutensilien, eben alles Notwendige für die Pferdehaltung.
An einem Samstagmorgen geht es zur Sache. Fast alle Bewohner der Höfe finden sich als Zuschauer ein. Sie wollen Männer purzeln sehen, scherzen sie. Endlich mal wieder Zirkus, es sei ja sonst nichts geboten. Auch der Notarzt mit der Hospitalbesatzung steht bereit. Mit der härtesten Nuss wird begonnen. Der schwarze Hengst soll an Zaumzeug gewöhnt werden. Die Zuschauer stellen es sich allerdings anders vor, als die Männer es sich ausgedacht haben. Der Teufel wird von der Herde getrennt. Sechs Männer werfen sich auf das nicht besonders große Pferd, halten sich daran fest, während ein siebter das Zaumzeug überstülpt. Mit der Kandare im Maul wird der Hengst ein wenig friedlicher. Weil das wilde Tier sich im Maul verletzen kann, soll später eine Trense verwendet werden. Am Zügel geführt und von sechs Männern geschoben und gehalten, kommt das Pferdchen in eine Box, in der es zukünftig seine Freizeit verbringen muss.
Nun kommt der gescheckte Hengst dran, Elfriedes Lieblingspferd. Als er merkt, dass die Reihe an ihm ist, steigt er fast aus der Koppel. Drei Männer hängen sich an seinen Hals, drei liegen auf seinem Rücken. Roman versucht das Geschirr anzulegen. Das Pferd schiebt sieben Männer hin und her. Es ist eine noch härtere Nuss als der Schwarze.
„Das kann man ja nicht mit ansehen“, schimpft Elfriede. „Falls es Knochen zum zusammenfegen gibt, ich bin im Wohnzimmer und schaue einen Film. Wenn es Leichen gibt, dürft ihr die ohne mich entsorgen.“
Was Elfriede schlimm findet, finden die anderen recht unterhaltsam, wenn nicht sogar lustig. Obwohl die Pferde den Männern ordentlich zu schaffen machen, müssen die Frauen und Kinder immer wieder auflachen. Den Pferdemännern fließt der Schweiß in die Augen, die Hemden werden feucht, die Kehlen durstig. Sieben Pferde auf einmal machen natürlich besonders viel Mühe. Bis alle endlich mit Zaumzeug versehen sind, ist das Mittagessen fertig.
Am nächsten Morgen wird den Pferdchen das Zaumzeug abgenommen, am Abend wieder angelegt. Man versucht die Tiere in der eigenen Box herumzuführen. Tage später werden Sättel aufgelegt und festgezurrt. Die Sättel werden wieder abgenommen, nochmals wird gesattelt. Angeblich sei das für die verängstigten Tiere schonender. Elfriede verdreht nur die Augen. Als diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, wird für Zuschauer das Scheunentor geschlossen. Die Männer wollen nun endlich reiten. Täglich gibt es blaue Flecken, Verstauchungen, Schürfwunden. Zora und Freddy sind gut beschäftigt. Irgendwann reiten Paul und Hasan auf zwei trächtigen Stuten aus der Scheune. Die Hengste werden noch einige Tage länger drangsaliert. Elfriede findet die ganze Aktion erbärmlich. Ihr ist das Reiten verleidet. Sollen doch andere dicke Schenkel und Ärsche bekommen.
Zoras Bauch wächst. Sie bewegt sich viel und arbeitet auch, verzichtet aber auf das Joggen. Die Männer haben eine kräftige, elektrische Getreidemühle besorgt. Erstmals machen sie Mehl aus selbst angebautem Getreide. Während die Männer an der Einstellung experimentieren, schaufelt sie Körner in einen Trichter. Ohne Pestizide stand das Getreide nicht besonders dicht, dazwischen wuchs viel Unkraut. So kommen auch viele Unkrautsamen ins Mehl. Was es angeblich gehaltvoller und gesünder macht. Ob es auch gut schmeckt? Tom zerstreut ihre Zweifel. „Das ist alles eine Sache von Zucker und Salz. Solange wir das haben, können wir alles schmackhaft machen.“
Zora hilft beim Backen der neuen Brote. Gibt Hefe, Mehl, Salz, Eier und Milch in eine Küchenmaschine und lässt es durchkneten. Das Brot aus dem eigenen Getreide schmeckt. Es ist würzig, aber es schmeckt. Die Männer machen auch Maismehl, die Frauen daraus Maisbrot. Vielfalt ist wichtig, predigt Zora. Immer nur Weiß- und Roggenbrot wäre auf Dauer zu einseitig. In Zukunft wollen sie von gefundenem Mehl unabhängig sein und sich selber versorgen. Um Missernten kompensieren zu können, müssen sie das Ackerland vergrößern. Als Winterbeschäftigung wollen die Männer neue Felder anzulegen.
Leider wird es bitter kalt. Von Osten schiebt sich, mit herrlich blauem Wetter, ein Russlandhoch übers Land. Der Boden wird hart, ist nicht mehr zu bearbeiten. Es kann weder gepflügt, noch können Wurzeln ausgegraben werden. Die Männer pflegen und warten die Maschinen, Geräte und Werkzeuge. Doch das ist bald erledigt. Für Temperaturen bis minus vierzehn Grad sind die allseits beliebten Infrarot Heizungen zu schwach. Die warme Bude ist nicht mehr gewährleistet. Mit Hilfe von Generatoren könnte man die Stromzufuhr erhöhen. Aber die lärmenden Geräte sind keinem sympathisch. Also wird in die Kaminöfen Holz geschoben was geht. Weil viel Holz verheizt wird, besorgen sie Nachschub. Auf zahlreichen Grundstücken lagern mit Blechen abgedeckte Brennholzvorräte. Ster neben Ster. Man muss sie nur aufladen und heimfahren. Mit dem erbeuteten Militär-Unimog, der seinen Treibstoff vorwärmen kann, stechen Tom und seine Leute in die Landschaft, laden Mehrmals die Pritsche voll und bringen es zu den Höfen und zum Hospital. Das Holz wird an den Zäunen entlang aufgestapelt und abgedeckt.
Auch das ist in wenigen Tagen erledigt. Das Kältehoch rührt sich aber nicht von der Stelle. So fahren Tom und seine Mannen zum Waldrand und fällen einige Buchen. Stämme und Äste werden zerkleinert und am Waldrand aufgeschichtet. Bis das Holz in einigen Jahren gebraucht wird, ist es trocken. Bei dieser Arbeit entdecken sie nach langer Zeit mal wieder Wölfe. Scheinbar haben die nun alle verwilderten Hausschafe und Ziegen verspeist und müssen sich nun mühsam von Wildtieren ernähren. An Jans Herde trauen sie sich nicht heran, die Border Collies sind aufmerksam und Jan ist inzwischen ein guter Schütze. Das gesichtete Rudel ist auch nicht besonders groß. Den Nachwuchs zu versorgen ist für die Wölfe nicht mehr so einfach. In der freien Landschaft ist es schwierig geworden, sie kommen kaum vorwärts. Beute jagen ist auf den ehemaligen Wiesen und Feldern wegen den Schlingpflanzen nicht mehr möglich. Nachts hört man sie manchmal heulen. Da marschieren sie, auf der Suche nach Vierbeinern, die offenen Feldwege und Straßen ab. Deshalb sind nächtliche Spaziergänge für die Menschen gefährlich. Wer alleine ohne Gewehr unterwegs ist und einem hungrigen Rudel begegnet, hätte vermutlich keine Überlebenschance.
Eines schönen Morgens geht Zora hinaus, will sich strecken und Gymnastik machen. Sie spürt ein mildes Lüftchen um die Nase wehen. Verwundert stellt sie fest, wie warm Null Grad sein können. Das Kältehoch wird von einer südlichen Strömung nach Norden abgedrängt. Zwei Wochen später blühen die Wilden Pflaumen. Sie sind immer die Ersten. Vor dem Haus schießen die Krokusse aus der Erde. Der lange Dauerfrost hat auch die Schneeglöckchen am Aufgehen gehindert. Nun locken sie Bienen und Schmetterlinge an, die von dem frühen Nektar- und Pollenangebot zehren. Kaum ist es warm, schon fliegen Zitronenfalter, C-Falter, Admirale und Pfauenaugen herum. Die Menschen sind erstaunt, wie sie aus dem Nichts auftauchen können. Die haben überwintert, behauptet Otmar. Angeblich würden die filigranen Tierchen als welkes Blatt an Büschen hängen und beim ersten warmen Sonnenschein erwachen. Kaum zu glauben, dass sie die Kälteperiode überstanden haben. Zora recherchiert in der Bibliothek und: Otmars scheinbares Märchen stimmt.
Trotz ihres dicken Bauches schnappt sich Zora einen Spaten und beginnt hinter dem Hospital umzustechen. Endlich will sie ihren, seit langer Zeit geplanten, Kräutergarten anlegen. Freddy und Elfriede besorgen ungefragt weitere Spaten und helfen ihr. Der Garten wird vermutlich einmal ziemlich groß. Um Medizin für alle herstellen zu können, braucht sie von jeder Pflanze mehrere Kilo Material. Dann müssen auch noch dementsprechend viele Pflanzen ausreifen, damit im folgenden Jahr die Samen ausgesät werden können. Auf einer Terrasse im Feld haben Marion und Stella einmal Osterluzei entdeckt. Aristolochia clematitis. Es war schwierig diese eigenartige Pflanze zu bestimmen. Nachdem es gelungen war stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Heilpflanze handelt, die früher in keinem Kräutergarten gefehlt hat. Schon die alten Ägypter hätten sie bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Der Wirkstoff der Pflanze soll auch die Geburt erleichtern und beschleunigen. Ja sowas kann man doch gut gebrauchen, meinte Zora. Die Pflanze taugt sogar als Abtreibungsmittel, wobei die Vergiftungsgefahr groß ist. Im Altertum wurde sie auch zur Wundbehandlung verwendet und als Mittel gegen Schlangenbisse.
Die Osterluzei muss verpflanzt werden, andere Kräuter brauchen sie nur auszusähen. Im vergangenen Sommer hat die Gruppe auf vielen Spaziergängen, Wanderungen und Radtouren, Samen von Pflanzen gesammelt, aus deren Blüten und Blätter Gesundheitstee hergestellt werden kann. Diese Kräuter sollen noch vermehrt werden und beanspruchen deshalb ein richtig großes Feld. Da ist Tom gefordert.
Das Verhältnis zwischen den zwei Paaren Zora/Freddy, Stella/Tom, ist nicht gerade herzlich. Aber sie reden miteinander. Stella und Tom kommen sich irgendwie herabgestuft vor. Von Zora und Freddy haben sie den Eindruck, dass die beiden das große Los gezogen haben. Sie wohnen separat, pflegen einen liebevollen Umgang, sind nicht nur die wichtigsten der Gruppe, sondern auch noch die Schönsten. Ihre Sonderstellung als Mediziner macht den stolzen Hofbesitzer Tom zu einem abhängigen Vasallen. Das empfindet aber nur er so. Zora und Freddy sind überzeugt, dass sie dem Wohl der Gruppe dienen und eine wichtige Arbeit machen. Wenn Tom sein Schicksal betrachtet, kann er nur den Kopf schütteln, wie unsinnig es gekommen ist. Er hat nun eine blutarme Freundin mit dicken Schenkeln, die mit ihm unzufrieden ist, weil sie dem jungen knackigen Freddy nachheult. Trotzdem erdreistete sie sich von Tom schwanger zu werden und das Kind auch noch austragen zu wollen. Der ehemalige Vater zweier Kinder hat ein Problem damit. Kinder sollen andere bekommen, andere sollen Väter werden. Er weiß um das zukünftige Problem, die Kinder gesund zu erhalten. Er will nicht noch eins verlieren.
Mit dem Gefühl, auf Zoras Können angewiesen zu sein, beredet er mit ihr, wie das „Tee-Feld“ angelegt werden soll. Die Heilpflanzen werden auch ihm, Stella und dem Kind zugutekommen. Deshalb will er alles ordentlich und gewissenhaft ausführen. Zora wird bei der Gartenarbeit schnell müde. Immer öfter muss sie sich tagsüber hinlegen. Freddy sagt zwar nichts, lässt sie aber mit seinem besorgten Blick nie aus den Augen. Elfriede ist stiller als sonst, will Zora nicht nerven, beobachtet sie aber sehr genau. Schwanger ist etwas, das sie auch mal werden will. Wer Mutter von zehn Kindern werden will, sollte in jungen Jahren anfangen. Sie ist nun vierzehn und weiß, dass sie schon Mutter werden könnte. Aber erst will sie eine so gute Medizinerin sein wie Zora. Und da wäre noch die Sache mit dem geeigneten Mann. Da ist weit und breit keiner in Sicht. Sie spielt und tobt zwar mit den Jungs aus Hasans Gruppe, aber als Freund kann sie sich keinen vorstellen. Sie sind ihr einfach zu hirnlos. Dann lieber noch den einige Jahre älteren Jan. Der schweigt zumindest im richtigen Moment.
Die Kinder die fast alle Teenager sind, haben einen neuen Spielplatz gefunden. Einen Abenteuerspielplatz. Dort können sie klettern, entdecken, sich verstecken, Hütten bauen und wilde Tiere jagen. Den Platz müssen sie sich allerdings mit den letzten wild lebenden Zwergziegen teilen. Es ist der Stadtkern, der sogenannte Stock, der letztes Jahr zu Schutt und Asche wurde. Tagelang brannte und rauchte es vor sich hin. Ein Haus nach dem anderen wurde von den Flammen erfasst. Wiederholt kam es zu Explosionen, die vermutlich von Gasflaschen und Gasleitungen verursacht wurden.
Dann kam Sergei. Die Gruppe erfuhr, dass er sich mit Leitungen auskennt. Sofort bekam er den Auftrag in Dorf und Stadt nach Gasleitungen zu suchen. Er hatte die Wahl zwischen verschließen oder entleeren. Wer Gas braucht, besorgt es sich in Flaschen. Gas aus dem Gasnetz ist eher eine Gefahr als nützlich. Er entschied sich für das Entleeren und öffnete alle Hebel und Ventile die er fand. Blieben die Flüssiggastanks, von denen einige in den Vorgärten stehen. Die Gruppe diskutierte über deren Nützlichkeit. Sergei gab zu bedenken, dass sie mit dieser Technik nichts mehr anfangen können. Der Inhalt der Tanks wurde der Atmosphäre übergeben.
Die verbliebenen Wände der Fachwerkhäuser stehen als schwarze Klippen im Stadtkern. In den früheren Räumlichkeiten ist das Mobiliar verbrannt, liegen nun Dachziegel, Backsteine, Gipsreste und verkohlte Balken. Einige Fassaden sind auf die Straßen gestürzt. Die Dächer hinterher. Leider ist der Bücherladen mitverbrannt. Wer neuen Lesestoff sucht, muss nach Herbolzheim ausweichen. Die Innenstadt ist für Fahrzeuge zurzeit nicht passierbar. Ursprünglich wollte die Gruppe die malerische Altstadt für sich und die Nachwelt erhalten. Das Feuer hat diese Absicht zunichtegemacht. Vielleicht wird Tom, wenn ihm danach ist, mit der großen Traktorschaufel die Durchfahrt wieder herstellen.
Die Stadt wird jährlich botanischer. Der Pflaster-Belag fördert das Sprießen von Unkraut, Stauden und Bäumchen. Es gibt auch noch die Pflanzenkübel, die der Innenstadt einstmals ein blumiges Flair verschafften. Bei genügend Feuchtigkeit wuchert es aus ihnen üppig heraus. Dieser werdende Urwald lockt auch Vögel an, die in den hoch aufragenden Mauerresten ihre Nester bauen und sich von den Blüten besuchenden Insekten ernähren, oder dem Samen der Pflanzen. Störche brüten auf den Dächern keine mehr. Ihnen fehlen die offenen Wiesen und Gewässerufer. Diese innerstädtische Pflanzenvielfalt hat auch die Zwergziegen angelockt. Nirgend wo sonst haben sie eine Überlebenschance, nur in dieser urbanen Wildnis. Grüppchenweise liegen sie in der Sonne, wiederkäuen und genießen die Ruhe. Nach gewisser Zeit erheben sie sich und knabbern sich durch die Gassen. Wölfe würden nur zwischen die Häuser gehen, wenn sie von den Zwergziegen wüssten. Und wenn sie tatsächlich kämen, würden die Ziegen auf die Mauerreste klettern, auf ihre Feinde herabschauen und meckernd lachen.
Dies ist also der neue Spielplatz der Kinder. Auch Elfriede geht mit. Am liebsten wird geklettert. So richtig wie die Profis mit Seil und Helm. Am nördlichen Ende des Stocks, gegenüber dem Unteren Tor, steht ein achteckiger Brunnen, aus dem immer noch, zum Wohlbefinden der Ziegen und Kinder, sauberes Wasser fließt. Das nächststehende Haus war ein Café gewesen. Von diesem Haus blieb der Nordgiebel stehen, der Klettermittelpunkt der jungen Bevölkerung. Ein besonderer Reiz hat die Erforschung alter Kellergewölbe mit Taschenlampen. Am meisten Spaß macht es, wenn man die Kellertüren erst entdecken und dann freilegen muss. Viele Keller sind nur durch überdeckte Außentreppen begehbar.
In einer Ruine gibt es einen Raum, dem die Fensterwand weggebrannt ist. Von der Decke hängt ein Leuchter aus vielen Birnen und Glassteinchen. An den Wänden kleben verrußte, gestreifte, altmodische Tapeten. In diesem Raum steht, wuchtig wie ein Thron, ein, wie durch ein Wunder, vom Feuer verschonter alter Ohrensessel. Um diesen Sessel wird oft intensiv gekämpft. Viele Spiele gehen darum, als Sieger auf dem Thron sitzen zu dürfen. Am beliebtesten ist Zielwerfen mit Steinen. Da haben auch die Jüngeren eine Chance. Beim Wettklettern oder Rennen, landet meistens Elfriede auf dem Thron. An diesem Tag stellen sie sechs leere Konservendosen, die sie extra mitgebracht haben, auf einen verkohlten Balken. Wer sie mit den wenigsten Würfen herunterschießt, soll der Tageskönig sein. Die Kinder suchen nach passenden Steinen, Elfriede jongliert derweil mit gefundenen Eierbechern. Ein Kind ruft: „Eine Schlange“. Alle eilen hin. Die Schlange ist vielleicht achtzig Zentimeter lang und sieht kräftig aus. Auf dem Rücken hat sie ein dunkles Muster. Sie kriecht an einer Wand entlang, die Kinder versperren ihr den Weg. Sie zischt.
„Das ist keine Blindschleiche und keine Ringelnatter“, sagt Siggi der Älteste. „Und eine Kreuzotter kann es auch nicht sein. Die gibt es laut Otmar nur oben im Wald.“
„Vielleicht möchte eine Kreuzotter neue Reviere erkunden“, meint Claudia.
„Ich hab mal von einer Schlingnatter gehört“, sagt Elfriede. „Die haben auf dem Rücken auch eine Zeichnung. Und sie sind ungiftig.“
Der Älteste macht sich daran die Schlange zu fangen. Langsam, kaum sichtbar, so wie er sonst Eidechsen, Frösche und Fische fängt, geht seine rechte Hand auf die Schlange zu, um sie im Nacken zu packen. Die Schlange züngelt und bleibt ruhig liegen. Was bei Eidechsen und anderen Tieren funktioniert, geht bei Schlangen leider nicht. Ihre Zunge spürt die Wärme und riecht die Hand. Weil sie sich bedroht fühlt, beißt sie Siggi in den Arm.
„Au. Die ist aber heftig.“
Als die Schlange auch noch springt, halten die Kinder respektvoll Abstand und lassen sie in Ruhe.
„Ich würde das von Zora desinfizieren lassen“, rät ihm Elfriede. „Die Schlange hatte bestimmt ungeputzte Zähne.“
Während die Konservendosen beworfen werden, schwillt Siggis Arm an. Und schmerzt.
„Es war doch eine Kreuzotter. Keine Schlingnatter. Du Falschmelder“, schreit er Elfriede an. „Wegen dir werde ich nun sterben“, und ist den Tränen nahe. Elfriede funkt Freddy an, spricht von Giftschlange und dickem Arm und drängt ihn sofort zu kommen.
Zuhause liegt Zora schlapp auf der Couch, hält sich den zum Bersten aufgeblasenen Bauch und wartet auf die Wehen. Eigentlich will Freddy nicht weg. Aber Giftschlange hört sich dringend an. Zora schickt ihn in die Stadt den Patienten holen. Elfriede geht mit Siggi zum Oberen Tor. Dort steigen sie in den Salamander. Die Kinder schauen ihnen mit gemischten Gefühlen nach. Während der Fahrt desinfiziert Elfriede die Bissstelle. Auf dem kurzen Stück bekommt der Teenager einen heißen Kopf, wird der Schmerz unerträglich. Beim Hospital bringen sie ihn, nun stützend, in das Behandlungszimmer. Siggi wird hingelegt, bekommt Schmerztabletten und Antibiotika. „Was macht man bei einem Schlangenbiss?“ ruft Freddy Zora zu. Sie sitzt schon über einem Buch. Plötzlich verzieht sie ihr Gesicht.
„Freddy, das Kind kommt“, und fast sich an den Unterlaib.
Siggi ist augenblicklich vergessen.