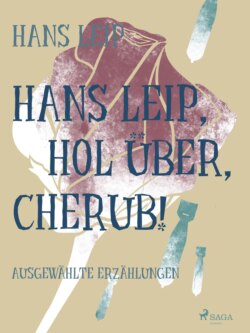Читать книгу Hol über, Cherub - Hans Leip - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Braut und die Schiffsglocke
ОглавлениеMintje Terborn, blond, rundlich, wohlbehütet, war aufgewachsen in einer der Villen an der Seebadseite zu Vlissingen, die alle aussehen, als wären sie miteinander verschwägert. Und so verlobte sich Mintje mit Paul Vanderstraat von nebenan, der flott und dunkel und ehrgeizig aussah und Bankfach gelernt hatte und als einziger Erbe seines Onkels – bei dem er wohnte – in Betracht kam. Einige Romane von Laurids Bruun hatten ihn nebenbei mit windigen Vorstellungen von der Welt jenseits der Ozeane erfüllt. Er beschloß deshalb, das Jahr bis zur Hochzeit in einem seinem Onkel befreundeten Bankhause in Rio zu verbringen. Schon seiner Lektüre zuliebe wählte er statt des Flugzeuges einen Dampfer für die Überfahrt.
Auf der Schiffsroute gen Südamerika gilt die Insel Madeira als geeignete und hübsche Zwischenstation. Man pflegt sich dort erfolgreich dem Klimawechsel zwischen Europa und drüben oder umgekehrt anzugleichen. Mintjes Vater hatte Geld genug, um seiner Tochter und sich zu gestatten, Paul bis dorthin auf seiner Überseereise zu begleiten. Er war lange Witwer und herzleidend und Mintje seine Einzige; und da es ihr so gut in Funchal gefiel, zumal in Reids teurem Hotel, hatte er nichts dagegen, als sie beschloß, allda das Wiedersehen mit Paul zu feiern. Nach Jahresfrist sollte dann auch die Trauung auf Madeira stattfinden, abseits aller Welt, hinter den gelb und blauen Fenstern der kleinen Bergkirche Saõ Martinho. Und die Jakarandabäume würden wiederum so vergißmeinnichtblau blühen.
Doch Paul sah sich drüben angesichts des Zuckerhutes in den schwülen Tropennächten gesellschaftlicher Feste bald anders gefesselt. Und da es die Tochter seines Bankchefs war, ließ sein Ehrgeiz sich verleiten, die Vergangenheit und deren Verpflichtungen gering zu achten. Aber erst gegen Ende des Auslandsjahres wagte er mitzuteilen, daß er nicht mehr heimzukehren gedenke. Er schrieb dieses nicht etwa an Mintje, sondern an deren Vater. Dieser warf den Brief in den Ofen. (Man bevorzugte damals noch richtige Stubenöfen zu Vlissingen.) Sah dann aber doch ein, es sei geraten, das Töchterchen zu verständigen. Ehe er aber in der Erregung ein aufklärendes Wort hätte hervorbringen können, verschied er, vom Schlag getroffen.
Mintje, ahnungslos, von den immer kühler gewordenen Bräutigamsbriefen weniger erkältet als angeheizt, ließ ihre Reisevorbereitungen nicht lange durch die Förmlichkeiten der Trauer unterbrechen. Mit dem Brautkleid im Koffer fuhr sie allein nach Madeira.
Viele Dampfer kamen von Südamerika. Aber Paul war nicht an Bord. Der Termin des Wiedersehens war längst überschritten. Paul ließ nichts von sich hören. Er war wie verschollen. Kein Telegramm schien ihn zu erreichen. (Es muß gesagt werden, sie spielten drüben alle unter einer Decke, und selbst Pauls Onkel, der Bescheid wußte, wagte nicht, so grausam zu sein, Mintje die Augen zu öffnen.) Und so wartete sie weiter.
Sie hätte sicher unschwer über Behörden und Ämter Auskunft erlangen können. Aber sie unterließ jede Nachsuche. Sie sträubte sich, enttäuscht zu sein. Sie lehnte ab, an Betrug zu denken oder gar an Pauls Tod. Sie war von der beharrlichen Sorte, die fertigbringt, die fließende Wirklichkeit zum „Stillstand zu bewegen“. Gerade die rundlichen, so irdisch robust aussehenden Typen sind es gelegentlich, die ihr Gleichgewicht auf dem spitzesten Finger balanciert finden. Sie ertragen nicht, ihr Glück zerrinnen zu sehen. So lassen sie es gerinnen.
Als in einer stürmischen Nacht ein Fischer vor Funchal eine geheimnisvolle weiße Jacht unweit der gefährlichen Desertasklippen gesichtet haben wollte, da legte sich Mintje Terborn mit verzweifelter Entschiedenheit die Vorstellung zurecht, Paul sei mit dieser Jacht unterwegs zu ihr.
Es gibt Zustände, darin Zeit unwesentlich wird. So erging es Mintje. Ihr machte es nichts aus, daß dieses weiße Schiff nicht in den Hafen einlief, sondern so verschollen blieb wie Paul selber. Derselbe Fischer nun, von der Wirkung seiner Nachricht angeregt, suchte eifrig nach Wrackteilen und Ertrunkenen, fand aber nichts als eine alte Schiffsglocke, welche die Brandung zwischen die Klippen geworfen und die schon lange dort gelegen haben mochte, unkenntlich überwuchert von Seepocken und Saugmuscheln. Der findige Mann wandte eine Menge Sand und sogar eine Dose Putzpomade daran, das bronzene Gehäuse zu säubern und auch noch die Patina herunterzuscheuern. Dann brachte er sie ins Hotel.
Da kam nun ein gewisser Mister Crunk darüberzu, ebenfalls Gast in Reids Palace und sachkundig. Der meinte, der Form nach und auch betreffs der verschliffenen Zierate sei die Glocke ihre runden vierhundert Jahre alt und stamme womöglich von einer der gescheiterten Fregatten des Seeräubers Montluc.
Fregatten gab es vor vierhundert Jahren noch nicht. Das war, was Mintje Terborn antwortete. Denn sie war aus Vlissingen und aus einer Reederfamilie. Gewillt nun und fähig, alles auf den einen Nenner zu bringen, fuhr sie fort: Und warum, Mister Crunk, sollte Paul die Glocke nicht auf seiner Privatjacht benutzt haben? Derlei kann man vielleicht sogar in Rio beim Trödler kaufen. Er weiß zu rechnen. So ein altes Ding war vielleicht billiger als eine neue. Und dann hat sie der Sturm über Bord gefegt, als sein Schiff vom Kurs abkam. Er ist unterwegs. Wir werden die Sache bald geklärt finden.
Und sie unternahm, der Glocke einen Ton abzugewinnen, obwohl der Klöppel fehlte, und hob sie kräftig auf und schlug mit ihrem Verlobungsring an die Wandung. Es gab einen metallischen Klang ohne große Besonderheit. Sie lauschte ihm hingegeben; denn es war der Klang, den Paul vernommen haben mußte die ganze Überfahrt lang im Abschlag der Glasen alle halbe und volle Stunde. Und sie zahlte einen beträchtlichen Finderlohn und entzog sich dem Glückwunsch Crunks, der äußerte, sie habe den Sammlerwert beachtlich unterboten. Auch den übrigen Behelligungen, die in einem großen Hotel unausbleiblich sind, entzog sie sich, den aufmerksamen Blicken, den gesellschaftlichen Anbiederungen, der Neugier, dem Mitleid, dem Lächeln. Sie zog in eine bescheidene Pension nahe der Landemole.
Dort, in einem lichten Moment, untersuchte sie die Glocke aufs gründlichste, so als ob diese eine Art Flaschenpost sei. In dem kleinen Schuppen auf dem Dache neben dem Wassertank hantierte sie mit grobem Werkzeug daran herum. Sie muß doppelwandig sein, sagte sie. Der Klang hat es mir gleich verraten.
Mit Hilfe der Hausmeisterin gelang ihr, das Klöppellager herauszuschrauben, und tatsächlich, eine äußere und innere Glockenhaube waren höchst kunstvoll mit den Rändern ineinandergeschliffen, gehalten durch den Klöppelbolzen. Der Hohlraum dazwischen allerdings erwies sich als leer.
Fräulein Terborn tat nun alles, um den Zustand der Beharrlichkeit aufs neue zu sichern. Da in einen solchen die Börsenkurse schlecht hineinpassen, ließ sie ihr in Papieren angelegtes Erbgut restlos in Pfundnoten umwechseln. Unterdes hatte sie die Glocke mit einem verschließbaren eisernen Bodendeckel versehen lassen, der so angebracht war, daß die beiden Hülsen dennoch voneinander trennbar blieben; denn den Hohlraum dazwischen hatte sie als ihren Geheimsafe ausersehen; dahinein schichtete sie die vielen Hunderterscheine. Und sie besorgte es bei verschlossener Tür ohne die Hilfe der Hausmeisterin.
Diese, eine Mulattin, vierschrötig, nicht mehr jung, durch allerlei Mißgeschick verbittert und besonders darüber, keine Weiße zu sein, hatte die Zimmerbetreuung der Holländerin selber übernommen, sich einiges an Trinkgeldern, abgelegten Kleidern, Seifenstückchen und ausgelesenen Magazinen versprechend. Ihr schien die üppige fremde Blondine, die das beste, zum Hafen gelegene Zimmer als Dauergast bewohnte und scheinbar nicht nötig hatte zu arbeiten, so beneidens- als hassenswert, und sie verrichtete die übliche tägliche Bedienung, zumal als die Dame das Zimmer nicht mehr verließ, in steter lauernder schweigsamer Erregung. War es zuerst das weiße strahlende Fleisch und das Gold der Haare gewesen, das ihre Gier und die Notwehr ihres Widerwillens aufgereizt, so wurde es im Laufe der Jahre immer mehr die Glocke, diese lächerliche Schiffsglocke, die neben dem Bett stumm und bedeutsam auf dem Nachttisch stand. Hüte sie mit mir, Sirza! hatte die Holländerin gesagt und hatte die Vokabeln aus einem portugiesischen Wörterbuch zusammengesucht: Mein ganzer Brautschatz ist darin. Paul kann jede Minute eintreffen.
Mintje Terborn hatte alle Zeitbegriffe von sich abgestreift. Ihre Uhr lag unaufgezogen. Sie las keine Zeitungen oder Magazine, fragte nicht nach Tag und Stunde, schrieb keine Briefe und erhielt auch bald keine mehr, empfing keine Besuche und verzichtete auf jede Teilnahme an öffentlichen Vergnügungen, besuchte weder Kino noch Theater, ging nicht zur Kirche und ließ die schöne Landschaft der Insel völlig ungenutzt. Sie wartete. Sie verweilte in ihrem Warten, lächelnd und gewiß, lernte aus einem zum Pensionsinventar gehörenden Neuen Testament Portugiesisch und las zum hundertsten Male „Van Zantens glückliche Zeit“, ein Buch, von Paul bei seiner Abreise vergessen. Nebenbei begann sie sich der Unterweisung zu entsinnen, die sie als Kind von ihrer Mutter in Klöppelarbeit erfahren hatte. Sie ließ sich von ihrem letzten, außerhalb der Glocke befindlichen Gelde das Nötige an Gerät und Garn besorgen und war von da an fleißig und immer geschickter, endlose Meter flandrischer Spitzen herzustellen. Notgedrungen mußte die Pension davon bezahlt werden. Die Mulattin versah das Zwischengeschäft und steckte den Überschuß stillschweigend ein, der trotz der in Fülle angebotenen Madeirastickerei wegen der landfremden Eigenart zu erzielen war.
Und so saß Mintje am Fenster, abseits der Weltgeschichte, ein Muster unwandelbarer bräutlicher Geduld, Jahr um Jahr. Wenn sie die Augen hob, blickte sie zur Landemole hinüber und dann aufs Meer bis an den Horizont und dann auf die Hafenreede und zurück auf den gleich ihr wartenden Glockensafe. Wir werden ein Haus davon bauen und einen Garten haben und vier Kinder, flüsterte sie. Und die Glocke hängen wir in den Windfang oder auf den Vorplatz statt eines Gongs. Sie wird uns alle zu den Mahlzeiten versammeln ...
Paul Vanderstraat unterdessen lebte das gehetzte Dasein eines zu Rio de Janeiro verheirateten Bankiers. Als sein Sohn so weit war, ihn zu entlasten, kam irgendein schwarzer Donnerstag und ließ wenig übrig. Paul tat das für ihn Einfachste und beglich mit sich selber. Der Sohn, Paul mit Namen wie sein dahingegangener Vater und fast dessen junges Ebenbild, geriet nach einigen matten Anläufen, sein Brot standesgemäß zu verdienen, als Aufwärter an Bord einer Privatjacht. Der Besitzer war einer jener Junggesellen und Brasilianer, die erworbenen Reichtum rechtzeitig in Genuß umzusetzen vermögen. Er sammelte Briefmarken, Gemälde und bibliophile Ausgaben wie andere auch, hatte aber zudem ein Sondergebiet. Er sammelte alte Schiffsglocken. Und gerade darin gedachte er, auf einer Weltreise an allen guten Küsten der Erde seinen Bestand um einiges Bedeutende zu vermehren.
In Kapstadt lernte er einen Gentleman namens Crunk kennen. Dieser behauptete, er habe zu Funchal auf Madeira eine Glocke gesehen, die unzweifelhaft von einer der Galionen Montlucs stamme. Sie sei damals im Besitze einer etwas wunderlichen jungen Dame aus Holland gewesen.
Damals? Wann war das? fragte der Brasilianer.
Mister Crunk dachte nach. Dann lachte er: Es ist mindestens zwanzig Jahre her. Das fulminante Objekt wird längst in einem Museum begraben sein.
Dennoch ankerte die brasilianische Jacht eines Tages auf der Reede zu Funchal.
Verzichten kommt nie zu spät, sagte der Eigner zu Paul: Ich habe beim Konkurs Ihres Vaters einiges verloren, und er hat gemeint, es zu sühnen, als er sich die Pistole an die Schläfe setzte. Sie können etwas Holländisch von ihm. Vielleicht leben hier noch holländische Damen mit Seeräuberglocken. Versuchen Sie, es gut zu machen!
Paul also begab sich an Land. Und eben hatte er, an den bergbäuerlich gekleideten Blumenverkäuferinnen vorbei, den breiten Betonweg der Mole abgeschlendert, als ihm eine Dame mittleren Alters, groß, rund und schwerfällig, entgegenkam. Sie war altmodisch gekleidet und lächelte starr und war so blauäugig und bleich wie eine Delfter Kachel und sagte: Da bist du ja, Paul. Ich sah vom Fenster aus, wie deine weiße Jacht auf der Reede Anker warf.
Paul grüßte unverblüfft auf Holländisch zurück. Er war als Steward gewohnt, mit Vornamen angeredet zu werden. Der Boß wird eine verteufelte Funkverbindung zustande gebracht und mich angemeldet haben, dachte er, und er fragte ohne Umschweife nach der Glocke.
Inzwischen schien für die Mulattin Sirza der Augenblick gekommen, eine seit zwanzig Jahren angestaute Begierde handgreiflich zu erlösen. Eben hatte das holländische Fräulein unversehens das Zimmer verlassen, seit zwei vollen Jahrzehnten das erste Mal, und war, so rasch die überreife Fülle und die aller Anstrengung entwöhnten Beine es erlaubten, auf die Straße geeilt und der Landemole zu. Sirza behielt sie durchs Fenster scharf im Auge, die umgestülpte Glocke im Schoß, und probierte das ganze Schlüsselbund des Hauses durch. Aber der Glockenboden wollte sich nicht öffnen. Wie häufig hatte sie doch mit dem Gedanken gespielt, diese alberne Glockenbraut zu erwürgen und ihr den richtigen Schlüssel vom Halse zu nehmen.
Oh, sie ahnte die ungeheure Summe, die hinter dem Glockenmantel verborgen lag. Wie eine rechtzeitig emigrierte Fürstin würde man davon leben können. Sie, Sirza, die Unbeachtete, Verachtete, das Halbblut, die Dreckaufleckerin für die anderen, grau, häßlich und alt. Weiße Dienstboten würde sie sich halten ...
Kam sie etwa schon zurück, diese holländische Verrücktheit und Spitzenmacherin, diese blöde, immer noch blonde unnotwendige Armseligkeit, dieser Glockenschatzdrachen? Und nicht einmal allein? Kam zurück sogar mit einem schnittigen jungen Senhor in Tropenweiß? O Nossa Senhora do Monte und alle neunhundertundneunzig Heiligen! Schon klangen die breiigen ausländischen Stimmen vom Hausflur herauf, schon auf der Treppe ... Sirza stellte die Glocke auf den Nachttisch zurück und drückte sich, vor Enttäuschung fiebernd, eben noch unbemerkt zur Zimmertür hinaus.
Draußen blühten die Jakarandabäume. Die Dame hatte Paul darauf aufmerksam gemacht und an eine scheinbar ein Jahr zurückliegende Verlobungsfeier erinnert. Paul junior war auf Wunderliches gefaßt. Freundlich und obenhin ging er auf alle Bemerkungen ein, seinen Auftrag im Sinn. Wie sollte er ahnen, welche Beziehungen ihn an diesen Platz geführt und daß er nichts sei als das Opfer von Energien, deren äußere Sanftheit täuscht, obschon es, jedermann geläufig, heißt: Der Glaube kann Berge versetzen. Die Dame hielt sich mühsam. Sie nahm seinen Arm. Auf der Treppe mußte er sie kräftig stützen. Aber endlich standen sie in dem kärglichen Pensionszimmer. Und da war auch die Glocke. Paul gedachte, es kurz zu machen. Wieviel? fragte er geschäftlich.
öffne selber, Paul! erwiderte sie erschöpft, aber strahlend. Meine ganze Mitgift ist darin. Und sie reichte ihm den Schlüssel, der an ihrem Busen geruht und warm war von ihrem Herzblut. Aber dank der Anstrengungen Sirzas sperrte sich das Schloß. Wir werden den Preis erklecklich senken, dachte Paul und murmelte etwas von kannibalischer Verhunzung des fragwürdigen Stückes und verlangte nach Werkzeug, um es zu befreien.
Unser Werkraum befindet sich auf dem Dache, Liebster! erklärte sie. Ich ziehe mich unterdes ein wenig um. Du bist so überraschend eingetroffen ...
Auf dem flachen Dache dann war Paul mit Hammer und Meißel gerade erfolgreich, den Glockenboden zu lösen, als katzenleise die Mulattin auftauchte. Sie nahm ein breites Stemmeisen zur Hand. Ich helfen! sagte sie. Paul hatte ein Ohr für begehrliche Untertöne von seines Vaters Geschäft her. Verschwinde, Nigger! knurrte er.
Nigger ... Das Wort entblößte die Mulattin jeder Hemmung. Und wie nun der Fremde verdutzt das aufklaffende Glockeninnere anstarrte – es war leer –, hieb sie ihm die Eisenschneide in den Nacken.
Nach einer Weile kam Mintje Terborn herauf, schwer atmend, festlich geschmückt. Sie gedachte, sich zu erkundigen, wieweit die Bemühung gediehen, und hoffte auf das glückstrahlende Lächeln ihres Ersehnten. Aber sie traf nur die Mulattin an, und die war dabei, mit einer Handvoll blutiger Hobelspäne umherzuwischen. Himmel, Sirza, was ist passiert? ächzte sie. Die Mulattin erwiderte mürrisch: Was schon! Der fremde Herr hat das Ding nicht klargekriegt und sich in den Finger geschnitten und ist ab damit.
Das Fräulein war im Warten geübt. Es vermochte sogar zu lächeln und sagte: Er wird zum Schlosser gegangen sein und zum Arzt.
Weniger geübt wartete der Jachteigentümer. Schon andern Tags benachrichtigte er die Polizei. Aber eine Schiffsglocke, vor zwanzig Jahren in einem Hotel von irgend jemandem angeblich gesehen, das war ein höchst dürftiger Fingerzeig, und Damen, und gar holländische, würden zu Funchal von der Polizei nur dann registriert, wenn ein Anlaß dazu vorläge.
Erst als einige Gäste besagter Pension sich über das übelriechende Waschwasser beschwerten, fand man den Vermißten. Er lag in dem gemauerten Wassertank, der auf dem Dach des Hauses neben dem Werkzeugschuppen stand. Und mit dem Ermordeten fand sich auch die Glocke im Wasser.
Es war nicht schwer, die Mulattin zum Geständnis zu bewegen. Der Bogen ihrer Gier hatte sich zwanzig Jahre lang gespannt, doch nun hatte der Pfeil den Vogel Phönix nicht erreicht, sondern nur das Genick eines zufälligen Beleidigers. Sie hatte nicht einmal mehr die Kraft gehabt, die Glockenhülse aufzuschrauben. Zweimal nachts habe sie versucht, die Glocke wieder herauszuangeln. Aber nur der Tote sei hochgekommen. Der Verdacht der Beamten angesichts des erbrochenen Glockendeckels, es liege Raubmord vor, wich großem Erstaunen, als die durch Zeit und Feuchtigkeit beschädigten Pfundnoten aus der Doppelwandigkeit ans Licht gelangten.
Der Brasilianer war zur Stelle. Ja, diese Schiffsglocke, diese Antiquität von Rang, dieses handwerklich erlesene und durch einen Kriminalfall gezeichnete Korsarenerz mußte er haben. Leider zögerte die Besitzerin, die Seltenheit herzugeben.
Der Fall erregte gehöriges Aufsehen. Unter denen, die sich um die arme Mintje bemühten, war auch ein Geistlicher und Landsmann, der die Insel ein wenig zur Erholung aufgesucht hatte und als Entgelt für die Glocke versprach, die Unglückliche in einem der Beginenhäuser der Heimat unterzubringen. Sie stiftete ihm die ganze, so sonderbar gehegte Mitgift, aber die Glocke behielt sie. Das stachelte den Sammlereifer des Herrn aus Rio ungemein an. Er hatte bald heraus, welch merkwürdige Beziehung die Dame mit seinem erledigten Steward verband, und er ließ es sich etwas kosten, alsbald einen ansehnlichen Grabstein für Paul zu beschaffen. Und nach der Beerdigung lud er die Holländerin mit aller Behutsamkeit zu einem Gläschen der Erinnerung an Bord ein. Indem sie zusagte, erst zögernd, dann mit jäher Bereitwilligkeit, schien sie plötzlich, ganz ohne Übergang, in die Wirklichkeit zurückgekehrt. Der von ihr bislang mit schmerzlichem Lächeln abgetanen Vermutung der Polizei, der Ermordete sei nicht ihr Verlobter, sondern der Sohn ihres Verlobten, zeigte sie sich nun aufgeschlossen. Ihr Erwachen war ohne Augenreiben und ihr selber unauffällig. Und noch bevor der süße Likör der Bordbar ihre Gedanken beweglicher machte, sagte sie, mehr verwundert als klagend: Also hat Paul doch eine andere genommen, dieser Windhund!
Bereitwillig erzählte der Brasilianer von Pauls Vater und dessen Ende. Sie schluchzte nicht. Sie betrachtete aufmerksam die Verknüpfungen des Schicksals, als sei es ein Klöppelmuster an einem verschossenen Brautkleid. Ohne Wehmut wiederholte sie ihren Entschluß, nach Holland zurückzukehren und als Begine ihr Dasein zu Ende zu führen. Der Schiffsherr tat sein mögliches, es ihr auszureden. Er bot ihr wahre Unsummen für die Glocke, so daß sie ohne Schwierigkeit überall hätte davon leben können. Schließlich, von ihrer blonden Beharrlichkeit und gesetzten, sich rosig überhauchenden Fülle und ihrem altbacken mädchenhaft versonnenen Lächeln aufs äußerste gereizt, fast so sehr wie von der Glocke, bot er ihr seine Hand. Und es gelang seiner feurigen Werbung, sie zu einem Ja zu bestimmen.
Auf Wunsch der Braut fand die Trauung in der kleinen Bergkirche unter den gelb und blauen Fenstern statt. Danach ging die Jacht gleich unter Segel. Noch im Brautkleide, dem so lange bewahrten und nur wenig geänderten, schlug Mintje vor, die belanglose Schiffsglocke des Seglers mit der alten Seeräuberglocke zu vertauschen, die sie als Mitgift mitgebracht, und nur den Klöppel hinzuzufügen. Sie hatte übrigens insgeheim alle Briefe ihres Pauls von damals in der Hohlwand untergebracht. Als sie nun die Glocke eigenhändig – sie bestand darauf – in das neue Lager heben wollte, da verbeugte sich das Schiff im atlantischen Schwell. Die Bugwelle zischte vorbei, als sei es ihr Brautschleier, und sie müsse ihm nach. Sie taumelte gegen die Reling, sie kippte vornüber, von der Glocke allzu belastet. Ihr Mann hatte den Bruchteil eines Wimperschlages Zeit, zu überlegen, was zu retten ihm wichtiger sei, die Glocke oder seine Frau. Er packte zu. Seine Finger erreichten noch eben das kalte Metall, gaben diesem ungewollt aber zugleich den letzten Anstoß. Und indes die Glocke davonrutschte und versank, krallte er sich, wutjammernd, in Mintjes Arm und wäre mit ihr gnadenlos der Glocke nachgestürzt, wenn nicht seine Leute, hinzuspringend, ihn und seine Gattin gehalten hätten. Danach denn, seinem tüchtigen Schlage entsprechend, überwand er sich und schrie herausfordernd in den Wind, als habe er begriffen, daß nicht nur ein scheinbar billig ergattertes Kleinod, sondern ein lästiger, ja, gefährlicher Ballast über Bord gegangen sei. Noch vor den Blicken seiner Besatzung umhalste und küßte er seine Frau und schwur, sie sei ihm kostbarer als alle Schiffsglocken der Welt. Und brachte sie dann behutsam wie nur je eine Rarität in die Kabine. Aber ihr sonderbares Auflachen und der verlorene Blick ihrer Augen und auch, wie sie ihn zärtlich mit dem Namen des einstigen Verlobten anredete, verrieten ihm nur zu bald, daß sie, der Glocke gleich, ihm für immer entglitten sei.