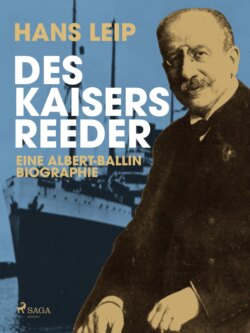Читать книгу Des Kaisers Reeder - Hans Leip - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Marianne
ОглавлениеEine Dame vor der Tür · Cello mit Hafenbegleitung · Petroleumlampen brauchen Wartung · Frau Reimers liest auf Weitsicht Erna · Zwei Mücken zuviel · Weitermachen! · Gesenkte Raten · Jemand wartet · Gib mir die Perle! · Fahrkarte ins Paradies · Die Verschleierte · Das Geheimnis der Perle · Goldene Handschellen · Hochzeitsreise ins Nordseebad.
Ein paar Tage danach zog Albert Ballin auf ein möbliertes Zimmer. Es lag an den Vorsetzen, nicht weit vom Kontor am Baumwall. Nun war niemand mehr da, der ihn bei seinen abendlichen „Andachten“, wie er es heimlich nannte, stören oder sich gestört fühlen konnte. Diese stille Arbeit bestand in der Abfassung eines immer länger werdenden Briefes, daran er wochenlang schrieb, nur unterbrochen von der wehmütig-sehnsüchtigen Stimme seines Cellos.
Die biedere Logiswirtin wagte sich nur auf Zehenspitzen zu bewegen, wenn sie die Lampe oder den Tee brachte, und über die „scheune Musik“ schmachtend die Augen verdrehte. Der junge Mann zahlte gut und stellte wenig Ansprüche. Tagsüber war er nicht da. Und laut war er auch abends nicht. Er spielte immer mit Dämpfer. Ach, es klang so innig. Nie lud er Kollegen oder sonst wen zu Bier oder Kartenspiel ein, wie es der Vormieter getan. Er brachte auch nie eine Freundin mit. Kurz, er war „ein soliden ordentlichen Menschen“. Da mochte er denn ruhig drauflosquinkelieren. Um zehn ging er sowieso zu Bett. Daß er nachts hin und wieder am Tisch saß und arbeitete, merkte Witwe Reimers nicht, ihr Schlaf war gewissenssanft und tief.
Einmal, gegen Abend, es begann schon Frühling zu werden, kam eine Dame an die Wohnungstür. Sie wollte nur mal fragen, ob ein Herr Ballin da wohne. Frau Reimers trat einladend zurück: „Jawohl, Fräulein, er ist grad in, können schon von hier hören.“
Wirklich vernahm man die leise Melodie eines Streichinstruments. „Das ist wohl aus den Kinderszenen von Bizet“, meinte die Dame.
„Hab’ ich noch gar nich’ gemerkt, Frollein, können ja aber selbst nachsehn, nur nich’ so schüchtern.“
„Ist das hier immer so und öfters?“ frug die Dame.
„Och der? Das is’ ja wohl rein ’n Puritaner, is’ das ja wohl. Immer allein und nichts als Arbeit, und Mittag ißt er bei sein’ Mutter.“
Aber die Dame will nur einen Brief abgeben. Vornehm und Vergnügen ist zweierlei, denkt Frau Reimers. Immerhin ist gerade ihre Nichte vom Lande auf Besuch und spitzt in der Küche die Ohren: „Wir sind ’n anständiges Logis, Frollein, ich werde ihn ’reinbringen. Wenn Fräulein auf Antwort warten will, hier vor Tür?“
Aber Marianne ist schon auf der Treppe. „Gott sei Dank, das ist erledigt“, flüstert sie mit blassen Lippen, als die Haustür hinter ihr ins Schloß fällt.
*
Das Fenster steht offen. Der Straßenverkehr voller Hufschlag und Räderrollen brandet herauf. Die Bagger am Grasbrook geben noch immer keine Ruhe. Die Kette ihrer Eimer holt ächzend den Schlick aus der Tiefe. Das Hafenbauamt gedenkt, die neuen Becken hinter dem Sandthorkai auf fünf Meter Mittelwasser zu bringen. Fünf Meter, denkt Albert, das wird bald zuwenig sein. Aber was soll die ganze verlorene Liebesmüh! Eines Tages hat man mit anderthalb Meter Tiefe genug für sich selber, falls es überhaupt für einen Platz in der trockenen Erde reicht und man nicht mit dem feuchten Element vorliebnehmen muß.
Hamburg baut seinen Freihafen, auch für ihn, der da schwermütig die Saiten streicht. Die Loren, die den Dreck über lange Stege zu ins Wasser hinauswachsenden Molen aufschütten, poltern in die Nachtschicht hinein. Zusammen mit dem Baggergejaule, dem Werftgehämmer und den Dampferstimmen deucht es dem Cellospieler die rechte Begleitung. Nur zu, flüstert es in ihm. Greift nur ins Dunkle, höhlt die Schlünde, speit die Schätze der Welt ein und aus! Höhlt das Finstere auch in mir, grenzenlos wie die Welt, damit es Platz hat und es nirgends anstößt, das liebe Antlitz!
Vor vier Tagen hat er seinen Brief endlich abgeschickt. Er hofft auf keine Antwort mehr.
Ein paar Verszeilen von Heinrich Heine fallen ihm ein. Er sieht den jungen Dichter und Rassegenossen, wie er, verliebt gleich ihm in eine Hamburgerin, sich müht, im Tuchhandel etwas zu werden. Es war ihm nicht geglückt wie etwa Herrn Rauert. Das eine nicht und das andere nicht.
Ihr Brüder, wenn ich sterbe,
versenkt mich in das Meer!
Hab’ immer das Meer so lieb gehabt ...
Frau Reimers klopft, öffnet verstohlen, bringt auf Zehenspitzen ein weißes Etwas, legt es, da der Zimmerherr sein Spiel nicht unterbricht, wortlos auf den Tisch, nimmt die Petroleumlampe, und ehe sie das Zimmer verläßt, schickt sie nur mit den Augenlidern ein Zeichen zum Fenster hin. Draußen wartet sie mit lauschender Anteilnahme an der Tür, bis sie voller Befriedigung inne wird, daß das Cello nach kurzer Unterbrechung weit trauriger als vorher wieder anhebt. Mit Kanne, Dochtschere und Lampenputzer macht sie das rundliche Beleuchtungsgerät gebrauchsfertig und stülpt die geblümte Kuppel aus Porzellanglas darüber. Deren Form erinnert sie immer an ein Bild ihrer Mädchenjahre, auf dem sie im Ballkleid mit freien Schultern und zierlicher Halsrüsche von einem Kunstmaler konterfeit worden war. Leider ist das Bild im großen Hamburger Brand nicht verschont geblieben. Zärtlich streicht sie über den Porzellanschirm und erzählt der pausbäckigen Nichte, wie schön damals alles, insbesondere sie selber gewesen sei. Damals gab es nur Kerzen und nicht „so ’n ekligen, stinkigen und ganz gefährlichen Smerkram“ zur Beleuchtung.
Es dämmerte. Zeit war, die Lampe hineinzutragen. Das Cello schwieg gerade.
„Vielleicht ist es ein Rendezvous, und er macht sich noch fein“, vermutete die Nichte. Aber die Tante verwies ihr solch lockere Vorstellung, sie solle man lieber Teewasser aufsetzen.
Hierauf klopfte sie an und betrat, wie üblich das Herein nicht abwartend, das Zimmer ihres Mieters. Der Abendschein lag glühend im Fenster. Herr Ballin stand düster davor und hatte etwas zwischen den Fingern anscheinend direkt in den Sonnenuntergang gehalten, ein Kleinod vielleicht, so dachte Frau Reimers, das wohl richtig mal funkeln sollte. Aber es war denn doch eine Bewegung dabei gewesen, als habe er das anscheinend winzige Stück zum Munde führen wollen. Um es zu küssen? Um es zu schlucken? Vielleicht war es nur eine Schlaf- oder Beruhigungspille. Das alles erwog Frau Reimers bald darauf, indes ihr Logiergast das fragliche Objekt in die Jackentasche versenkte und geradezu, als sei er ertappt, sich wieder an sein Instrument setzte und, den Blick steif ins Abendrot gerichtet, jämmerlich weitermusizierte.
Bedächtig stellte die Witwe nun die Lampe auf den Tisch, riß ein Zündholz an, hob den Glaszylinder und entzündete den Docht, nicht ohne ihn zuvor mit dem Schwedenhölzchen glattgestrichen zu haben. Sie ließ sich Zeit. Ihr Auge ruhte weniger auf der Petroleumlampe als auf dem Briefblatt, das offen hingeworfen am Tischrand lag. Dank der Weitsichtigkeit ihres Alters vermochte sie die wenigen Zeilen unauffällig zu erspähen.
Sehr geehrter Herr Ballin,
Ihre Veilchen haben mein Herz erquickt und bedrückt. Zwar behaupten Sie, es tut nichts, daß ich drei Jahre älter bin als Sie und sogar etwas größer, aber mein Vater hat noch einen anderen Einwand. Sie wissen, welchen.
Hochachtungsvoll
Marianne Rauert.
Neben dem Briefe blitzte, in offenem Etui auf gewölbtem Atlas gebettet, eine kleine goldene Damenuhr mit herumgelegter dünner Halskette.
„Was für eine nüdliche Uhr das mal ist“, bewunderte die Wirtin, die heimliche Lektüre vertuschend.
Ballin tat einen zügigen Bogenstrich. „Können Sie mitnehmen!“ sagt er.
Witwe Reimers war nicht die Person, unüberlegte Äußerungen auszunutzen.
„Ist wohl für jemand Angenehmeren als Geschenk gedacht“, meinte sie mütterlich.
„Weg damit!“ grollte es vom Fenster.
„Aber doch nicht für meine Wenigkeit, Herr Ballin!“
„Schmeißen Sie das Ding in den Ascheimer, Frau Reimers!“
„Nee, Herr Ballin, das wär denn ja wohl frivol. Wenn Sie gestatten, schenk’ ich die kleine Klock mein Nichte. Für die ist das was. Wär’ – mit Verlaub – sogar eine Frau für Sie, Herr Ballin. Fehlt Ihnen ja längst so was. Frisch vom Lande, kocht wie ein Gott. Will ja auch partout was Besseres. Waren hinter ihr her, Sie glauben gar nicht. Einer, denken Sie, hat sich regelrechtermang sogar was antun wollen, ihretwegen. Aus Liebeskummer. So ’ne Idioten gibt es, Herr Ballin.“
„Bitte, Frau Reimers, ich möchte allein sein!“
„Sind Sie ja viel zu immer, Herr Ballin, können es ja noch längst genug, wenn mal so alt wie ich.“
Sie hatte inzwischen die Tür geöffnet und ruft energisch in den Flur hinaus: „Erna! Komm doch mal eben ’rein!“
Das Mädchen hat offenbar schon im Flur gewartet und ist flugs zur Stelle, halb neugierig glühend, halb ländlich schüchtern.
„Kuck mal!“ sagt ihre Tante, „was unser Herr Einlogierer dir da verehrt.“
„Fru Reimers!“ Ballins Stimme droht hilflos beschwörend in Plattdeutsch, als wolle er damit besseres Verständnis erzwingen. Mit Hand und Knie klammert er sich an das schweigende Instrument, als sei es eine lecke Boje. Apathisch sieht er zu, wie die kleine Uhr von den dicken Händen der Schlummermutter um den Hals von Nichte Erna gehängt wird, wobei sie zufrieden schnalzt: „Pük! Direktemang wie ’n Orden, aberst ...“, und nun gerät ein zweideutiges Kichern in die gedämpfte Hinzufügung, „kein Nonnenorden ist das denn ja wohl doch nich.“
Erna lacht linkisch, geniert, wissend. Das gütige Licht der Petroleumlampe macht sie hübsch.
„Bedank dich“, flüstert die Tante. Und da die ländliche Schöne weder Fuß noch Zunge zu rühren vermag, gibt sie ihr einen gelinden Klaps auf die pralle Rückfront: „Denn mach wenigstens die Fenster zu! Kommen sonst noch zuviel Mücken ein.“ Das Mädchen setzt sich in Bewegung, drall und blond, süß duftend nach billiger Seife, die doch das Aroma von Kuhstall, Heu und Ackerkrume nicht verdecken kann, den Hauch des verlorenen Paradieses, der dem Großstädter ins Gemüt greift. Mit kleinen Schritten geht sie ans Fenster, beugt sich hinaus in die Landschaft aus Hafenlichtern, Lärm und Dampfergebrumm, um die nach außen geöffneten Flügel hereinzuholen. Die prallen Schenkel unterm dünnen Kleid streifen das Cello. Als springe ein Funke durch das blanke Holz über auf ihn, so nun springt der Zimmerherr auf.
Wie jeder Geist von Format ist er rasch entzündbar, gefährdet, sich zu verlieren, und gemeinhin begnadet, instinktiv bewahrt zu sein. Hier weiß er sich ins Humorige zu retten. „Mücken?“ lacht er, „tatsächlich, Fru Reimers, mindestens twe Mücken sünd hier to veel!“ Damit komplimentiert er die beiden hinaus und schließt sachte ab. Nimmt den Brief abermals in die Hand, das Papier leuchtet im Lichte des Petroleums einen Augenblick grell auf. Dann fliegt es zerknüllt zu Boden, wird erneut aufgenommen, wiederum entfaltet und schließlich in kleine Fetzen zerrissen. Ein trockenes Schluchzen würgt ihn. Aber die Hände greifen nicht noch einmal nach der kleinen Perle. Allerletzte Not? So weit ist es denn doch noch nicht. Hat ihn nicht das Vertrauen Carrs, dieses solide, achtbare hansische Vertrauen, sichtlich erkoren, nicht allein um seinetwillen, sondern für seine ganze Rasse? Hat er nicht Pionierdienst zu tun? Sind die Mutter und die Schwestern nicht mehr da, für die er zu sorgen hat? Er nimmt ein Bündel Akten vom Sofa, beißt die Zähne aufeinander, legt die Fingerspitzen zusammen und blickt durch die Gardine hindurch auf die Lichter eines ausfahrenden Ozeaners.
„Dort ist mein Lebenszweck“, flüstert er durch die Zähne. „Alles andere ist Abweg! Also? Weitermachen!“
*
„Wir schuften wie zehn Derbygäule!“ Herr Carr beugt sich übers Pult zu seinem Teilhaber, die Importe im Mundwinkel, den Hut im Nacken, die unvermeidliche Reitgerte unterm Arm. Er blättert in den umfänglichen Aufstellungen. Monat um Monat waren die Abschlüsse gestiegen, die Zahl der Passagen, die Summen der Einnahmen, die Abfahrten und die Ausgaben. Aber die Einnahmen überwiegen. Die Propagandaposten sind zurückgegangen, die Wolldecken längst abgeschrieben.
„Jedenfalls sitzen Sie gut im Sattel, Herr Carr“, nickt Ballin.
„Dabei ist mir immer, als hätte ich Ihnen den Steigbügel gehalten, Herr Ballin, und als wären mir Sporn wie Zügel entglitten.“ Carrs Pokergesicht verschattet sich, ein Abglanz der Düsternis, die über seinem Teilhaber liegt.
„Vielleicht trennen wir uns, Herr Carr“, sagt Ballin leise.
Carr schnippt bestürzt mit den Fingern. „Dann verkauf’ ich lieber.“
„Wäre zu früh!“
Carr stößt ihm abrupt die Hand hin: „Versprechen Sie mir, bei der Stange zu bleiben.“
Ballin legt die Fingerspitzen zusammen, sein Blick geht zum Fenster hinaus. Der Hafenqualm spult sich schmutzig in den Sommertag. Von der Passageabfertigung nebenan hört man gleichmäßiges Summen, Kommen und Gehen. Es wirkt einschläfernd wie ein Mückengesang. Er muß an die dralle Nichte von Frau Reimers denken. Wäre es nicht viel besser, statt der mageren Gentlemanshand des Compagnons, weibliche Arme zu fühlen?
Des Reeders gekränkte Stimme dringt wie aus weiter Ferne an sein Ohr: „Ballin, wenn Sie auf bessere Beteiligung aus sind, auch das!“
„Das soll es nicht sein, Herr Carr.“ Ballin wendet den vollen Blick auf den Partner: „Allerdings wäre es perfide, Sie auf der Höhe des Erfolges zu verlassen.“
„Ist sie erreicht?“
„Und bald überschritten.“
„Machen Sie keine Scherze, Ballin!“
„Wir müssen den Fahrpreis noch einmal senken.“
„Nein!“ Die Gerte pfeift unwirsch durch die Luft und klatscht an die Pultflanke.
„Der Lloyd hat schon, die Compagnie Générale Transatlantique, die Holland-Amerika, die Allan, Glasgow, Antwerpen, die White Star, die Liverpooler, alle haben die Sätze geschmissen, um uns klein zu kriegen.“
„Verfluchte Schufte!“
„Das Vorrecht der Erstgeburt kitzelt sie!“
„Und die Hapag?“
„Auch die Hapag.“
„Das ist bitter!“
„Aber es lohnt sich, Herr Carr.“
„Verdammte Sauerei!“
„Das Spiel beginnt erst!“
„Spiel nennen Sie das, Ballin?“
„Wie beim Derby.“
„Also scheinen doch Sie der zu sein, der im Sattel sitzt.“
„Dann vertrauen Sie dem Jockey, Herr Carr.“
Der Reeder sieht ihn durchdringend an. Er versteht nicht, wer hier abgehalftert ist. Immerhin heißt die Firma Carr-Linie, nicht Ballin-Linie. Der Reeder zieht die Hand zurück, streift die wildledernen gelben Handschuhe über, schiebt den Hut zurecht, nickt „Addio!“, geht, blickt zurück, flötet ein Signal und ruft:
„Eh ich’s vergesse, draußen am Lager wartet jemand auf Sie, ganz privat.“
Ballin dankt kurz. Er muß sein freudiges Erschrecken verbergen. Wer möchte ihn wohl privat sprechen wollen, wenn nicht die eine, die zu vergessen keine noch so betäubende Arbeit ausreicht?
*
Der Lagerraum der Carr-Linie gleicht einer Mustermesse europäischer Fertigwaren. Frachtstücke, Kisten, Ballen, Fässer tragen Aufschriften fast aller Industrien von Skagen bis zur Adria. Neben Speditionsgut häufen sich Schiffsbedarfsartikel aller Art, Tauwerk, Ersatzteile für Maschinen, Kajüts- und Logisausrüstungen, Laternen und nautische Instrumente. Die besonders kostspieligen Kompasse, Sextanten, Chronometer und Ferngläser liegen sorgsam verpackt und wohlverschlossen hinter einem engmaschigen Eisengitter.
Auch in diesem Raum fehlen die bunten Plakate nicht und werben von den gekalkten Wänden für die junge Reederei. Daneben mahnt unübersehbar rot umrandet eine gedruckte Vorschrift, wie man sich bei Feuersgefahr zu verhalten habe.
Nur ein schmaler Zickzackgang ist für die Bewegung von Mensch und Sachen frei gelassen. Ballin folgt ihm spähend, dem Ausgang zu. Der Lagermeister hat Fragen zur Verproviantierung. Ein Athlet von Arbeiter, die groben Hände vor der sauberen Schürze, möchte Urlaub wegen Kindstaufe. Ballin gibt ihm einen Taler für den Täufling. „Wo schall he denn heeten, Käsebier?“
„Albert natürlich“, lächelt der Riese.
Endlich ist Ballin am Ausgang zum Hof. Das Herz klopft ihm. Aber was da steht und ihm den Rücken zukehrt, ist kein weibliches Wesen. Vielleicht ist es Mariannes Vater. Er hat ihn vor einigen Tagen in aller Form schriftlich um die Hand seiner Tochter gebeten, ist aber bis jetzt ohne Antwort. Gefaßt tut er ein paar Schritte. Da erkennt er, ehe noch der Besucher sich umdreht, seinen Bruder.
„Joff!“ sagt er herzlich, ohne sich die Enttäuschung anmerken zu lassen. Der Angeredete wendet sich nervös um. Er ist modern, aber salopp angezogen, ja, nahebei gesehen, fast verwahrlost. Sein Gruß klingt heiser aus dem bleichen Gesicht zurück. Eine hastige Rasur hat kleine blutkrustige Schnitte am Kinn zurückgelassen und den neumodischen Stehkragen beschmutzt.
„Hast du dich duelliert?“ fragt Albert, um Heiterkeit bemüht.
„Quatsch!“ zischt der Bruder und rückt dicht heran. Sein unreiner Atem geht heftig.
Er flüstert scharf: „Ich muß die Perle haben!“
„Welche Perle?“
„Der dicke Boß hat mir’s erzählt.“
„Sie ist nichts wert. Wieviel brauchst du?“
Joseph saugt an den schadhaften Zähnen, zupft sich an den früh ergrauten Bartkoteletten: „Albert, die chilenischen Obligationen! Eine goldige Chance. Ich hatte alle Trümpfe in der Hand.“
„Und ich hab’ dich gewarnt.“
„Du hast gut reden, hast dich bei dem smarten Carr ins Nest gesetzt. Aber ich muß zahlen. Das sind Ehrenschulden wie beim Spiel, Albert, davon verstehst du nichts. Wechsel. Und kann nicht. Gib mir die Perle! Ich weiß, was drinsteckt. Rasch und schmerzlos ...“
„Hier, Joff!“
Albert hat die Brieftasche gezogen, greift wahllos ein Bündel Scheine heraus, drückt sie dem Bruder in die zitternd zuschnappende Hand: „Reicht das?“ Joseph läßt gierig den Daumen über die Kanten der blauen Lappen gleiten: „Ist das dein Geld, Bruderherz?“
Es klingt hilflos und mißgünstig, und das kurze „Ja“ löst nur ein „Unglaublich!“ aus, das von der Geste eines Grandseigneurs begleitet wird, der soeben eine lästige Gnadenbezeugung entgegenzunehmen hatte. Ach, Albert kennt ihn so gut, weiß um den empfindlichen Stolz des Bruders. Sind sie einander darin nicht ähnlich?
„Wenn du mehr brauchst ...“, sagt er freundlich.
„Keine Sorge, Albertchen!“
Der Bruder hat nun nicht länger Lust, im Hofeingang den Verkehr zu behindern und neugierige Blicke auf sich zu ziehen; es klingt mißbilligend und beugt einer Einladung ins Kontor, zur Witwe Reimers oder in ein Lokal vor. Den Hut mit zwei Fingern antippend, sagt er gönnerhaft über die Achsel: „Ich zahl’s doppelt heim, Lieber. Laß Dir’s aber gesagt sein, einzig die fluktiblen Reize der Papiere, das ist Gentlemanskunst und doch wohl etwas anderes als dieser dein Umstand hier und Plunder, mit dem du deine paar Kröten zusammenläpperst. Gehab dich wohl!“
Im Passageraum sind zwei Angestellte damit beschäftigt, die Formalitäten für die Ausreisenden zu erledigen. Die Bettplätze fürs Zwischendeck werden hier verteilt. Ihre Nummern stehen groß auf farbigen Kärtchen, rot für Männer, blau für alleinreisende Frauen und Mädchen, grasgrün für Familienmitglieder. Auch werden zugleich die Marken zum leihweisen Empfang einer Wolldecke ausgegeben. Albert Ballin, noch benommen von dem Gespräch mit dem Bruder, kehrt an sein Pult zurück. Mit abwesendem Blick faßt er auf, daß der Andrang im Abfertigungsraum abgeflaut ist. Nur die Stimme eines seiner Angestellten klingt wendig und geschult von nebenan. Von der langen Schlange der Passagiere des Morgens sind nur noch zwei oder drei übriggeblieben. Ballin blickt auf die Uhr. Es wird Zeit, zum Sandthorkai hinüberzufahren, um den fälligen Dampfer nicht uninspiziert zu lassen und dem Kapitän und den Offizieren einen Händedruck, der Besatzung und den Fahrgästen ein ermunterndes Abschiedslächeln zu gönnen. Reeder Carr läßt sich seit längerem bei den Abfahrten nicht mehr blicken. Er hat sich einen Rennstall zugelegt. Selbst Leute, die eigentlich nicht zu seinem Ressort der Passage und Fracht gehören, wenden sich an Ballin, Ausrüstungsfirmen, Werftdirektoren, ja selbst die Besatzungsmitglieder der Schiffe.
„Man müßte eine eigene Reederei haben“, denkt er und starrt aufs Pult. Wunderbare Schiffe malen sich auf die blauen Flächen eines Konossements über die Frachtorder auf dreizehnhundert Stück gußeiserne Christbaumfüße für Philadelphia via New York.
Der Angestellte lugt durch die breite Wandöffnung herüber und fragt dezent: „Herr Ballin, eine Anfrage: Eine Fahrkarte nach dem Paradies ... Wie erledigen wir das?“
„Höflich, wie immer! Paradies der Freiheit, die USA.“
Sein Blick hat sich nicht vom Pult erhoben. Christbaumfüße für Philadelphia, rechtzeitig bestellt. In wenigen Monaten werden Tannenbäume und Kerzen hinzukommen, dort drüben, und Familienglück und Kinder und Vergessen. Vergessen? Und Möglichkeit für jedermann, der Mut und Geschick hat und keine Anstrengung scheut. Wie er.
Mit halbem Ohr hört er, wie der Angestellte die strikte Anweisung, Kunden unter allen Umständen wie zukünftige Millionäre zu behandeln, befolgt und in sanftem Tone sagt: „Nicht die ‚Australia‘, gnädige Frau? Ganz, wie belieben. Verwechseln doch nicht mit der ‚Austria‘, die irgendwann mal unterging? Nein, gewiß nicht, dieselbe gehörte auch nicht uns, sondern der Packetfahrt.“
„Was nichts gegen die Konkurrenz besagt haben soll!“ korrigiert Ballin freundlich von seinem Pult aus, ohne aufzusehen. Er ist noch immer wie gelähmt und starrt auf das blaue Frachtpapier voller Visionen. Gerade ist er in einer dritten Schicht des Bewußtseins zu der Einsicht gelangt, daß Herr Georg Gustav Rauert ihm Marianne nie und nimmer geben könne. Denn ist er, hier am Pulte so verloren mit offenen Augen träumend, trotz angestrengter Gepflegtheit einem gewissen Joseph nicht allzu ähnlich, ein „Sadduzäer“ von dürftigem Äußeren, ohne Vermögen, voll großer Pläne, mit recht unbestimmter Aussicht auf Erfolg, ohne Familie von Ruf und in einem Beruf der Schiffahrt, der nur gesellschaftsfähig ist, wenn man als Inhaber der Firma zeichnet und nicht nur eine Agentur besitzt. Wie hat er auch nur so verrückt sein können, sein „salomonisches“ Auge auf eine Hanseatin aus gutem evangelischem Hause zu werfen, auf ein gebildetes und begütertes Mädchen, das auch noch blond und blauäugig ist und ihn, dank ihrer hohen Absätze nach Pariser Mode, an Körpergröße um mehrere Fingerbreit übertrifft? Daß er jünger ist als sie, wird er mit Disraeli und dem kommenden Kaiser Wilhelm II. gemeinsam haben. Er sieht sie vor sich, wie sie strahlend, in Seide und Geschmeide vor der Gesellschaft glänzt, in ihrer Loge der Oper, auf Bällen und Empfängen, zu denen er bislang keinen Zutritt hatte. Er sieht sich selbst an ihrer Seite im Frack von tadelloser englischer Façon. Immer wird sie ihn überragen, ihr blondes Haar wird wie eine Sonne über seinem dunklen Haupte leuchten. Fürwahr, kein abschätzender spöttischer Blick, kein Nasenrümpfen wird ihn kränken.
Und zwischen diesen rasch wechselnden Bildern geistern immer die riesigen Schiffe seiner Träume, neben ihr als Braut und sich als Bräutigam im Donnergetöse der Kirchenorgel von St. Petri. Er hat sich in den letzten Wochen die Hamburger Hauptkirchen von innen besehen. Mehr bedrückt als bewegt hat es ihn, zu erfahren, was aus dem Tempel Salomons und der Verehrung des Wüstengottes Jehova in Europa und hier im kühlen Norden hervorgegangen ist. An fünf Sonntagen hat er fünf verschiedene Predigten angehört voll von Zitaten aus Psalmen und Geschichten seines Volkes. Er hat kein Heimatrecht dabei verspürt und keine Hoffnung darauf bei denen, die von Zion und den Propheten mit salbungsvollem Anspruch wie Verwaltungsbeamte reden. Und er hat im Neuen Testament gelesen, alles, was über seinen „Landsmann“ Jesus aus Nazareth berichtet wird. Es hat ihn ergriffen.
O ja, das ist ein Mensch, der Mensch an sich, nach hohem Plan, anständig und tapfer, aufrichtig, weitschauend, feinfühlig, naturliebend und den Mühseligen und Beladenen zugetan. Aber dann sind andere gekommen und haben damit einen flotten Betrieb organisiert, einen Seelenhandel, ein weltumspannendes Geschäft, das zu vielerlei Trost, Güte und Aufschwung geführt hat und zu nicht minder großer Gewalttätigkeit. Der Messias, für den jener Christus sich kaum gehalten, war als Gescheiterter zu ungeahnten posthumen Erfolgen gediehen. Sein Weltreich bestand nun bald zweitausend Jahre und hatte alle anderen überlebt. Seine guten Lehren gipfeln in der Mahnung an die Welt, mit sozialen Reformen zu beginnen. Aber Jünger und Apostel haben die schlichten Forderungen mit allerlei Mystik verdunkelt. Hier an der Wasserkante spuken ältere Geister. Das „Blut des Lammes“ hat sich nie ganz mit den Fluten nordischer Häfen vertragen. Und der Erlösungsgedanke, die Reinigung von allen Sünden allein durch den Glauben deucht dem jungen Ballin – er flüstert es nur ganz heimlich, gleichsam geduckt – ungeheuerliche, durch nichts weder zu erhärtende noch zu widerlegende Propaganda.
In der Freien und Hansestadt hat man sich immer mehr auf die schlichte Erfahrung verlassen, daß der Gute belohnt und der Böse bestraft wird. Fraglich bleibt nur, was unter „böse“ und „gut“ zu verstehen sei, vor allem bei den Gläubigen selber. Entscheidet darüber wirklich nur das eigene Gewissen? Wer kann denn das Echo ertragen, das die Wände des Zimmers von dem angstvollen Schlag des Herzens zurückwerfen? Vielen sind die Ohren ohnehin verstopft. Die einen suchen den Lärm, der es übertönt, die anderen flüchten in Vereine, Zirkel und Kirchen. Wohl dem, der schlicht genug bleibt, sein Maß in sich selber zu finden. – Solche Betrachtungen steigen diesen Morgen wie von allein aus den trockenen Sätzen des Frachtbriefes auf von dem verbrauchten Pult, das schon die sorgenvollen Seufzer des Vaters ins Holz gesogen. Worte wie Stückzahl, Verpackung, Tara, Christbaum, Füße, Zoll, Ladegebühr, Bestimmungsort, Abnehmer verwandeln ihren Sinn in Träume, die zwischen Himmel und Hölle auf und nieder steigen.
Was wünschen Sie denn? Wollen Sie auswandern? Das waren die ersten Worte, die Marianne ihm gegönnt. Jetzt weiß er es: Er wird stets zu denen gehören, die immer dabei sind, auszuwandern, stets aus dem Vorhandenen in ein Neues, ein Unbekanntes unterwegs und aus der vertrauten Heimat auf dem Sprung in die unbekannte Fremde.
Ist eben nicht das Wort „Freiheit“ gefallen? Gibt es das? Es gibt nur freiwillige Bindungen. Die Lösungen bleiben ungewiß.
Nebenan, hinter dem langen Abfertigungstisch, spricht schon lange eine Frauenstimme. Der devot gekrümmte Rücken seines Angestellten verdeckt die Sprecherin. Aber man vernimmt deutlich, was sie sagt: „Mein Herr, es ist wohl besser, ich rede mit dem Chef persönlich.“
Der Angestellte tritt höflich zurück und blickt zu Ballin hinüber. Der erhebt sich und geht wie auf Watte in den Abfertigungsraum. „Ja, bitte“, hört er sich mechanisch sprechen.
Das Gesicht der Dame ist durch einen violett-grauen Schleier verhüllt. Die Stimme klingt wie verstellt darunter hervor: „Wie ich schon betonte, erwarte ich kein Billett in das Paradies der Freiheit, sondern in das der Unfreiheit.“ Hinter Ballins Stirn blitzt für einen Moment die Frage auf, wer nun eigentlich verrückt sei: er, der am hellichten Tage Träumende, oder die exaltierte Weibsperson hinter dem Tresen. Er tastet sich vorsichtig weiter: „Meinen Sie vielleicht Rußland? Dahin haben wir zur Zeit noch keine Verbindungen.“
Auf einmal aber geht ihm auf, wer sich hinter dem Schleier verbirgt, aber er verrät sich nicht.
Und da sagt Marianne ganz leise, so daß es kein anderes Ohr mehr erreicht als das seine: „Ach nein, ich meine eine ganz private Unfreiheit.“
Mit einem Schlage ist er hellwach, aber seine Beine sind wie aus Gummi. Er schickt den Kommis in den Lagerraum. Dann erwidert er mit gespieltem Ernst: „Madame, Sie verlangen Unmögliches von unserer Reederei; wir treiben keinen Sklavenhandel.“
Die Dame genießt es, ihn so beherrscht zu finden, dann lüftet sie den Tüll und lacht hell. Sie beugt sich über die dunkle, glattgewetzte Passageschranke. Der Stoff ihres Sommermantels berührt seine Hände. Und durch die Zähne flüstert sie ihm zu: „Und wenn ich lauter schwarzlockige Jungs mit Schnurrbärten kriege – ich heirate dich doch.“
*
Herr Wuttke, der geschmeidige junge Prokurist des Juweliers an der Ecke vom Neuen Wall und dem Jungfernstieg, hält eine erbsengroße Perle unter die goldgefaßte Lupe. Er hebt die Augenbrauen und zieht bedenkliche Stirnfalten. „Außer Frage, Herr Ballin – echt ist sie“, sagt er verbindlich und wiegt das leichte Etwas in der Hand. „Aber das Stück ist höchst geschickt aus zwei Hälften zusammengesetzt und offenbar hohl, wahrscheinlich mit einer Art Flüssigkeit gefüllt.“
„Also doch. Kann man nicht trotzdem eine Nadel daran befestigen?“
Wuttke untersucht abermals, er nimmt ein Mikroskop zur Hilfe, das Ergebnis ist befriedigend. Die Höhlung scheint nicht gleichmäßig, ein Teil der Wandung ist somit hinreichend dick, um ein feines Bohrloch aufnehmen zu können.
„Das Übrige ist höchst zerbrechlich, Herr Ballin. Die Ausgabe lohnt sich kaum.“
„Es ist ein Andenken, Herr Wuttke.“
„Dann ist es eo ipso teuer und berechtigt zu allem Weiteren. Außerdem, wirklich, der Glanz hat sich auffallend gut erhalten, wenn man bedenkt, daß diese Perle einige hundert Jahre alt sein dürfte.“
„Es soll eine Indianerperle sein.“
Wuttke nickt. Er ist ein Mann von Erfahrung. Gleichwohl lockt ihn noch immer das Abenteuerliche an dem Handel mit Pretiosen. „Das dachte ich gleich“, erwidert er prüfenden Seitenblicks auf den kleinen dunklen Herrn, der ihn, den Kopf lauschend geneigt, aus funkelnden Pincenezgläsern beobachtet. „Eine Majaperle, Herr Ballin. Wissen Sie auch, daß der Inhalt lebensgefährlich sein könnte? Ich würde vorschlagen, ihn bei der Montage vorsichtig zu entfernen.“
„Gerade das möchte ich vermieden sehen und bitte, die Nadel nur in meiner Anwesenheit einzufügen.“
Wuttke verbeugt sich. Der Kunde ist überall König. Und er bittet Herrn Ballin in die Werkstatt.
Während der kleinen Prozedur weiß er fesselnd zu plaudern. „Sehen Sie, vor Jahren – ich war noch Lehrling – kommt eines Tages ein statiöser Herr, Haziendenbesitzer vom Scheitel bis zur Sohle, in den Laden und bringt genau so eine Perle, um sie fassen zu lassen. Er hatte einen Hund mit, eine Dogge, grau-gelb, dänisch, hoch wie ein Flußpferd. Der Chef untersucht die Perle und zuckt die Achseln: Tut mir leid, damit möchte ich nichts zu tun haben. Der Grande, erstaunt, bittet, den Wert zu schätzen. Aber der Prinzipal schüttelt den Kopf. Nichts wert? braust der Señor auf. – Liebhaberwerte entziehen sich der Notierung, entgegnet der Chef verbindlich und reicht das Stück zurück. – Da, friß! ruft der Haziendero verächtlich. Und ehe man ihn hindern kann, wirft er die Perle seinem Hunde in den vertrauensvoll aufgesperrten Rachen. Was soll ich Ihnen sagen, Herr Ballin? Ehe noch der Kunde, sich kaum verabschiedend, die Ladenschwelle überschritten hat, fällt das riesige Hundevieh plötzlich um, ohne jeden Laut, streckt alle viere von sich und ist mausetot!“
„Interessant“, sagt Ballin leichthin. „Man kann nie wissen, ob man das eines Tages nicht mal brauchen kann.“
„Mein Prinzipal hatte bewußt vermieden, zu betonen, daß eine Firma unseres Ranges niemals Hilfestellung leisten sollte bei dem Spiel mit dem Gedanken an Mord oder Selbstmord.“ Der Juwelier hat eine Uhrmacherlupe ins Auge geklemmt und betrachtet seinen Kunden durch dieses drohende Magierauge.
Ballin lächelt: „Sie vergessen, Herr Wuttke, daß jede Art von Schmuck Anreiz zum Verbrechen in sich trägt und daß – Hundemord gegebenenfalls eine höchst wohltätige, jedenfalls aber ganz und gar persönliche Angelegenheit sein kann, obschon derartiges weder für Sie noch für mich jemals in Betracht kommen dürfte.“
„Selbstredend, Herr Ballin. Diese Majaperlen müssen übrigens äußerst geschickte Hersteller gehabt haben. Denn der ausgebohrte Hohlraum ist, wie die Forschung festgestellt hat, mit einem harzigen Lack unbekannter Herkunft aufs feinste ausgepinselt, so daß der Inhalt die Perlwandung keinesfalls angreifen kann. Kalziumkarbonat, als Kesselstein bekannt und für uns nur lästig, als Marmor begehrt, als Perle eine Kostbarkeit, hat das Zeug zu ebenso verblüffender Karriere wie Steinkohle und Ruß zum Diamanten. Derartiges soll auch bei Menschen Vorkommen. Die Struktur macht es und die Seltenheit. Die Perle ist meergeboren und sozusagen lebendig gezeugt, sie hat entschieden etwas Unheimlicheres als ein erdgeprägter Diamant. Man sagt gern: Perlen bedeuten Tränen. Als Juwelier darf ich freilich so etwas nicht nachsprechen.“
„Es gibt auch Freudentränen, Herr Wuttke.“
„Richtig! Möge auch Ihr Kleinod, Herr Ballin, nie von anderen feucht werden.“ Seine geschickten Finger hantieren mit winzigen Werkzeugen. Dann hebt er wieder den Blick. Die Uhrmacherlupe wie eine Pistolenöffnung auf sein Gegenüber gerichtet. Und als gälte es ein Geschäft auf Gegenseitigkeit in Gang zu bringen: „Ich habe eine Schwäche für alles Gefährliche. Ich bin Sportler. Die Riesenwelle am Reck ist mir ein besonderes Vergnügen, denn wenn man losläßt, kann man das Genick brechen. Ich sehe in dem Wasser dieser Perle, in ihrer seltsam durchstrahlten Taubheit, möchte ich sagen, den Schmelz einer jahrhundertelangen Verhinderung. Nicht wahr? Einer Aufgespartheit geradezu. Als die tote Dogge schon fast vergessen war, kam eines Tages ein gewisser Doktor Seler herein, der bekannte Mexikoforscher, eben im Begriff sich nach drüben einzuschiffen. Er kaufte ein Tafelbesteck, weil ihm das an Bord gebotene nicht zusagte.“
„Bei der Hamburg-Amerika Linie?“
„Ja, bei der Hapag, Westindiendienst.“
„Muß besser werden“, murmelte Ballin.
„Wie meinen?“
„Fahrgäste sollten sich wie zu Hause und noch besser fühlen.“
„Sie waren viel unterwegs?“
„Ich bin von der Schiffahrt, Herr Wuttke.“
„Das ist gut, wir würden das Bordsilber zu entsprechenden Bedingungen mit Vergnügen liefern. Ein Alpaka ungewöhnlicher Qualität und wirklich preiswürdig.“
„Sie wollten von Dr. Seler erzählen, Herr Wuttke!“
„Richtig. Der Doktor sagte, als unser Gespräch darauf kam, solche Majaperlen seien bevorzugten Opferjünglingen von Priesterhand heimlich in den Mund gegeben worden, ehe ihnen das Herz bei lebendigem Leibe aus der Brust gerissen wurde. Die so Ausgezeichneten konnten dann nach Belieben zögern, die tödliche Giftdosis zu schlucken, wenn es ihnen darauf ankam, gottgefälligerweise die schauderhafte Tortur wachen Sinnes ganz auszukosten.“
„Schlucken allein dürfte wohl nicht genügt haben.“
„Seler meinte, Versuche hätten ergeben, daß die Magensäure diese Sorte Perlen in Sekundenschnelle aufzulösen vermag. Der Tod träte fast augenblicklich ein. Schlagartige Lähmung des Kreislaufs. Aus. Wie bei der Dogge. Nicht wahr? Beinahe beneidenswert.“
„Für allerletzte Not.“ Ballin flüstert es lächelnd, mit geschlossenen Lidern. Er sieht sich ausgestreckt voller Heiterkeit auf einer Wiese zwischen lauter Löwenzahn und Gänseblumen und Mariannens Gesicht neigt sich erschrocken über ihn. Wie gut, daß er nicht voreilig gewesen ist, dann wäre es nicht Marianne, sondern die hamsterbackige Witwe Reimers, die sich über seine Starre gebeugt, und der unechte Perser ihres Logiszimmers wäre schwer mit einer Sommerwiese zu verwechseln. Aber nun hat sich alles von Grund auf gewandelt. Ein Häuschen steht bereit, es lohnt sich ungemein, dem Dasein schrankenlos zu vertrauen. Lange Jahre großer Segen, spricht eine alte milde Stimme in ihm.
„Herr Wuttke“, sagt er und schlägt die Augen so jählings berauscht auf, daß es dem Juwelier, der die eingepaßte Nadel gerade elegant präsentiert, wie ein Schreck durch Mark und Knochen fährt und er beschwörend herunterhaspelt: „Beste Präzisionsarbeit, mein Herr, sowohl für Kravatte geeignet wie fürs Chemisett. Hier haben Sie die einfache kleine Sicherung. Unser Patent. Wollen Sie gleich anlegen? Darf ich mal? ... So! Ausgezeichnet.“ Er rückt einen venetianischen Kristallspiegel heran: „Nicht wahr?“
Ballin blitzt ihn dankend an. „Ich brauche eine weitere Sicherung, Herr Wuttke. Wissen Sie, so ein paar kleine runde Miniaturhandschellen, um mich selbst für den Rest meiner Tage an die Kette zu legen.“
Wuttke, alsbald verstehend, versichert voller Erleichterung: „Auch das in jeder Ausführung. Möchten wir uns in die Offizin zurückbequemen? Darf ich übrigens hören, ob die kleine Uhr damals soweit gefallen hat?“
„Gewiß, gewiß!“ lächelt Ballin, erhebt sich und zückt den eigenen Chronometer, dessen Tombak, wie Wuttkte mit wohlgeübtem Blick feststellt, sicher demnächst durch ein hanseatisch echt goldenes Exemplar mit Sprungdeckel und Repetierwerk zu ersetzen sein wird.
„Sie belieben das Maß für die verehrte Zukünftige gewiß bei sich zu haben, Herr Ballin?“ fragt er und schlüpft leichten Fußes durch den roten Vorhang.
Gerade tritt eine Dame von draußen herein, Marianne. Sie ruft ungeziert in die weihevolle Lautlosigkeit von Sammet und Gefunkel: „Na, Albert, komm ich noch zurecht? Sind die Fesseln parat?“
Ballin strahlt: „En miniature und per sofort, Madam.“
Schon hat Wuttke eine Auswahl massiver Trauringe auf weißem Atlastablett über den Ladentisch gleiten lassen. Seine ergebene Miene läßt nicht vermuten, daß er sich dabei mokant selber fragt: „Hat nun diese blonde Kriemhild, weibliche Ausgabe des pompösen Goliath, den kleinen David hier zur Strecke gebracht oder umgekehrt?“
*
Die Hochzeit findet im engsten Familienkreise am 11. Januar 1883 statt. Marianne hatte nicht gedrängt, daß Albert sich taufen lasse. So hätte die standesamtliche Eintragung genügt, die durch Bismarck seit acht Jahren Gesetz war und jeder konfessionellen Beurkundung vorging. Da man aber in der schönen Villa des Generalkonsuls Rohlsen feierte, der Mariannes Schwester Bertha zur Frau hatte, war ihre Familie doch sehr erbaut, daß der hausbefreundete Pastor in der kleinen ehrwürdigen Dreifaltigkeitskirche zu Hamm dem jungen Paar seinen Segen nicht vorenthielt.
*
Ein paar Tage auf der Insel Helgoland, das ist die ganze Hochzeitsreise, aber sie genießen sie gebührend. Marianne schwelgt in lustigen Erinnerungen, und die Nordseeinsel, damals noch nächstgelegenes englisches Ausland, ist malerisch mit rotröckigen britischen Wachtsoldaten als lebendigen Gegenstücken zu den roten Felsen geschmückt. Nirgends kann man Champagner so billig und zollfrei trinken, und nirgends schmeckt der Hummer so gut wie hier.
Albert nennt das Eiland ein Schilderhaus, darin Britannien die Elbmündung bewacht, falls die Franzosen sich nicht länger im Zaum halten können, Elsaß-Lothringen zurückzuholen und Hamburg, wie schon einmal, als Kolonie zu kassieren.
„Mit ihren paar Kanonen können aber auch die Engländer von hier aus ebensogut unsere ganze Schiffahrt sperren“, meint Marianne.
„Grund genug, uns mit ihnen zu vertragen, Marianne. Wir haben mehr davon, wenn sie Helgoland behalten, als daß ein paar Schreihälse bei uns daraus ein kleines Außenfort gegen England machen und noch wunder was meinen, wie pfiffig und patriotisch das sein würde.“
Erst auf Helgoland erreicht sie ein Telegramm Cassels. Sein Glückwunsch klingt wehmütig: „Möge Ihnen beiden dauernder ein Glück beschieden sein als mir.“
„Das klingt ja fast tragisch, Albert.“
„Ernest Cassel hat seine Frau nur drei Jahre haben dürfen. Ich hab’ sie noch gekannt. Sie ist jung und frisch und blühend gewesen, wie vom Lande. Und blond wie du. Erst als sie im Sterben lag, von Schwindsucht aufgezehrt, und der Pfarrer ihr das Sakrament reichte – sie war katholisch – hat sie ihren Mann gebeten, er möge sich zu ihrem Glauben bekennen.“
„Warum das, Albert?“
„Sie fürchtete, ihn sonst im Himmel nicht wiederzusehen.“
„Das ist ja ein sonderbarer lieber Gott, der sich wie ein Zöllner oder Polizist einen Paß vorzeigen läßt. Hat ihr Mann denn konvertiert?“
„Wir haben nie darüber gesprochen. Ernest ist fünf Jahre älter als ich und hatte es immer schon etwas weiter gebracht. Da verstummen die Fragen.“
„Und was würdest du tun, Albert?“
„Alles, was du verlangst.“
„Evangelisch werden?“
„Da ich weder an die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau und ihre leibliche Himmelfahrt noch an die Unfehlbarkeit des Papstes glauben müßte, wäre nur noch der Kannibalismus mit dem ‚Blut und Fleisch des Herrn‘ zu überlegen.“
„Selbst an meinem Sterbebette?“
„Marianne! Lieber will ich alsbald in der nächsten Brandungswelle gemeinsam mit dir ertrinken, als überhaupt jemals denken, daß du mich allein lassen könntest.“
Und nun stürzen sie Hand in Hand in den sprühenden Gischt der Dünenkante. Sie schreien vor Übermut und Lebenslust und kommen rechtzeitig wieder heraus, um sich mit dem Fischerboot zurück auf die ragende Insel und zum Frühstück tragen zu lassen.
Mochten ihre oder seine Vorfahren herstammen, wo immer die Welt rund ist: Sie beide waren in Hamburg geboren und aufgewachsen. „Wir sind nüchterne Hanseaten“, sagte Marianne, „und lassen uns nicht mit Phantastereien und Vorurteilen aufhalten, sondern suchen selbstverständlich den Tatsachen das Nützliche abzugewinnen.“
Sie sprach mit fast geschlossenen Lippen. Die Zähne der Hamburger sind immer etwas zusammengebissen wie von unbewußter Konzentration oder bewußter Energie. Denn jedermann an dieser Weltecke ist immerzu auf dem Quivive, sozusagen auf Ausguck, stets in Habacht und mit steifgehaltenen Ohren, um nicht abgeschleudert zu werden von der Taumelscheibe in dem unaufhörlichen Sog des lautlosen klimatischen Wirbels, der vom Atlantik, golfstrombefiebert, herüberreicht.