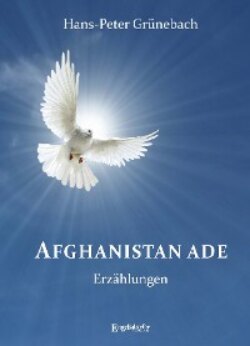Читать книгу Afghanistan ade - Hans-Peter Grünebach - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANGST IN KABUL
ОглавлениеWenige Tage nach Ankunft erkundete Stefan mit Kameraden einen Bergsattel westlich von Kabul.
Die Auffahrt bewachten afghanische Wachen in zivil.
Einer trug eine lange Flinte.
Der Bewaffnete hatte einen verwaschenen Leinen-Kaftan an und trotz der Hitze einen Woll-Pakol auf dem Kopf. Sein von einem schwarzen Vollbart umrandetes, sonnengegerbtes Gesicht trug verwegene Züge. Die schwarzen Augen wirkten düster. Sein Alter war nicht schätzbar.
Er saß auf und begleitete den Trupp die Serpentinen hinauf.
„Bei Regen oder Schneeschmelze spült es die an den Hängen verlegten Minen auf den Schotterweg.“
Dolmetscher Selim sagte:
„Wenn wir auf ‚Höhe 2200‘ ankommen, seht Ihr die Panzerwracks und Stellungsreste von Massuds Truppen.“
„Überbleibsel vom Bürgerkrieg“, ergänzte Stefan.
Oben angekommen hatten sie Blick auf die weiße Hindukusch-Bergkette.
„Gigantisch“, fand Stefan.
Von der Bergspitze hatte er Rundumsicht.
Im Norden vermutete er unter der Staubglocke den Vorort Paghman.
Von diesem hatte ihm ein Flüchtling daheim erzählt: Mosaik-Springbrunnen, sattes Grün und Obstgärten sollen das Bild geprägt haben.
Stefan spürte und sah nur Staub, dem man sich nicht entziehen konnte.
Der erste Schnee ließ hoffen.
Der Blick nach Osten zeigte kein „schimmerndes Kabul“ mit „prächtigen Häusern und Minaretten“, sondern eine mehrere hundert Meter dicke Smog-Glocke über einer Millionen-Ruine.
Das waren Stefans Eindrücke.
Der Trupp fuhr zurück ins Lager.
Auf dem Weg dorthin passierten sie das Nadelöhr zwischen TV-Hill und Kabul-Fluss.
Links und rechts Bazare, ein Kamelmarkt, Menschen in einem beängstigenden Wirrwarr von Gewändern, Kopfbedeckungen, Verformungen.
Militärfahrzeuge waren weithin erkennbar; Ausländer Zielscheibe.
Stefan sagte zu Felix, dem Fahrer: „In dem Verkehrschaos haben wir keine Chance.“
Hupende gelbe Taxis, überfüllte Minibusse, Schubkarren mit Waren, Eselstransporte, Toyota über Toyota, stinkende Lastwägen, Ochsenkarren, Lastenkamele und Militärfahrzeuge machten einander die Spur streitig.
Immer wieder Stillstand.
Stefan hatte Angst.
Im Stau schaute er nach rechts: „Achtung Felix. Der Fahrer des Schrott-Toyotas neben uns hat einen Revolver auf dem Schoß, der Mann im Fond ein langes Messer in der Hand.“
„Ich muss fahren“, murrte Felix.
Der mit der Pistole sprang plötzlich aus dem Auto und rannte nach vorn.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrte der Revolvermann ans Steuer seines Wagens zurück, ohne dass sie einen Schuss gehört hatten.
Sie schoben sich in Zentimeterabständen zu anderen Verkehrsteilnehmern Stück für Stück weiter.
Fast überfuhren sie einen Beinamputierten, der auf einem Rollbrett um Almosen bat.
Danach bettelte sich eine schwarze Witwe, auf den Knien rutschend, zwischen den Autos durch.
Später bettelten Kindern sie um Geld und Wasserflaschen an.
Wie in einem Open-Air-Kino zog der Film an Stefan vorbei.
Er betrachtete sich darin als Statist in einem Weltendeszenario.
Irgendwann öffnete sich der Trichter.
Sie erreichten einen zentralen Platz.
Dort bändigte ein Schupo die chaotischen Schlangen.
„Für die Verkehrspolizisten ist der Dienst extrem ungesund“, meinte Felix trocken.
„Möchte nicht tauschen“, erwiderte Stefan von der Hitze ermattet.
Wie Windräder kreisten die Schupos mit den Armen. Dazu bliesen sie mit aller Kraft in ihre Trillerpfeifen, um sich Gehör zu verschaffen und versuchten, mit roboterhaften Körperdrehungen die unfolgsamen Verkehrsteilnehmer zu dirigieren.
“Das ist Leistungssport bei Niedriglohn und garantierter Staublunge. Ob sie abgelöst werden?“
Felix wusste es nicht.
„Die Schupos sind derzeit für Kabul unverzichtbar. Die alten Siemens-Ampelanlagen sind in Reparatur, hab ich gelesen.“
Ein Ruck. Stefans Gurt hielt ihn.
„Verdammte Schlaglöcher“, fluchte Felix.
Sie verließen das Zentrum Kabuls.
Stefan blickte auf verfallene Häuser mit selbstgebastelten Fernsehantennen, Kinder ohne Schuhe, Baumstümpfe statt Bäume, Lehmkaten mit Abwasserrinnen auf den Staubpisten davor, ab und zu eine neue Wasserpumpe.
Später zogen zusammengestückelte Zeltdächer auf den Feldern an ihm vorbei.
Endlich erreichten sie die Wache des Lagers.
Die Posten befanden sich in ständiger Angst vor Selbstmordanschlägen. Stefan auch.
Selbst im Lager fühlte sich Stefan nicht sicher.
Eines Tages pfiff eine Katjuscha-Rakete direkt über das Zelt, in dem er mit Kameraden gerade Karten spielte.
Sie mussten wegen dieser verrückten Taliban-Kämpfer für zwei Stunden in die Bunker.
Mit den Methoden der Taliban war Stefan theoretisch vertraut: Die Illegalen nutzten selbstgebastelte Abschussrampen. Die konnten sie bei Dunkelheit in Stellung bringen und grob ausrichten.
Selten gab es deswegen Volltreffer.
Doch er wusste auch, dass die Katjuscha in der Altstadt von Kabul während des Bürgerkriegs großen Schaden angerichtet hatten. Auch waren sie schon in Camps der internationalen Schutztruppe eingeschlagen.
Stefan hatte gesagt bekommen, dass die Hauptstadt Afghanistans für Zivilisten nicht unsicherer sei als Städte wie Frankfurt, Berlin oder München.
Das Angriffsziel des Taliban war nicht die afghanische Zivilbevölkerung, sondern ausländisches Militär.
Der Taliban kämpfte gegen die USA und gegen deren Verbündete.
Er sah fremde Streitkräfte als Besatzer, und auch alle, die mit diesen kooperierten.
Stefans Nachbar Karim, der aus Afghanistan stammte, hatte ihm die Angst zu nehmen versucht:
„Denk immer daran, dass Amoklauf in Schulen, Rassenhass und Misshandlung von Ausländern in den USA und in Europa zu Hause sind. Fragt euch stets, ob die Pflaster in Madrid, London und Paris sicherer sind. Vergesst nicht die Anschläge auf die Madrider Vorortzüge, die auf die Londoner Metro, die Opfer beim Oktoberfest in München und die Bomben, die in Europa noch explodieren werden!“
Ein alter Mann aus Stefans Nachbarschaft, selbst noch Kriegsteilnehmer, mahnte jeden, der es wissen wollte:
„Wer nach Afghanistan geht, muss sich der Gefährdung durch Terroristen und kriminell motivierte Gewalttäter stets bewusst sein!“
Stefan hatte gut zugehört.
Gerade deshalb hatte er Angst.
Von seinem afghanischen Bekannten war Stefan vor Hauptübeln gewarnt worden:
„Kabul ist mit seinem Sammelsurium an Binnenmigranten, Armut, Menschenmassen, Arbeitslosigkeit, dem Mangel an menschenwürdiger Unterbringung, Gemeinschaftsinfrastruktur und Hygiene außer Kontrolle.“
Er fragte: „Wer weiß denn überhaupt, wie viele Menschen dort leben, zwei Millionen? Drei Millionen? Mehr?“
Stefan hatte die Antwort nicht.
Aber er ist mit hohem Aufwand ausgebildet worden.
Und er hatte sich durch viel Lesen auf den Einsatz vorbereitet.
Der Aphorismus „Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen“ war einer der Buchtitel.
Allah oder Gott hatten zugelassen, dass in vielen Jahren Krieg aus ursprünglich grünen Oasen Wüsten wurden.
Stefan konnte sein Gastland nicht mit dem Herzen sehen.
Für die Errungenschaften Afghanistans war er nicht reif. Dichtung und Musik hatten in Afghanistan eine Tradition von fünftausend Jahren.
Für Stefan stand das im Vordergrund, was er sah.
Das waren zerstörte Viertel, arm aussehende Menschen, Lehmhütten am Rande der Straßen und die Zelte der Kochi, der Nomaden.
Er konnte sich nicht vorstellen, ob die Menschen glücklich oder unglücklich waren.
Nur die Kinderaugen, die sprachen Bände.
Die Kinder lachten und freuten sich über Kleinigkeiten, wie überall sonst auf der Welt.
Stefan fehlte der Vergleich.
Er konnte die Wiederaufbauleistungen, die Helfer zustande gebracht hatten, erahnen.
Stefan wusste von der Improvisationskunst der Afghanen.
Ihr Multitalent war bekannt.
Viele Kabuli buken ihr Fladenbrot selbst und ernährten eine Großfamilie davon.
Sie fertigten Lehmziegel und errichteten daraus Häuser; nicht immer an genehmigten Orten.
Die Einrichtung war handgefertigt.
Sie bohrten nach Wasser, schlachteten Vieh und gerbten Leder.
Sie nähten ihre Kleidung selber.
Das Familienauto war aus Schrottteilen zusammengesetzt, die Schuhe waren selbst gefertigt.
Stefan kannte keinen Deutschen, der über all diese Fertigkeiten verfügte.
Stefan wusste, dass die Besserverdienenden ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung waren.
Die Vielfalt der Menschen war es, die das Land prägte.
So unterschiedlich die Kleidung von Paschtunen, Tadschiken, Usbeken, Hazara usw. war, so unterschiedlich waren auch Sprache, Dichtung, Musik, Tradition und die überlieferten Fertigkeiten.
Diese Kenntnisse, von Alt zu Jung weitergegeben, faszinierten Stefan.
Er verstand, dass Kinderreichtum unschätzbares Kapital für Afghanen war.
Er erkannte, dass das Leben für Kabuli unbeschwerter war, als er vermutet hatte.
Das Miteinander der Menschen war stärker von gegenseitigem Respekt und Interesse geprägt als das bei ihm daheim.
Man kümmerte sich in Kabul mehr um den anderen.
Stefan ließ sich durch einen englischsprechenden „Local“ im Camp aufklären:
„Die täglichen Bedürfnisse der Menschen in Afghanistan sind niedrig. Was für die Städter der Fernseher, ist auf dem Land ein Radioempfänger. Fernsehen ist Luxus. Der Familienverband ist die Altersvorsorge, zugleich Sozial- und Krankenversicherung. Wer Arbeit habe, sorgt für die Angehörigen, gemäß Generationenvertrag.“
Ein anderer Arbeiter in seinem Lager klärte ihn über Bettelei auf:
„Wenn sich keine Familie mehr kümmert, dann gilt das Gebot des Korans. Den Armen muss durch Almosen geholfen werden. Bettler werden niemals abgewiesen. Betteln ist in Afghanistan keine Schande.“
Im Norden des Landes verloren zwei Soldaten ihr Leben.
Die Stimmung war explosiv.
Stefan war auf Patrouille.
Es kam zu einem tragischen Vorfall an der multinationalen Kontrollstelle.
Ein Zivilfahrzeug, ein Toyota, folgte den Anweisungen nicht. Es fuhr, trotz Warnschüssen auf die Sperre zu.
Die „Sicherer“ feuerten bis das Fahrzeug stand.
Ein Familienvater hatte durchgedreht, die Regeln der Fremden nicht akzeptiert.
Er und eines der Kinder waren nicht zu retten; die Frau überlebte schwerverletzt.
Ein Kind war in Panik vom Fahrzeug weggelaufen.
Stefan hatte die Schreie jede Nacht im Ohr.
Dann war Stefan Posten für die Personenkontrolle vor dem Eingang zum Lager.
Hinter ihm zwei Kameraden, die ihn sicherten.
Es war ein nasskalter Tag und die Sicht getrübt.
Eine Gestalt unter einer Burka kam mit einem Paket auf dem Arm auf ihn zu.
Stefans Adrenalin-Spiegel stieg.
Er löste Alarm aus.
Der rechten Finger lag am Abzug seines Gewehrs.
Er war sich bewusst, dass das Gewehr ihn nicht retten würde, wenn die Person unter der Burka einen Sprengstoffgürtel trug.
Stefan glaubte, ein Kind auf den Armen „der Burka“ zu erkennen.
Er ließ die Trägerin oder den Träger näher herankommen.
„Die Burka“ antwortete auf Stefans energischen Anruf angstvoll:
„Please help!“
Eine Frauenstimme.
Sprengstoffgürtel?
Sie hob das Kind hoch.
Das Motiv ihres Kommens?
Ein Dolmetscher und eine Soldatin führten die Frau der mobilen Notaufnahme zu.
Die verzweifelte Mutter hatte für ihre schwerkranke Tochter das Militärlazarett gewählt.
„Ich habe viel Gutes über die deutschen Ärzte gehört“, sagte sie.
Das Kind konnte gerettet werden.