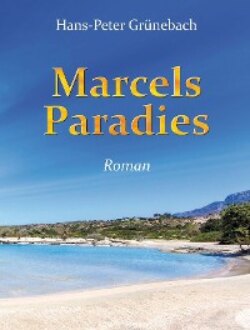Читать книгу Marcels Paradies - Hans-Peter Grünebach - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 4
ОглавлениеNachdem Marcel den begeisterten Charlie am folgenden Morgen bei der nicht so begeisterten Isabell abgeholt hatte, führte die Route die beiden Reisegefährten bei verträglichen Temperaturen über Zürich, Bern und Genf an den Lac d’Annecy und am nächsten Tag weiter, vorbei an der Metropole Lyon. Der 2 CV erklomm, mit geringem Appetit, das Massif Central. Hinter Clermont-Ferrant wurden sie beim Bad in einem Moorsee vom Regen überrascht, fuhren daraufhin ohne Pause über Tulle und Périgueux weiter bis Libourne, passierten den schönen »Tour de l’Horloge«, querten die Dordogne über die Eiffel-Brücke und bogen ab nach Saint Émilion.
Marcel liebte den Roten. Das hatte er von seinem Vater.
Der Campingplatz lag abseits vom mittelalterlichen Städtchen an einem Fischweiher. Grüne Wasserfrösche mit braunen Sprenkeln bliesen vehement Luft aus den Maulwinkeln in die Schallblasen und quakten, als wollten sie sich über das metallische Schlagen der Gestänge, das Hämmern auf Zeltheringen und das Rangieren von Wohnwägen beschweren.
Der an einem Burgfelsen zu kleben scheinende Ort mit seinen noblen Weinlokalen und dem »Chateau du Roi« ähnelte dem provenzalischen »Châteauneuf-du-Pape«, erinnerte sich Marcel.
Im »Logis de la Cadène«, an einer steil ansteigenden Gasse hinter Weinranken versteckt, ließ er sich eine Flasche vom Besten kommen. Er hätte das gesuchte Restaurant beinahe verpasst, wenn nicht aus dem Grün eine Tafel mit dem Namensschriftzug und einem farbigen Wappen wie ein Wegweiser in die Gasse geragt hätte.
Später blickte Marcel vom Steingeländer an der in den Felsen gehauenen »Eglise Monolithe«, unterhalb des wuchtigen Turms der Burgruine, auf das nächtliche Städtchen und kehrte, Charlie angeleint, über die engen Gässchen und auf ihrem verlebten Pflaster zum Campingplatz zurück.
Charlie hielt in dieser Nacht das Quaken nicht schlafen wollender Frösche wach. Auf sein Bellen reagierten sie nicht, aber einige Camper, die aus ihren Zelten murrten.
In Bordeaux ließ Marcel die »Ente« an der Esplanade des Quinconces zurück und machten sich mit Charlie zu Fuß auf, die Stadt zu entdecken.
Bis zur Place Gambetta, dem Zentrum, trugen die Straßen Züge wohlhabender Herrschaftsbauweise. Die Boulevards, das »Gran Theatre« und der Place de la Bourse unterschieden sich nicht von bekannten Stadtteilen der französischen Hauptstadt Paris, fand Marcel.
Ihm fiel auch auf, dass sich kaum Menschen auf den Straßen bewegten. Wochenenden hatten wohl auch in Bordeaux ihre Eigenheiten.
Als die beiden wieder im Auto saßen und auf der schnurgeraden Landstraße die waldreiche Ebene nach Arcachon durchquerten, reihte sich aus dem Nichts Karosse an Karosse, und Marcel verstand, wo all die Menschen waren. Sie waren offensichtlich aus der Hitze der Stadt ans kühlende Meer geflohen.
Am »Bassin« schienen alle verabredet gewesen zu sein, denn entlang der Corniche ging es nur im Schneckentempo, allerdings mit schöner Sicht; vorbei an schmucken Villen und Ferienhäusern.
Der Mündungstrichter hatte die gemächlich dahinfließenden Arme von Dordogne und Garonne in sich aufgenommen.
Ab jetzt hießen sie Gironde.
Die war schon den Gezeiten ausgesetzt; es war Ebbe. Der niedrige Wasserstand hatte den Blick auf ausgedehnte Schlick-Inseln freigegeben. Es roch nach Meer, Fisch und nach Faulgasen. Charlies Nase schnupperte am Beifahrersitz aus dem aufgestellten Kippfenster.
Im Hafen saßen Dutzende Boote auf dem Trockenen; erst die Flut würde sie wieder aus ihrer misslichen Lage befreien.
Da er sowieso im Stau stand und warten musste, nutzte Marcel die Zeit, von einer Telefonzelle aus Isabell zu erreichen. Auf dem Anrufbeantworter hinterließ er: »Wir sind gleich am Atlantik. Hast du deine Haltung geändert? Geh bitte ran – ich weiß, dass du da bist!«
Die Autoschlange schob und zog die beiden weiter auf der ›Route des Lacs‹ nach Pilat.
Hier erklomm Marcel zu Fuß Europas höchste Düne. Charlie folgte ihm auf dem sandigen Anstieg.
Majestätisch überragte die Düne mit hundertundsiebzehn Metern aufeinander gewehtem Sand den Küstenstreifen.
Der Atlantik und die von Kiefern festgehaltenen Dünen des Hinterlandes fesselten Marcels Blick. Er staunte, wie Wind und Sand die einst als Barrieren gedachten Pinienwälder wieder in Besitz nahmen. Nicht einmal die trutzigen Requisiten des zweiten Weltkrieges, die schwarzen Betonklötze des Atlantikwalls, würden den Naturgewalten noch lange widerstehen können. Sie lagen jetzt schon halb abgekippt in ihrem Grab.
Zwischen Pilat und Biscarosse schlug Marcel sich erleichtert mit seinem Hund für eine Abkühlung durch das Dornengestrüpp der Dünen zum Strand. Als der Blick auf das Wasser fiel, war es Marcel als fiele eine Bürde von ihm ab. Er zog die Schuhe aus, presste den feinen, weißen Sand durch seine Zehen und tänzelte einen Samba, während Charlie bellend um ihn herumsprang. Die Unbeschwertheit der ersten Begegnung mit dem Meer sollte eine rasche Wende nehmen.
Sie erreichten die Wasserlinie.
Zwei ältere und eine jüngere Frau standen zusammen. An die Beine der Jüngeren klammerte sich ein kleines Mädchen; es verbarg seinen Kopf im Rock der Mutter. Die Erwachsenen gestikulierten aufgeregt und schrien sich die Worte zu, damit der Wind sie ihnen nicht verwehte.
Als sie Marcel bemerkten, kam die junge Frau auf ihn zu. Sie zerrte das Kind hinter sich her.
»Monsieur, Monsieur! Aidez-moi! Aidez-moi! Est en difficultés – Mon garçon est en difficultés!«
Marcel hatte verstanden, dass sie um Hilfe bat. »Comment puis-je vous aider, Madame?«
»Mon fils Jean-Pierre ne peut pas retourner – il est là – pouvez-vous le voir?«
Sie zeigte mit dem ausgestreckten Arm in die Brandung.
Marcel folgte der Richtung, die sie zeigte, konnte jedoch nichts ausmachen. Er konzentrierte den Blick auf den Bereich, in dem ein Schwimmer zu vermuten wäre. Durch das systematische Absuchen der Wasseroberfläche entdeckte er schließlich einen Arm in der Brandung, der hochgestreckt um Hilfe winkte.
Marcel war kein guter Sportler und schon gar kein Held, aber seine Mutter hatte ihn häufig zum Schwimmen mitgenommen. Er wurde zwar nicht zur Wasserratte, hatte in dieser Zeit aber immerhin die Prüfung zum »Rettungsschwimmer« abgelegt.
Marcel brauchte seine Schwimmflossen. Die waren im Rucksack.
Er nickte der aufgeregten Französin zu, und forderte sie auf, schnellstmöglich die Polizei zu verständigen: »Je vous aide, Madame, et vous informez la Police tout de suite, s’il vous plait.« Er wunderte sich, wie flüssig die französischen Worte aus seinem Mund kamen.
Madame schickte jemand zum nahen Strandrestaurant.
Während Marcel flink aus dem T-Shirt schlüpfte, seine Jeans abstreifte und seine Tauch-Utensilien aus dem Rucksack zog, kam ihm die Frage in den Sinn, was wohl passieren würde, wenn seine Hilfe vergeblich wäre. Es befiel ihn einen Moment die Angst vor dem Versagen und vor der lebenslangen Verfolgung durch einen toten Knaben. Doch verlieh ihm die Angst vor dem Versagen Kraft. Marcel nahm Charlie an die Leine und übergab den Hund der Obhut der Mutter.
Er lief los, legte die Flossen an, als das Wasser tief genug war, drückte die Erker-Maske über Augen und Nase, steckte den Schnorchel unter das Maskenband, klemmte sich das Mundstück zwischen die Zähne und blies den Tubo aus. Dann warf er sich rückwärts in den ersten Brecher.
Er wurde unter Wasser gedrückt, von der Rückströmung erfasst und weiter ins Tiefwasser mitgerissen. Salzwasser drang durch den Schnorchel in den Mund; erschrocken spuckte er das Mundstück aus. Schon wurde der Schnorchel aus dem Maskenband gerissen, berührte noch den rechten Oberschenkel und war verschwunden.
Der Gedanke, dass er beim nächsten Luftholen Wasser schlucken könnte, verkrampfte ihm die Brust. Marcel bekam Panik. Er dachte plötzlich an Isabell und seine Mutter und daran, dass er sie vielleicht nie wiedersehen würde. Dann fiel ihm der Ausbilder von der Wasserwacht ein, der von einem seligen Gesichtsausdruck berichtete, den alle Ertrunkenen hätten.
Mit panischem Flossenschlag erreichte er Oberwasser. Kurz konnte er atmen. Er verschluckte sich, bekam Hustenreiz, und seine Angst, lebensbedrohend krank zu sein, war wieder da.
Der nächste Brecher stürzte über ihm zusammen und drückte ihn erneut nach unten. Er paddelte um sein Leben, schaffte es nach oben, holte tief Luft und tauchte gegen die Wellenrichtung, bis das Wasser ruhiger wurde. Jetzt hatte er die Brandung hinter sich und sah sich zwei aufgerissenen, hilfesuchenden Augen gegenüber; ein angstvolles Gesicht, das blonde Strähnen im Auf und Ab der Wogen veränderten.
Unweit von ihm drehte ein Styropor-Wellenbrett seine Kreise.
Dann war Marcel bei dem Jungen, der zunehmend erschöpfter wirkte. Marcel erkannte mit einem Blick, dass der zu schwach war, um allein gegen das rückfließende Oberwasser anzuschwimmen; der Junge würde den Strand nicht ohne Hilfe erreichen.
Panisch klammerte er sich an Marcels Schulter.
»Bonjour, Jean-Pierre, nous fuirons les vagues ensemble, ça va?«
Ob der Junge ihn wirklich gehört hatte, wusste Marcel nicht, aber zumindest ließ dessen Panik nach. Jean-Pierre hatte zumindest verstanden, dass er nun jemanden hatte, der ihm bei der Rückkehr zum Strand behilflich war. Er nickte dankbar ins Wasser.
Sie erreichten das Bodyboard, dessen Verbindung mit dem Handgelenk, dem »Leash«, abgerissen war. Der Junge ergriff das Brett, wie er es gewohnt war, und Marcel sicherte ihn ab, indem er sich unter das Board legte, den Kopf zum Atmen vor dem Bug. Marcel zeigte den rechten Daumen nach oben. Der Knabe lächelte krampfhaft. Er schien verstanden zu haben. Seine Lippen waren blau und die Arme von Gänsehaut überzogen.
Marcel schlug mit den Flossen. Sein Antrieb musste schneller sein als die Rückströmung. Er erspähte die Brandungsschwelle. Sobald er diese überwunden hatte, könnten sie sich treiben lassen und mit einer Welle zum Strand auflaufen. Dabei durften sie sich nicht auf den Grund drücken lassen und nicht in die gefährliche Unterströmung geraten. Marcel würde den Jungen in den tonnenschweren Wasserwirbeln verlieren. Marcel startete mehrere vergebliche Versuche. Die Wellen stellten ihn immer wieder quer. Der Junge drohte zu entgleiten.
Sie kamen nicht aus dem Gefahrenbereich, der sich überschlagenden Wassermassen und nicht aus der Rückströmung heraus. Der Junge hyperventilierte. Er war klamm und konnte jeden Moment kollabieren. Zu lange war er schon im kalten Wasser.
Auch Marcel fror. Ihm schwand der Mut und wieder schwante ihm, dass sein Leben ein frühes Ende nehmen könnte.
Am Strand hatten sich Menschentrauben gebildet, aus denen einzelne Personen winkten; andere deuteten nach oben.
Plötzlich sah auch Marcel den roten Helikopter. Bald dröhnte die Turbine über ihnen und der Rotor glättete das Wasser. Ein lauter Seufzer ging von dem Jungen aus. Marcel hielt ihn am Brett fest.
Ein Seil mit einem Retter wurde länger und schwang über ihnen. Der Mann aus der Luft deutete auf sich und auf den Jungen. Marcel verstand und bestätigte mit dem internationalen Okay-Zeichen der Taucher – die Spitze von Daumen und Zeigefinger aufeinandergelegt.
Der Mann im orangefarbenen Overall warf Marcel eine Rettungsjacke zu, legte dem Jungen einen Sicherheitsgurt um, zog ihn zu sich hoch und hakte ihn am eigenen Brustgeschirr ein. Dann gab er Marcel das Zeichen, dass er wiederkäme. Er signalisierte nach oben, ihn und Jean-Pierre mit der Winde an Bord zu hieven.
Auf den Wellenbergen sah Marcel zwischen der Gischt die Menschen am Ufer klatschen. Euphorie und Stolz überkam ihn; er hatte nicht versagt.
Wenig später war auch Marcel an Bord, in eine Decke gehüllt und mit zuckerreichem Tee versorgt. Der Flug dauerte nur einige Minuten. Sie landeten auf dem Dach eines Krankenhauses. Sanitäter brachten sie in die Ambulanz.
Während der Junge wegen Verdachts auf Unterkühlung stationär bleiben musste, war schnell klar, dass Marcel außer trockener Kleidung und einem Rückfahrtticket an die Strandstelle, an der er seinen Gefährten bei der besorgten Französin zurückgelassen hatte, keine weiteren Bedürfnisse hatte.
Der diensthabende Assistenzarzt hieß Michel, war kleinwüchsig, drahtig, hatte ein scharfgeschnittenes Gesicht, einen dunklen Teint, schwarze, krause Haare und Geheimratsecken. Michel war aus Toulouse.
»Toll, dass Sie den Jungen gerettet haben!«
Michel hatte eine Affinität zu Deutschen. Er hatte in der Universitätsklinik Großhadern hospitiert und in München gewohnt. Er überrannte Marcel mit einer Erzählung von seinen bayerisch-königstreuen und lebenslustigen Vermietern Hierl in der Kaulbachstraße, von der »Association Démocratique des Français de Munich« und von Amouren mit Lissy, Iris und Rosi.
Marcel hatte ihm nervös zugehört. Beim Gedanken an Charlie wurde er richtig ungeduldig.
»Die Mutter des Jungen wartet mit meinem Hund am Strand auf mich. Aber eine schnelle Frage hätte ich. Ich fühle mich oft heiser. Könnten Sie mal nachsehen, was da los ist?«
Michel schaute erstaunt, leuchtete aber Mandeln und Gaumensegel aus.
»Meist ist Schnarchen eine Ursache für subjektive Beschwerden. Das Gaumensegel flattert dann im Luftstrom der Atmung. Beschwerden können aber auch nach dem Trinken von Alkoholika oder nach der Einnahme von Schlafmedikamenten auftreten. Bei Ihnen gibt es keinen Anlass zur Beunruhigung. Ich schließe einen krankhaften Befund definitiv aus.« Marcel kam es vor, als hielte ihn der Assistenzarzt für einen Hypochonder. Es könnte ja auch sein, überlegte er, dass sein Gaumensegel zu lang war. Dann läge ein Geburtsfehler vor. Das würde er vor der nächsten flugmedizinischen Untersuchung abklären lassen.
Marcel lud den Arzt trotz einer gewissen Antipathie ein, ihn in München zu besuchen. Und Michel würde ihn gerne in Toulouse begrüßen. Dazu war aber keine Zeit, denn Marcel hatte andere Pläne.
Michels zierliche Hilfsschwester mit einem asiatischen, ständig lächelnden Gesicht, hatte inzwischen für Marcels Reiseapotheke, die bislang nur aus dem zum Auto gehörigen Sanitätskasten bestand, Kopfweh-, Durchfall- und Schmerztabletten in eine Plastiktüte gesteckt. Dazu packte sie ihm noch Trinkwasser-Desinfektionsmittel, Vitamintabletten, Pflaster, Sonnencremes, sowie Sprays gegen Insekten. Marcel hätte damit die gesamte Equipe der »Rallye Dakar« versorgen können.
Dr. Sarussi, der Oberarzt, passte Marcel beim Empfangsschalter ab, beglückwünschte ihn im Namen des Hospitals zu seiner Rettungsaktion und kündigte an, ihm eine Kopie des Polizeiberichts nachzusenden. Marcels Protest half nichts.
Ein Notarztwagen brachte Marcel zurück. Marcel tauchte wieder zwischen den Dünen auf und Charlie sprang ihn Schwanz wedelnd entgegen. Er war froh, Marcel zurückzuhaben.
Marcel zog sich um und übergab das Klinik-Weißzeug an den Fahrer.
Die brünetten jungen Mutter Anne und ihrer Tochter Marie hatte zwischenzeitlich mit dem klugen Dackel gespielt und Charlie hatte sie bei Laune gehalten.
Annes Mann, Maurice, war unterwegs, im Krankenhaus nach seinem Leichtfuß-Sohn zu sehen; ihn gegebenenfalls gleich mitzunehmen.
Anne vergoss ein paar Tränen. Sie hatte erst jetzt erkannt, dass der von ihr verpflichtete Retter Deutscher war. Ihr Sohn verdankte diesem möglicherweise sein Leben.
Auch Charlie wurde geherzt und konnte sich der Umarmung von Töchterchen Marie nur mit Mühe entziehen. Mit einiger Verzögerung saßen die beiden Helden wieder in ihrer »Ente«.
Beschwingt ging die Fahrt weiter entlang der Silberküste, der Côte d’Argent, über Labenne, dann auf der Route National 10 nach Bayonne. Die Dünenlandschaft mit den endlosen Sandstränden wich den an das Meer herantretenden Höhen. Die Pyrenäen wuchsen vor ihnen auf.
Im mondänen Biarritz gab es Wellenreiter zu beobachten. Die Bretter trugen grelle Farben, waren Steh- oder Liegebretter, lang oder halblang, signiert und mit Sponsorenlogos bedruckt.
Sie schienen aus den verschiedensten Materialien gefertigt zu sein, belagerten Freiflächen, lehnten an Hausmauern, besetzten Fahrradständer, staken in Kofferräumen, ragten von den Beifahrersitzen offener Cabrios in den Wind und fanden sich vielfach auf Dachgepäckträgern, mit Riemen gegen den Fahrtwind gesichert. Sie schützten auch barbusige Badeschönheiten vor den Blicken zudringlicher Strandpapagalli, und man konnte die Bretter draußen in der Dünung unter den akrobatisch balancierenden Wellenreitern vermuten.