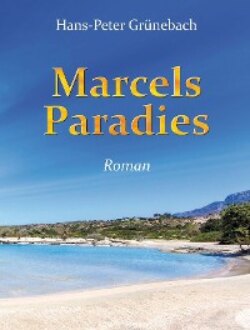Читать книгу Marcels Paradies - Hans-Peter Grünebach - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
ОглавлениеMarcels Schulzeit war ohne größere Schwierigkeiten verlaufen. Was hätte bei solchen Eltern auch passieren können. Sein sehnlichster Wunsch, fliegen zu lernen, wurde schon als Jugendlicher wahr. Die Eltern hatten ihm den Segelflugschein finanziert.
Aber erst als Erwachsener hatte er mit Hilfe seines Onkels Paul seine Pilotenprüfung für Motorflugzeuge ablegen können. Marcels Lieblingsonkel war bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte Marcel Geld für die Fluglizenz hinterlassen. Die fünfundvierzig Flugstunden waren Marcels Erbanteil.
Seine Mutter schenkte Marcel als Anerkennung zur bestandenen Prüfung einen Ring mit einer Triskele. Das Motiv darauf stellte ein keltisches Sonnenrad dar. Mutter erklärte den dreifachen Wirbel dieses Symbols als Glücksbringer, als »Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« auch »Dreieinigkeit von Körper-Geist-Seele«, »Geburt-Leben-Tod« oder »Werden-Sein-Vergehen«. Die Triskele sollte Marcel als Schutzamulett gegen negative Kräfte dienen und ihn stets heil auf die Erde zurückbringen.
Marcel traute der Schutzwirkung des Ringes wohl nicht ganz. Auf seinen Flügen nahm er neben »Headset«, Luftfahrtkarten, Flugbuch und Lizenzmappe, Mutters Triskele und zusätzlich eine Taschenbuchausgabe des »Kleinen Prinzen« mit. Dessen Autor Antoine de Saint-Exupéry war dem »Kleinen Prinzen« schließlich nach einem glücklich überlebten »Crash« begegnet. Das Büchlein war deshalb sein »geheimer Talisman«.
Danach gefragt, betonte er stets, nicht abergläubisch zu sein.
Für Marcel waren Glaube, Aberglaube und Reinkarnation keine neuen Themen. Er schloss die Vererbung von Seelen in seiner Lebenswelt nicht aus. Aber es fehlte ihm die letzte Überzeugung. Diese machte er abhängig von Beweisen. In seinem pragmatischen Denken war er doch ganz nach dem Vater geschlagen.
Zwar zweifelte er an der göttlichen Offenbarung von Bibel, Talmud und Koran, aber er war als Journalist neugierig genug, sich für die monotheistischen Weltkirchen und ihre noch gültigen oder gewesenen Seelenwanderungslehren zu interessieren. Immerhin standen auch seine Vorväter im frühen Christentum Wiedergeburtslehren nahe. Religionen, die das Vorhandensein einer Seele voraussetzten, beschäftigten sich immer auch mit deren Präexistenz. Wo Präexistenz möglich erschien, war das Weiterleben nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle nah.
So wurde der »Siebte Himmel« im Talmud beschrieben.
Die einstige Rabbiner-Lehre ging in den Koran über und fand durch ihn weite Verbreitung. Der »Siebte Himmel« erhielt sich in Sprichwörtern christlicher Kulturkreise.
»Ich fühle mich wie im siebten Himmel!«, hatte Marcel schon öfter ausgerufen, auch in seiner ersten Liebesnacht.
Sie hieß Lucy. Sie hatte ihn verführt, und er hatte ihrem reifen Körper keinen Widerstand entgegengesetzt.
Lucy hatte rot leuchtende Haare wie Milva und duftete nach erfahrener Frau. Die selbstbewusste Lucy war mit ihren sechsunddreißig Lenzen auch ungebunden glücklich. Sie wollte die Gegenwart genießen und von einem Vor- oder Nachleben nichts wissen.
Lucy freute sich über seinen »Siebten Himmel« wollte ihn aber nicht auf Dauer mit Marcel teilen.
Ein ganz anderer »Siebter Himmel« beschäftigte ihn nun als Hort des Rechts, des Gerichts und der Gerechtigkeit auch beruflich, denn er sollte einen Essay zum religiösen Hintergrund derjenigen verfassen, die unter Berufung auf Gott, inmitten einer Menschenmenge Sprenggürtel, Minen oder Bomben zündeten. Er musste über Djihadisten und Märtyrer, wie sie die eine Seite bezeichnete, über islamischen Terroristen, wie sie die »Westliche Welt« nannte, schreiben und in vier Wochen ein ausgewogene Text dazu abliefern. Den Großteil der Recherche hatte er bereits ausgedruckt und wasserdicht verpackt.
Marcel überflog nochmals die Notiz über die »Schlachtplatte« auf dem Bauernhof und beendete die Beschau mit der gleichen banalen Frage, die sich wohl alle Leser dieses Artikels stellten: »Wer macht denn sowas?« Er nahm die Scheibe Toast aus dem Brotröster, bestrich sie und kaute nachdenklich auf dem angekokelten Stück herum. Er legte das Thema Inkarnation vorläufig zur Seite und begann, situationsbedingt, über die Krebsgefährdung durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe zu grübeln.
Marcel bewegte die bittere Süße der Quitten-Marmelade mit der Zunge hin und her – als nähme er an verschiedenen Stellen des Gaumens Geschmacksproben. Sollte in seinem Hals ein Geschwür heranwachsen, wie er aufgrund häufiger Heiserkeit hypochondrisch spekulierte, so wäre ihm das jetzt egal. Die fruchtige Quitte aus Mamas Produktion überdeckte die bitteren Rußpartikel des Toasts, so dass Marcel seine tiefsitzende Sterbensangst vergaß, ein »Running Gag«, wie er im Münchner Mittelstand häufiger vorkommt; wohl eine der sozialen Folgen eines aus dem Ruder gelaufenen Millionendorfs.
Er las weitere Weltnachrichten, die ihm den Atem stocken ließen, wie die Opferzahlen der Flut-Katastrophe in China, die eines Erdbebens in Indonesien und die einer Kampfdrohne im pakistanischen Grenzgebiet.
Jemand schlug mit dem Klöppel an seine »Berta«, die Glocke, die einst einer Braungefleckten am Ende einer Ledermanschette am Hals hing. Marcel hatte einst mit seinen Eltern Ferien auf einem Bauernhof gemacht. Wegen seuchenhaften Klauenbefalls wurde seine Lieblingskuh Berta zum Schlachten geführt. Marcel war noch ein Kind und weinte um Berta. Die Bäuerin hatte Mitleid mit ihm und ihm ihre Glocke vermacht. »Immer wenn du diese Glocke hörst, schaut dir Berta aus dem Himmel zu«, sagte sie. Seitdem war das Allgäuer Souvenir seine Verbindung zum Himmel.
Die Türklingel, wie sie der durchschnittliche Münchner besitzt, hatte Marcel wegen des, seiner Meinung nach, unnötigen Stromverbrauchs abgeklemmt. Seitdem störte seine mit Klee und Gänseblümchen bemalte Berta zwar die Hausbewohner, das Almgeläut erreichte Marcel aber auch dann im Tiefschlaf, wenn er eine ganze Flasche Châteauneuf-du-Pape geleert hatte, ein Tropfen, der ihn normalerweise in seinen Siebten Himmel beförderte.
In der Annahme, es wäre die Nachbarin, Frau Kostanidis, von der er ein Moussaka-Rezept erwartete, wickelte er seinen blau-weißgestreiften Morgenmantel enger.
Die warmherzige Archäologin Dr. Irene Kostanidis hatte ihn bei einer Führung durch die Glyptothek in ihren Bann gezogen. Dort erst fanden sie heraus, dass sie Nachbarn waren. Sie könnten sich ja ergänzen, befanden sie.
Sich der Gleichfarbigkeit bayerischer und hellenischer Farben seiner Oberbekleidung bewusst, zog er den Gürtel zusammen und schlurfte in seinen Lederpantoffeln zur Wohnungstür.
Aus dem Gemenge dahinter hörte er nicht den Stakkato-Sopran von Frau Kostanidis, sondern eine kräftige Frauenstimme mit einem ihm bekannten Akzent: »Hallo, Marcel. Wir sind es, Adri und Trijnie. Können wir dich besuchen?«
Marcel war perplex; ohne Anruf, ohne Ankündigung, so früh am Tag? Er öffnete die Tür. Da standen tatsächlich seine niederländischen Freunde.
»Die Maastrichter sind an Spontanität ja nicht zu überbieten. Was macht ihr denn hier?«
»Wir sind immer für unsere Freunde da, besonders für die aus München«, lachte Trijnie, »du weißt doch, Marcel, wir mögen mit unseren Freunden gerne trinken und lachen. Sind wir fruh? Schleepst du nok?«
»Nein, nein, kommt rein. Ich freu mich!«
Da waren sie nun, der Lulatsch und seine über einen Kopf kürzere pausbäckige Freundin, suchten Quartier und breiteten die Arme aus.
Marcel vermied normalerweise Körperkontakt, gerade, wenn er noch nicht rasiert und angezogen war.
Trijnie jedoch ahnte davon nichts, als sie ihn umarmte und ihm je zweimal links und rechts einen Kuss auf die Wangen drückte. Der schlaksige Adri gab ihm die Hand und lächelte, die Schultern zuckend, verlegen.
Marcel winkte die beiden durch den dunklen Garderobenflur in sein Wohn-Esszimmer.
In der Kochnische warteten Geschirr und Gläser des Vorabends auf Abwasch. Marcel kippte das Fenster zur Straße, ließ Verkehrslärm ein und das Gemisch aus abgestandenem Wein, verbranntem Toast und Damenbesuch hinaus.
Den für seine jungen Jahre und der fast rheinischen Frohnatur mit runden zwei Metern alles überragenden Adri und die spontane, rotblondgelockte Trijnie mit üppiger Oberweite, hatten Marcel und Isabell vergangenes Jahr am freien Strand von Les-Saintes-Maries de la Mer kennengelernt. Ein Unwetter und beider Kult-Enten hatten sie zusammengeführt.
Der Plage Libre war überflutet. Das Wasser hatte alle Camper mit ihren nicht weggeschwemmten Zeltutensilien zum Rückzug auf den trockenen Hauptplatz an der Promenade gezwungen. Durchnässt und übernächtigt fanden sich die Havarierten zu einem gemeinsamen Rührei-Frühstück zusammen.
Die feuchten Klamotten waren zwischen den Autos auf Zeltspannschnüren zum Trocknen aufgehängt. Die Gestrandeten überboten sich gegenseitig an optimistischen Wetterprognosen, obwohl die Regenwolken weiterhin beängstigend tief über sie hinwegfegten. Es sah eher aus, als ob der Regen die Camargue für alle Zeit in ein Aquarium verwandeln wollte.
»Ich will nach Südfrankreich, diesmal aber auf die Atlantikseite«, erzählte Marcel, nachdem er den beiden eine Flache Sprudel und zwei Gläser hingestellt hatte. »Leider will Isabell nicht mit. Wir haben uns zerstritten.«
»Das ist aber schade; wegen der Geige?«, fragte Trijnie mit einem Augenzwinkern.
»Nein! Die Geige macht mir wenig aus. Die mag nur Charlie nicht. Er ist gerade bei ihr. Ich werde ihn mitnehmen.« »Was ist dann passiert?« Trijnie wollte es genau wissen.
»Isabell hat mir gestern Nacht erklärt, dass sie auf die Reise verzichten werde. Dem war eine heftige Debatte um die Wegstrecke und die Art der Unterkünfte vorausgegangen. Während ich von Roncesvalles-Novarra auf dem bekannten Camino Francés zu Fuß nach Santiago de Compostela zum Grab des heiligen Jakobus wandern, in Pilgerherbergen nächtigen, und mit Zug oder Bus an den Ausgangspunkt zurückfahren wollte, favorisierte Isabell den Camino de la Costa, das Auto als Transportmittel. Und sie bestand auf vorgebuchte Hotels.«
»Du wolltest deine Charleston-Ente stehen lassen?« Adri konnte nicht glauben, dass Marcel zu Fuß pilgern wollte.
»Isabell meinte, dass genügend Schriftsteller bereits über die überfüllten Massenunterkünfte geschrieben, und dass die Reiseplanung der Vorjahre ein Fehlschlag gewesen war. Und, dass man doch erkannte Fehler nicht wiederholen müsse. Und dann sagte sie noch, dass meine Planung doch keine sehr intelligente Lösung sei. Außerdem habe sie Angst, sich bei den Kletterabschnitten die Hände zu verletzen; die brauche sie aber für ihr Spiel, hatte sie geklagt. Isabell befürchtete zudem, den Anstrengungen der Gepäckmärsche nicht gewachsen zu sein.«
»Da war Isabell aber viel zu streng mit dir, Marcel«.
Trijnie streichelte Marcel wie zum Trost über die Schulter. »Da mein Einkommen als Jungredakteur große Sprünge neben dem Hobby ›Fliegen‹ derzeit ausschließt, meine jüngsten Ersparnisse in Waschmaschine und Mobiliar stecken, stand Isabells Statement ›Dann fahr ich eben nicht mit!‹ am Diskussionsende unüberbrückbar zwischen uns.«
»Und das war alles? Für ein Ende zwischen euch genug?«
Trijnie fasste es nicht, bis Marcel die Situation klärte: »Nun, es hatte auch noch andere Differenzen gegeben. Eigentlich wollten wir gemeinsam pilgern, um die Festigkeit unserer Beziehung zu prüfen. Aber Isabell war nach der Debatte so erregt, dass sie sich grußlos aufmachte und, neben ihrem Geigenkasten, nur wenig Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft hinterließ.«
Noch einmal streichelte Trijnie Marcel tröstend, diesmal seine Hand, die ihr nahe war. Adri schaute verlegen. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Ihm lag ein Sprichwort auf der Zunge, das er einer deutschen Mitschülerin einmal in ihr Poesiealbum geschrieben hatte: »Eine Freundschaft die ein Ende fand, niemals echt und rein bestand.« Doch er sagte nichts.