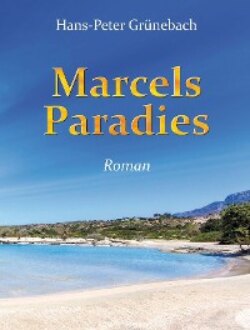Читать книгу Marcels Paradies - Hans-Peter Grünebach - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеBeim Finanzamt München Mitte firmierte ich unter »Sir Charlie Douglas«. Alle Hunde der Bouchards zuvor waren adelige »Douglas« gewesen, eine Dackelhierarchie in der x-ten Generation.
Ich aber verzichtete Zeit meines Lebens auf das »Sir«, denn mein Vorname kam ganz gutbürgerlich von Scharlatan, französisch Charlatan. Der soll ich als Welpe gewesen sein, hatten mir Marcels Eltern beständig vorgebetet.
Das »Sir« blieb für mich deshalb gefälliger, aber unredlicher Beischmuck. So hörte ich nur auf »Charlie« und wenn mich jemand mit »Sir Charlie Douglas« zu sich rief, stellte ich mich einfach tot. Schließlich hatten es die Menschen verstanden. Man rief: »Charlie«.
Charlie der Erste, der Zweite oder der Dritte, das hing von der Phase meines Seins, oder, verständlicher, von der Reinkarnationsstufe meines Seins ab.
Inzwischen war ich ein in die Jahre gekommener Dackelrüde aus gutbürgerlichem Hause, der seit Marcels Kindertagen gut behandelt wurde und entsprechend unentbehrlich fühlte ich mich auch; bis Marcel eines Tages eine Geigerin nach Hause brachte, Isabell.
Zugegeben, sie roch zauberhaft nach Lavendel und Rosenöl. Wenn sie sich zu mir herunterbeugte, dann umhüllten mich ihre Locken zärtlich wie die Mähne einer mir bekannten Collie-Dame. Pure Sinnlichkeit spürte ich, wenn sie »braver Charlie« sagte. Und wenn sie mich mit ihren Elfen gleichen Fingern hinter den Ohren kraulte, dann verdrehte ich vor Lust die Augen und warf mich in ihren Schoß.
Meine Begeisterung für Isabell hielt so lange an, bis sie in Marcels Wohnung einen schmalen Koffer öffnete, ein Gerät mit einem lackierten Holzkorpus mit langem Hals hervorholte und begann, mit einem Stock aus Pferdehaaren über Darm- und Stahlsaiten zu kratzen. Das war nichts für mich und meine Schlappohren. Isabell musste weg.
Marcel hatte wohl ähnliche Gedanken, denn auf diese Zwei- Ebenen-Reise auf die Iberische Halbinsel nahm er nicht Isabell mit, sondern mich. An einem Sommertag nahm die Geschichte ihren Anfang.
Marcel saß in seiner kleinen Wohnung im Gärtnerplatzviertel beim Frühstück und las laut die Tageszeitung: »Eine schwergewichtige Ehefrau soll zusammen mit ihrer undankbaren Brut den Hoftyrannen zerstückelt und Teile des ehemals mächtigen Landwirtleibs an Hunde verfüttert haben? – Wie unappetitlich!«, murmelte Marcel vor sich hin und zog dann zweifelnd die jungenhafte Stirn kraus.
Er fragte sich, zu welchem Zeitpunkt die Seele des Malträtierten ihren irdischen Leib verlassen haben könnte, falls die Geschichte wahr wäre? – Ferner hätte er gerne auch erfahren, in welcher neuen Gestalt der getötete Bauer der Fortsetzung dieser Schlachtplatte hätte zusehen können.
Marcel musste lachen. Er glaubte natürlich nicht an Reinkarnation, wie angeblich die Mehrheit der Deutschen. Dennoch war es ihm manchmal, als wenn zwei Menschen in ihm um die Vorherrschaft rangen: Einer, der ihn an die Vergangenheit band, und ein zweiter, der ihn nach vorne schauen ließ.
Dem zukunftsgerichteten fühlte er sich meistens näher. Aber derjenige, der ihn an Gewesenes erinnerte, prägte ihn und bekam in Träumen ein Gesicht. Im Traum befand er sich meist in vergangenen Epochen. Manchmal hatte er im Schlaf eine Gestalt vor Augen, die einer ihm vertrauten, ähnlich war. Hie und da glaubte er sogar ihre Stimme zu hören, die ihn aufforderte: »Flieg, Marcel, flieg!«
Die Stimme war ihm aber fremd. Er konnte sie nicht zuordnen.
Einmal hatte er seiner Mutter von seinen Träumen erzählt. Sie holte sich sogleich Rat beim Vater.
»Er ist eben ein fantasievoller Junge. Vielleicht wird er einmal fantastische Geschichten schreiben wie Hugo, Balzac oder Maupassant; oder er wird gar ein Märchen-Poet wie der fliegende Saint-Exupéry«, hörte er aus dem Nebenraum.
Die Mutter unterbrach den Vater streng und wies ihn tadelnd/entrüstet auf Saint-Exupérys mysteriösen Flugzeugabsturz hin.
»Ja, natürlich starb der Autor des ›Kleinen Prinzen‹ zu früh«, war die Antwort, »aber möglicherweise ist die Seele des Schriftstellers ja um Marcel herum und unser Sohn ahnt etwas davon – wer weiß?«
Es war Marcel damals nicht klar, ob Vater scherzte. Auch verstand er nicht, warum Vater so betonte, dass er zu solchen Phänomenen nichts Erhellendes sagen könne. Parapsychologie und alle Formen der Esoterik waren, Vaters Meinung nach, Sache von Frauen. Überhaupt sei Mutter in Sachen »Mystisches« kompetenter als er, hörte Marcel ihn sagen.
Die Eltern sprachen manchmal über den Tod und über das religiöse Jenseits, ohne sich in den Unterschieden ihrer ursprünglichen Konfessionen – er Protestant, sie Katholikin, ihm zuliebe konvertiert – zu verlieren.
Robert Bouchard war bodenständig, für das Diesseits, für das Beweisbare zuständig. Das verlangte auch sein Beruf als Mathematik- und Physiklehrer an einem musischen Gymnasium in München.
Marcels Vater entstammte einer französischen Hugenottenfamilie. Seine Urururur-Großmutter Beatrice Croimare, die von 1632 bis 1730 lebte, heiratete einen Gaston Bouchard aus Marville an der Othain. Sie selbst kam aus Saint-Jean-lès-Longuyon, einer kleinen Gemeinde östlich von Marville. Von den drei Söhnen hieß einer Daniel. Dieser wurde Spitzenfabrikant in Paris. Er siedelte 1715 nach Bayreuth um.
Daniel Bouchard floh nicht aus religiösen Gründen. Das landesweite Pogrom an französischen Protestanten, welches als »Bartholomäusnacht« bekannt wurde, ereignete sich 143 Jahre vor Daniels Entschluss, ins Fränkische zu ziehen. Von seinem Ahn Daniel wusste Robert Bouchard nicht viel mehr. Aber, dass Daniels Sohn, Peter, Theaterintendant am Hofe zu Kulmbach-Bayreuth wurde, das stand in der Familienchronik.
Man kann annehmen, dass Peters Gönnerin Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, die Schwester Friedrichs des Großen, war. Neben ihrer Rolle als Regentin war die eingeheiratete Marktgräfin auch Kunstmäzenin, Komponistin und Opernintendantin und prägte das kulturelle Leben der Stadt Bayreuth nachhaltig. Zur napoleonischen Zeit waren die Kirchen entmachtet, ihr Einfluss gering. Religiöse Fehden mussten hinter militärischen Waffengängen und einer politischen Neuordnung in Europa zurückstehen. Das Markgraftum Bayreuth, ehemals Preußen, war 1807 französisch geworden. Nach dem Tiroler Aufstand von Andreas Hofer gegen die Rekrutierungen für Napoleons »Grande Armée« wurde es im Pariser Vertrag von 1810 dem jungen Königreich Bayern zugesprochen. Dadurch unterhielt Bayreuth weiterhin gute Beziehungen zu Frankreich und Hugenotten machten Karriere. Nachzulesen war, dass Peters Sohn Friedrich Wilhelm bis zu seinem Tod 1825 Prediger zu Berlin, Professor für Mathematik und Direktor eines Erziehungsinstituts für adelige Zöglinge war. Weiterhin, dass von dessen sieben Kindern einer Steuerrat zu Köln und ein Enkel Direktor der Bergakademie in Berlin wurde. Alwine, die Frau dieses Enkels namens Wilhelm, hatte dem Stammbaum nach neun Kinder, von denen Sohn Oskar Sanitätsrat in München wurde. Danach hatten sich bis zu Robert alle männlichen Bouchards, wie Ahn Friedrich Wilhelm, der Mathematik verschrieben und hielten München die Treue.
Im Laufe der Generationen hatten die Bouchards gelernt, sich durch gesunden Realismus den bayerischen Gepflogenheiten anzupassen.
Immer aber hatten sie sich abstammungsbezogene Leidenschaften erhalten. Marcels Mutter nannte diese Neigungen »Vaters Marotten«.
So zog Vater die französischen Romantiker, Naturalisten und Realisten den deutschen vor, wie er es auch mit den alten Meistern der Malerei hielt, als gehörten sie zu seinem Familienverband.
Dass er zudem nur Briefmarken und Münzen der »Grande Nation« sammelte und nur Anzüge, Schuhe, Uhren aus »La France« trug, gaben ihm das Image eines Individualisten mit einem, von einigen belächelten, ganz persönlichen »französischen Stil«.
Dabei war Robert durchaus stolz, Münchner zu sein. Er kannte alle drei Strophen des Bayernliedes und hatte die bayerische Hymne sogar ins Französische übersetzt. Aber er konnte auch die Marseillaise schmettern.
Nur einen einzigen deutschsprachigen Autor verehrte er sehr: Theodor Fontane. Ob es an dem Nachnamen lag?
Den John Maynard rezitierte er immer, wenn sie auf dem Starnberger See oder auf dem Ammersee mit dem Ausflugsdampfer unterwegs waren. Auf Effi Briests Wandlung kam er meist zu sprechen, wenn der Haussegen schief hing. Den Archibald Douglas sang er an, wenn Mutter zu kritisch mit seinen Marotten ins Gericht ging, oder wenn ihm nach Singen zumute war. Marcels Dackel wurde nach ihm benannt.
Jeden Herbst zur Obsternte erinnerte Vater seine Familie beim Spazierengehen an Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und an dessen Birnbaum im Garten.
Einmal konnte Marcel seinem Vater zuhören, wie der sich politisch ereiferte. Es war schon spät am Abend. Vater hatte Kollegen zu Gast. Jemand war auf das militärische Engagement der Sowjetunion am Hindukusch zu sprechen gekommen. Da zitierte Vater aus dem Stegreif Fontanes »Trauerspiel von Afghanistan«: »Wir waren dreizehntausend Mann/ Von Kabul unser Zug begann/ Soldaten, Führer, Weib und Kind/ Erstarrt, erschlagen, verraten sind/.
Zersprengt ist unser ganzes Heer/ Was lebt, irrt draußen in Nacht umher/ Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt/ Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.«
Vater hatte volle Aufmerksamkeit und nutzte diese, um schnell noch mit bebender Stimme den letzten Vers nachzuschieben: »Die hören sollen, sie hören nicht mehr/ Vernichtet ist das ganze Heer/ Mit dreizehntausend der Zug begann/ Einer kam heim aus Afghanistan.«
Das Gespräch verstummte. Bald danach verabschiedeten sich die Gäste.
Vater liebte Fontane nicht nur, weil der auch hugenottenstämmig war, sondern, wie er sagte, weil Fontane zu seiner Zeit in Dichtung und Prosa Zusammenhänge überblicken und Probleme wirklichkeitsnah beschreiben konnte.
Mutter hatte Marcel damals in den Arm genommen. »Solche Träume sind nicht ungewöhnlich«, sagte sie und forderte ihn auf, ihr von seinen nächtlichen Erlebnissen zu berichten; »Träume muss man aufarbeiten!«
Dem folgte er anfangs und fühlte, ihr körperlich nahe, auch eine tiefe seelische Verbindung. Später, mit der Pubertät, wuchs die Distanz zur Mutter, und mit zunehmendem Abstand nahm die Häufigkeit ihrer Gespräche zu diesem Thema ab.
Marcel hielt seine Träume später für »Kinderei«; sie wurden ihm peinlich. Er begann darüber zu grübeln, was mit ihm nicht stimmte. Im Ergebnis fühlte er sich richtig krank. So wie die Träume kamen und gingen, kamen Depressionen auf und verschwanden wieder.
Mutter hatte seinetwegen ihr Soziologie-Studium an der LMU abgebrochen. Sie wollte nur ein Kind und das kam zu früh für eine berufliche Karriere. Da die eigenen Eltern weiter weg wohnten und die Münchner Schwiegereltern schon gestorben waren, hatte sie von dort keine Hilfe zu erwarten. So hatte sie sich für Marcel entschieden. Sie wollte für ihn da sein und seine Entwicklung mitgestalten.
Ihr Mann hatte sie nicht zu diesem Entschluss gedrängt. Er war geduldig und bemüht, Lebensräume anderer zu respektieren. Allerdings war Robert, trotz Marcels früher Ankunft, auch nicht unfroh über den Gang der Dinge. Die nicht berufstätige Ehefrau gab ihm Rückhalt und Ausgleich. Sein Leben verlief so harmonischer. Er war dadurch weniger der »Sonderling«. Zu Hause war sie der Fixstern, um den alles kreiste, und nicht er.
Mutter nahm Marcel früh mit ins Theater, in Konzerte und mit zum Sport. Sie selbst belegte Sprach- und Malkurse und beschäftigte sich in einer »Autorenwerkstatt« mit kreativem Schreiben.
Oft durfte Marcel dabei sein. So begann für ihn schon früh die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Genres der Literatur. Er begann Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben.
Mutter selbst verfasste ein Kinderbuch, in dem sie über die Abenteuer der Hundedame »Josephine«, deren Sohn »Arthur« und das Feldhasen-Waisenkind »Blitz« schrieb und es selbst illustrierte.
Marcel erschien der Plot weit hergeholt. »Blitz« nahm in dem Buch die Seele von »Arthur« in sich auf, als dieser versehentlich von einem Jäger erschossen worden war. Marcel glaubte, dass seine Mutter versucht hatte, einzelne Erlebnisse mit ihm und seine Charakterzüge darin zu verarbeiten. Das Werk war ihm gewidmet. Seine Mutter hatte ihn mit dem goldgeprägten, in hellrotem Iris-Leinen gebundenen Buch zu Weihnachten überrascht.
Der Inhalt erschloss ihm mehr vom Inneren der Mutter und offenbarte ihre Neigung, Tieren menschliche Eigenschaften und Sprache zu geben. War ihr Glauben an die Reinkarnation ernst? War sie von der Wanderung der Seelen überzeugt oder spielte sie das Seelenwandern nur mittels ihrer Sprache?
Derlei Überlegungen hatte der kindliche Marcel natürlich noch nicht angestellt. Mutter hatte Marcel vom Leben und Sterben der griechischen Götter erzählt. Sie war damals für ihn Hera, Pallas Athene und Aphrodite zugleich. Später war sie seine Vertraute, wenn er von seinem Wunsch sprach, fliegen zu lernen. Sie hatte eingeschränkt: »Aber nicht wie Ikarus!«
Sie und sein Onkel Paul waren die Einzigen, die sein Faible für alles, was flog, ernst nahmen. Das schloss Flugzeuge, Vögel und Insekten ein.
Er sammelte Schmetterlinge, bastelte Cessna-Modelle, fuhr mit dem Fahrrad zum Flughafen und malte sich mit den Starts und Landungen die Länder und Städte aus, von denen die Flugzeuge kamen und zu denen sie flogen.
Der Onkel hatte ihn als kleiner Junge einmal auf den Besucherhügel mitgenommen und ihm von seinem fliegenden Großvater, aber auch von Antoine de Saint-Exupéry, von »Wind, Sand und Sterne«, dem »Flug nach Arras« und vom »Kleinen Prinzen« erzählt.
Mutter hatte Marcel die Bücher gekauft, als er ihr von dem Gespräch mit Onkel Paul berichtet hatte.
Erst als er sich selbst zunehmend analytisch orientierte fiel ihm auf, dass seine Mutter in einer ganz anderen Welt unterwegs war. Das fand er einerseits peinlich, anderseits aber auch mutig.
Mutter hatte sich irgendwann verstärkt für paranormale Phänomene interessiert, solche, welche die Naturwissenschaften nicht beweisen konnten.
Sie stritt mit Vater häufiger über Telepathie, und der riet ihr heftig ab, zu den Sitzungen zu gehen, bei denen sie lernen wollte, Gedanken zu lesen. Dann nahm sie gar an einem Hellseher-Zirkel teil; und lernte, mit Pendel, Tarot-Karten und Glaskugel in die Zukunft zu blicken.
Eines Tages fand Marcel auf der Suche nach einem Fotoalbum seines Urgroßonkels mit Luftbildaufnahmen aus dem ersten Weltkrieg in Mutters Regal ein Buch mit düster-rotem Cover, das einen Satanshimmel beschrieb. Das Lesezeichen markierte das Kapitel »Hypnose und Suggestion in der Liebe«. Er blätterte und erschrak bei dem Gedanken, in welch wirklichkeitsfremder Welt sich seine Mutter bewegte. Andererseits bewunderte er ihre Neugier, an einem literarischen Hypnoselehrgang teilzunehmen. Dabei ging es um Schwarze Magie und Hexenrituale.
Marcel konnte nicht anders, als den Band an sich zu nehmen, in der Hoffnung, seine Mutter würde bei so vielen Büchern dieses eine nicht vermissen.
Noch in der Nacht schmökerte er darin und fand den Unterschied zwischen Magie und Zauberei erklärt, dazu praktische Beispiele. Er staunte über Anleitungen zum Tischrücken und ohne Hilfsmittel zu schweben. Manches überflog er nur, anderes las er genauer. Er bekam eine Vorstellung, wie man die Zukunft mittels Buchstechen vorhersagte. Er erfuhr, dass es im 13. Jahrhundert einen Codex Gigas, eine Teufelsbibel, gegeben haben soll, und wie man Merkmale für die Anwesenheit des Satans erkennen könne. Auch las er in dem Buch über die Sieben Todsünden und ihre Zuordnung zu den Dämonen, eine Anleitung zur Geisterbeschwörung, über den historischen Doktor Faustus und seinen Teufelspakt mit Mephistopheles. Natürlich war Goethe zitiert.
Das Zauberbuch »Clavicula Salomonis« erregte seine augenblickliche Neugierde. Über die Bedeutung der mathematischen, geometrischen Zeichen »Siegel«, »Charaktere«, »Signaturen«, konnte er später mit seinem Vater reden. Allerdings hatte auch der nur eine blasse Ahnung von den Bedeutungen; versprach aber, sich zu informieren.
Das Siegel eines Geistes sei bei einer Beschwörung die Hauptsache, hieß es in Mutters Buch; daher müsse die Bedeutung des Siegels vorher genau studiert werden. Mit Hilfe eines solchen Zeichens könne man sogar Erzengel auf die Erde herabziehen und diese durch Zauberworte beeinflussen. Was bei den Beschwörungsformeln zu beachten sei, und was Wörter wie »Shemhamphorash« in der Magie bedeute, verwirrte Marcel. Letztendlich schlug er den Satanshimmel ermattet zu. Er schlief trotzdem traumlos und stellte das Werk zwei Tage später unauffällig an seinen Platz zurück.
Schon früher hatte seine Mutter eine Zeitlang Kontakte zu einer spirituellen Gruppe gepflegt, die ihre Reinkarnationserfahrungen untereinander austauschten, sich auch zu Geheimsitzungen trafen.
Marcels Mutter muss von den mysteriösen Stimm-Erscheinungen ihres damals vierzehnjährigen Sohnes erzählt haben. Als er seine Mutter das nächste Mal zu einer nicht geheimen Sitzung begleitete, wollten einige Teilnehmer von seinen Erscheinungen »aus erster Hand« hören. Er tat ihnen den Gefallen, fühlte sich dabei aber seelisch ausgezogen. Obwohl er das zustimmende Nicken des einen oder anderen wahrnahm, war es ihm, als würden ihn manche für einen Aufschneider halten. Er spürte die Röte im Gesicht. Sein Herz pochte und seine Hände wurden feucht. Sie zitterten. Wieder einmal glaubte er, krank zu sein.
An jenem Abend war auch eine mollige Juliane zugegen, deren Hund kurz zuvor an Krebs gestorben war. Sie behauptete, ihre tiefe seelische Beziehung zu dem verstorbenen Vierbeiner habe die Seele ihres Rüden reisen und in ihre neue Hündin »Lisa« schlüpfen lassen. »Lisa« sei ein Charakter-Spiegelbild des alten Weggefährten.
Es folgte eine einstündige Diskussion zu den Möglichkeiten und Bedingungen, unter denen Julianes Annahme zutreffen könnte.
Während dieser Debatte war es Marcel langweilig geworden. Er war an der Seite seiner Mutter eingenickt, bis sie ihm einen Stups verpasste. Alle blickten auf ihn. Er rappelte sich in seinem Stuhl hoch. Die Situation war ihm hochpeinlich.