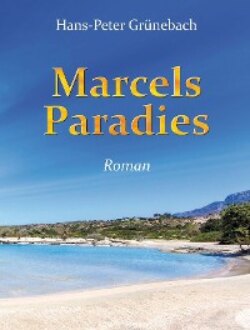Читать книгу Marcels Paradies - Hans-Peter Grünebach - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 3
ОглавлениеMarcel war inzwischen rasiert, in seine Jeans geschlüpft und hatte drei Tassen Café Crema aus seiner Kaffeemaschine in Becher mit kitschigen Hundemotiven laufen lassen.
Dann überließ er die beiden eine Weile einer Mittelmeer-Fotoshow des vergangenen Jahres auf seinem voluminösen Laptop.
Adri und Trijnie fanden sich dort beim Beach Volleyball und als Schiffsbrüchige bei Spiegeleiern mit Speck wieder.
Marcel klingelte bei seiner griechischen Nachbarin: »Könnten Sie mir bitte Milch für den Kaffee borgen, liebe Frau Kostanidis?«
»Ich kann Ihnen doch keine Bitte abschlagen, Herr Marcel, und warten Sie einen Augenblick, ich bringe Ihnen auch das versprochene Moussaka-Rezept.«
Marcel wartete kurz, bis sie auch das versprochene Kochrezept gebracht hatte.
Marcel warf Frau Kostanidis ein Luftküsschen zu und kehrte zu seinen Gästen zurück.
Später knurrte Adri hörbar der Magen. Die Drei verständigten sich, etwas essen zu gehen. Adri und Trijnie waren nachts gefahren und kämpften tapfer gegen Hunger und Müdigkeit. Der Kühlschrank des Junggesellenhaushalts war wegen der anstehenden Reise leer.
»Auf dem Viktualienmarkt könnten wir Matjes essen«, schlug Adri vor.
»Besser, wir machen eine typisch bayerische Brotzeit – ihr sollt etwas von der bayerischen Seele erfahren«, entgegnete Marcel.
Adri fügte sich. Er war neugierig.
Es war nur eine Viertelstunde Weg von Marcels Mansardenwohnung in der nahe an der Isar gelegenen Kohlstraße bis zum »Spöckmeier«.
Dorthin führte Marcel routinemäßig Freunde, die von auswärts kamen. Es war für ihn ein Ritual, das ihn nicht viel Kraft kostete.
Marcel hatte sich als Student durch Altstadtführungen manche Mark mit Gruppen erwandert und sich dadurch mehr leisten können als seine Kommilitonen.
Für ausländische Freunde war der Gang mit ihm also ein »Muss«.
»Ihr wisst, dass ich als Fremdenführer vielen Touristen München gezeigt habe. Ich bin ›Altstadtprofi‹ und auf Leute wie euch programmiert«. Er lachte. »Beim ›Spöckmeier‹ gibt es jedenfalls die besten Weißwürste Münchens«. Adri und Trijnie zogen mit.
Sie gingen über den Isartorplatz, durchs »Tal« vorbei am »Alten Peter« und am Rathaus mit seinem Glockenspiel. Das war leider vorbei.
Vom Marienplatz wandten sie sich links zur Rosenstraße. An der Fassade des Sporthauses Schuster erinnerte eine Metalltafel an die Familie Spitzweg. Gegenüber lud ein in schlichtes Schmiedeeisen eingerahmtes »Paulaner München«-Wappen mit einem bescheidenen Schriftzug in blau zum »Spöckmeier« ein.
Das Traditionswirtshaus bayerischer Gaumenfreuden betraten sie durch dessen blaugestrebte Glastür, welche die ehemals massive Holztür ersetzt hat, um mehr Licht einzulassen und um dem angewachsenen Kundenverkehr gerecht zu werden.
Marcel steuerte auf das »Weißwurst Stüberl« zu.
Adri tat mit seinem belustigenden Akzent kund, dass er schon über die »Münchner Weißwurst« gelesen habe. Seine Erinnerungen seien jedoch bruchstückhaft und bräuchten unbedingt eine Auffrischung. »Wir brauchen da etwas Nachhilfe«, sagte er.
»Daran soll es nicht mangeln!« Marcel bemühte sich, dem erhöhten Geräuschpegel gerecht zu werden.
»Mit nur einer Unterbrechung in Paris habe ich meine gesamte Schul- und Studienzeit in München verbracht. Ich werde euren Wissensdurst stillen können.«
Sie hatten Platz genommen.
»Die wichtigste Frage, die ich mir selbst stelle, ist, warum wir diese Würste so gerne essen, wenn achtundfünfzig Prozent der Bayern an Reinkarnation glauben und in jedem Schwein, in jedem Rind, in jedem Kalb die Wiedergeburt von König Ludwig dem Zweiten, Heinrich dem Löwen oder Ludwig dem Bayer stecken könnte. Müssten wir dann nicht beim Vertilgen von Schweinsbratwürstchen, Rinderfilets oder Kalbshaxen mehr Hemmungen haben; so auch beim Verzehr von Weißwürsten, oder?«
Marcel erwartete keine Antwort.
Sie hatten den mittleren Vierertisch auf der rechten Seite belegt, unweit des blauen Kachelofens. Der Platz ließ den Blick auf die Schiebetür zu, durch die Kellner mit schwarzen Hosen, weißen Hemden und rosa-, oder grüngemusterten Westen und Bedienungen in blauen Dirndln, weiße Blusen darunter und Schürzen mit feinen rot-weißen-Karos darüber, ein und aus gingen.
Marcel deutete auf die Fotogalerie vor der Holzvertäfelung und forderte die beiden auf, das Geschehen Drumherum im Auge zu behalten, um die »Bayerische Seele« in sich aufnehmen zu können.
Adri und Trijnie ließen die Stimmung auf sich wirken.
»Bayerische Seele?« Trijnie deutete fragend auf den Nachbartisch.
In der Mitte des Raumes wartete eine gemischte Gruppe junger, italienischer Touristen, gegen die ihnen sonst nachgesagten Gewohnheiten, andächtig-ehrfurchtsvoll auf ihre bayerische Kultwurst und wusste nicht, was sie mit dem vor ihnen stehendem Weißbier anfangen sollten. Der Kellner erlöste sie, indem er Berge von Brezeln vor ihnen aufbaute.
Auf der Kachelofenbank versuchte eine schlanke Business-Dame im marineblauen Modell-Kostüm und flinken Augen, sicher Assistentin einer Geschäftsleitung in Mutterschaftsurlaub, Pflichten gegenüber dem Baby und Manager-Aufgaben in Einklang zu bringen. Die schöne Erscheinung hielt mit einer Hand ein Skript, las einen Vortrag und versuchte mit der anderen ihrem Kind, das aus einer noblen Karosse bisher nur in den hölzernen Himmel des Weißwurst-Stüberls blicken konnte, einen Schnuller in den Mund zu stecken.
Die oder der Kleine schien nicht einverstanden zu sein; das Kind begann zu plärren. Nun erst wurde die Mutter gewahr, dass hier jemand schrie, der seine eigenen strengeren Maßstäbe anlegte und Aufmerksamkeit einklagte.
Die Mama legte ihren Vortrag zur Seite, hob das Kind aus dem Wagen und legte es sich an die Brust.
Das milliardenfach erprobte Mittel wirkte; aber Trijnie schüttete sich aus vor Lachen.
Das war ihr dann so peinlich, dass sie schnell in Richtung einer gastwirtlichen Darstellung an der Gegenwand zeigte, um von dem Dürer-Motiv »Maria und Kind« abzulenken.
Nun drehten sich andere Gäste um, schüttelten fragend die Köpfe und wollten wohl wissen, was an der Relieftafel »Der Götter Bachus & Gambrinus X Gebote« oder an der bemalten Sieger-Holzscheibe eines Schützenwettbewerbs aus dem Jahre 1891 wohl so lustig sei?
Marcel bestellte.
Rechts von ihnen saß ein Alter mit Hut, eine Krücke neben sich, beim Tee. Das war für diesen Schankraum schon merkwürdig. Auch verrieten das runde unglückliche Gesicht mit seinen roten Flecken und der enorme Bauch, dass sein Träger sich bislang ganz anderen Getränken gewidmet hatte. Die Gewohnheit und die Erinnerung an bessere Zeiten führten ihn wohl weiterhin zum »Spöckmeier«. Die ärztliche Empfehlung zwang ihn wohl zu dem Kulturbruch mit einem magenfreundlichen, grünen Tee.
Adri klagte über hölzerne Tischbeine, die im Weg standen, die das Geraderenken seiner Beine verhinderten. Auch war ihm das Pölsterchen auf der Sitzbank nur ein Hilfsmittel beim Verrutschen niederländischer Hünenknochen.
Über den Tischen lag das Aroma von Hopfen, Laugenteig und Brühe. An den Wänden zogen verblichene Fotografien von Wirtshausmotiven an den Hungrigen vorbei und erweckten Halluzinationen.
Auf den Tischen sorgten Stiefmütterchen für Andersfarbigkeit. Servietten und Platzdeckchen zeigten ihre kitschigen weiß-blauen Muster. Sie reklamierten bayerisches Selbstverständnis und Landesstolz.
Das Warten überbrückte Marcel durch seine Version der Geschichte der Münchner Weißwurst: »Adri, du hast doch gelesen, dass die Weißwurst mit süßem Senf gegessen wird; dazu Brezeln und Weißbier. Aber wisst ihr auch, wie sie entstanden ist?«
»Natuurlijk niet, Marcel, je moet dat vertellen!«
Das Thema schien Trijnie wachzuhalten. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nach vorn, setzte beide Ellenbogen auf, so wurde ihr rosa Korallenarmband und ein Ornamente-Tattoo sichtbar, stemmte die Hände unter das blondflaumige Kinn und schürzte die sinnlichen Lippen.
Marcel erzählte die Geschichte so, wie sie im Stadtführer stand: »Am Rosenmontag des Jahres 1857 erfand ein Wirt am Marienplatz die Münchner Weißwurst durch einen Zufall. Ihm waren die Schafsdärme für die Kalbsbratwürstchen ausgegangen. Daraufhin schickte er seinen Lehrling los, Schafsdärme zu besorgen. Der kaufte fälschlicherweise Schweinedärme. Was machte der Wirt in seiner Not? Er füllte die zu großen Schweinedärme mit der vorbereiteten Masse, briet die Würste jedoch nicht aus Angst, sie würden platzen, sondern brühte sie in heißem Wasser auf. Die Gäste aßen sie zunächst aus Neugierde, dann aus Appetit. Sie müssen ihnen geschmeckt haben, denn andere machten sie nach. Seitdem haben die Münchner ihre Weißwurst.«
»Applaus, Applaus!« Trijnie klatschte verhalten, die Ellbogen unverändert in Spannung: »Aber warum mussten wir uns vorhin so beeilen? Wir haben gelesen, dass man sie vor Zwölf essen muss. Warum?«
Marcel ließ den Gästen Zeit, selbst nachdenken.
»Natürlich kann man Weißwürste in München auch nachmittags und abends bestellen, weil es auch in Bayern Kühlschränke gibt. Da werden sogar diejenigen gebaut, die in Holland Matjes und Poffertjes kühl halten.«
»Mach dich nicht lächerlich, Marcel, Poffertjes werden in der Pfanne zubereitet und sofort gegessen«, korrigierte Trijnie, das Kinn weiterhin angriffslustig aufgestützt.
»Es hat sich aber durch die mangelnde Kühltechnik von früher eingebürgert, dass Weißwürste das Mittagsläuten nicht hören dürfen, wie man sagt. Heute ist diese Regel natürlich überholt. Dass sich viele Esser trotzdem noch daranhalten, beruht bei den Touristen auf Unwissenheit und bei den Einheimischen auf Tradition oder Geschäftssinn Bei uns schlägt’s jetzt aber Zwölf.«
Der quadratisch wirkende Kellner mit dem grünen Samt-Wams brachte die Terrine, den Brotkorb mit sechs Brezen und das Steingut-Fass mit dem süßen Senf. Marcel teilte mit dem Edelstahl Weißwurstheber jedem eine Weißwurst und mit dem hohlräumigen Holzlöffel Senfschläge aus.
»Gezuzelt wird sie. Am besten zuerst mit Messer und Gabel auf dem Teller längs halbieren, dann herunterwälzen. Smakelijk eten und Prost!«
Das Weißwurst-Stüberl hatte sich weiter gefüllt, und die junge Mutter hatte ihre Brust wieder bedeckt; das Baby war zurück im Sportcoupé, die Mama aß – keine Weißwurst, sondern Nürnberger Bratwürstel.
Marcel erzählte eine Story von seiner Mama: »Ich war krank und hatte demzufolge keinen Appetit. Schon gar nicht war mir nach Weißwürsten. Doch mein Vater hatte welche eingekauft, und Mutter wollte sie mir schmackhaft machen. Sie erzählte von einem Chinesen aus Kanton, der einen Stand an der Münchner Freiheit hatte, damals Künstlertreff. Dort brutzelte er eine, in München unbekannte weiße Wurst als chinesisches Schmankerl. Eines Tages wurde er von der Polizei dabei ertappt, wie er streunende Hunde einfing und diese zu weißen Würsten verarbeitete. Bei der Vernehmung gab er an, dass die Hunde keine Bürgerrechte besäßen. Sie wären ehemalige Sträflinge, die als Straßenköter wiedergeboren waren. Die Wiedergeburt hatte man ihm noch abgenommen, nicht aber die Verarbeitung der Hunde zu Wurst. Er landete für ein paar Wochen im Gefängnis.«
»Und, hat es dir danach noch gesmakt?«
»Mir nicht und meinem Vater auch nicht. Obwohl Mutter hinterher eingestand, die Geschichte erfunden zu haben, und dass sie nicht beabsichtigt hatte, uns den Appetit zu verderben, aß ich nicht davon und Vater verzichtete für eine Weile auf die traditionelle Brotzeit. Meine Mutter wollte auch nicht die Leute aus dem Reich der Mitte diskreditieren. Es ging einfach ihre Fantasie mit ihr durch. Meine Mutter ist eine interessante Persönlichkeit. Ihr solltet sie kennenlernen.«
»Ja, gerne!«, meinte Trijnie.
Die beiden Niederländer waren noch mit Zuzeln und Schneiden beschäftigt.
Trijnie amüsierte sich jetzt über die inzwischen gestärkten, laut gestikulierenden Italiener, die über »Primo Piatto«, Secondo« und »Dessert« debattierten und versuchten, der Spöckmeier-Karte die Dreiteilung ihrer nationalen Tafelordnung zu entlocken. Sie brachten den Kellner damit schier zur Verzweiflung.
Irgendwie muss ihr die vorangegangene Schilderung noch nachgehangen haben. An einer Brezel kauend fragte Trijnie: »Glaubst du denn an Seelenwanderung bei Hunden oder Menschen? Eine Tante von mir unterhält sich mit einer Vorfahrin und glaubt, sie sei deren Wiedergeburt. Die gesamte Familie ist ratlos. Und die armen Hunde?«
Marcel gab sich diplomatisch. »Mutters Geschichte war sicher kein passendes Tischgespräch – tut mir leid. Zu Hunden fällt mir gerade nichts ein, doch es gab jemandem in einem anthroposophischen Seniorenstift, der mit seiner verstorbenen Frau gesprochen haben soll. Und eine alte Dame, die dort aus einer Zeit berichtete, aus der sie keine Detailkenntnisse haben konnte. Derjenige, der mir davon erzählte, war kein Spinner.«
Trijnie saß nun gesättigt und locker zurückgelehnt, während Adri weiter versuchte, seine Beine von links nach rechts und wieder zurück zu sortieren.
»Das klingt in meinen Ohren schon sehr sonderbar, was ihr da sagt«, gab Adri zu: »Ich habe über Seelenwanderung zwar nachgedacht, gehöre aber nach wie vor zu den Zweiflern. Hier kreuzen sich wohl unerforschte Pfade des Mensch-Seins und unterschiedliche Anschauungen der Kirchen. Meine Katholiken und die Protestanten des Nordens haben sich seit der Reformation zum Verbleib der Seelen, zur Auslegung der Dreifaltigkeit und so weiter in den Haaren gelegen. Die ethische Ausrichtung der Schulmedizin ist immer noch fest im Griff der Kirchen. Darum haben wohl Esoterikerinnen so großen Zulauf, oder?«
Marcel nickte. »In München wurde sehr spät, ich glaube um 1720, noch eine ›Hexe‹ verbrannt.«
»Eine richtige Hexe?«, fragte Trijnie. Sie war wie so oft nicht mit Ernst bei der Sache, aber Marcel ließ sich auf ihre Frage ein: »Die ›Hexen‹ waren ja ohne Schuld. Sie hatten lediglich das von ihren Müttern vererbte Wissen angewandt. Zum Beispiel hat eine ›weise Frau‹ eine Schwellung durch selbstangerührte Heilkräuter-Paste behandelt. Das Pech der ›weisen Frau‹ war, dass die Kirche sich das Recht zum Heilen von Körper und Seele und das Quacksalbern vorbehalten hatte. Die Mönche und Kirchenfürsten waren damals noch misstrauisch und glaubten, dass der Teufel den Frauen die Rührhand führte. Zudem konnte eine ›weise Frau‹ ihre Kunst vor Gericht schwerlich nachweisen. Sie waren meist des Schreibens und Lesens nicht mächtig. Meist waren sie arm und konnten sich die Medizin aus den Kloster-Apotheken gar nicht leisten. Damals traf es die Tochter eines Hofstallknechts.«
»In den calvinistischen Niederlanden hatten religiöse Verbohrtheit zu überaus blutigen Auseinandersetzungen geführt«, kommentierte Adri, doch Marcel hörte ihm einen Augenblick nicht zu.
Irgendetwas schien ihn abzulenken.
Eigentlich wollte er noch über den Auftrag seines Chefredakteurs sprechen, doch der Kellner kam auf ihn zu.
In diesem Moment dachte er an den nächsten Tag.
Ihm war siedend heiß eingefallen, dass er seine Reisevorbereitungen vernachlässigt hatte. Er hatte es plötzlich eilig und beendete das Gespräch.
»Ihr seid eingeladen, nur müsst ihr mir noch verraten, was der Bayer unter ›Weißwurstäquator‹ versteht?«
Der Kellner lachte und meinte: »Bravo!«
Adri sagte: »Ich habe darüber gelesen. Beim Überfahren der Donaubrücke, es war nach Ulm, habe ich Trijnie sogar davon erzählt.«
»Richtig! Für viele Bayern ist die Donau sogar eine ›geistige Demarkationslinie‹ zum Rest der Welt. Manch bayerische Seele macht dort auf ihrer Wanderung kehrt.«
Der Kellner verstand die Doppeldeutigkeit zwar nicht, nickte aber mit halbernster Miene.
»Ihr macht euch über eure Brüder lustig«, maulte Trijnie und warf beiden einen aufgesetzt-besorgten Blick zu.
Marcel und der Kellner amüsierten sich und schauten sich vielsagend an.
Marcel beglich die Rechnung.
Trijnie umarmte Marcel beim Verlassen des Stüberls so überschwänglich, dass sie mit ihrer Handtasche im Delfter Porzellan-Design im Vorbeigehen ein Weißbierglas vom Tisch vor dem Kachelofen stieß. Dieses zersprang in tausend Stücke und verursachte bei seinem Besitzer einen ebenso temperamentvollen Protest in einer ihr unverständlichen Sprache. Das musste Oberbayerisch gewesen sein.
Trijnie war das sehr peinlich. Sie half beim Auflesen der Scherben und entschuldigte sich mehrmals mit: »Pardon! Pardon! Pardon!«
Eine Weile geißelte Trijnie noch ihr Ungeschick. Dann gab es Ablenkung. Beim Bummelten über den Rindermarkt musste Adri seine Trijnie auf einem der steinernen Rindviecher fotografieren. Sie kürzten durch die Kustermann-Passage ab.
Als Kontrastprogramm setzten sie sich für eine Weile in das am Viktualienmarkt gelegene Auktionshaus. Niemand wollte den angepriesenen, silbergerahmten »Hundertwasser«, niemand den 2,5 x 3-Meter-»Nain« und niemand die echte »Ming«-Vase ersteigern. Die Gegenstände stammten aus Haushaltsauflösungen, so erklärte der redefreudige Auktionator im schwarz-silbergestreiften Anzug die »Schnäppchen«.
Marcel hatte seine Eile vergessen und dachte an die alten Eigentümer: sie hatten wohl irgendwann einmal ihrer Neigung zum Schönen nachgegeben, Teppiche und Kunstgegenstände erworben und Jahrzehnte daran Freude gehabt. Nun lagen die Gegenstände wie leblos auf Halde in schmucklosen rückwärtigen Gemächern. Nur für einige Minuten wurden sie von krawattengeschmückten Bediensteten in den prunkvollen Auktionsraum geholt, ins rechte Licht gesetzt und fachkundig kommentiert, ja fast warmherzig beschrieben.
Bei mehreren potenziellen Bietern im Publikum, mitgerissen von der Präsentation des Objekts oder wegen des vermeintlich günstigen Preises, zuckten die Hände. Sie wurden jedoch meist selbstbestimmt oder durch die Ehefrau zurückgezogen, da ihre Besitzer vermutlich zu Hause unzureichend Platz hatten, oder weil sie als Touristen nicht mehr als die Einkaufstüten auf dem Stuhl neben sich als Transportmittel verfügbar hatten.
»Da sich kaum jemand um den Zuschlag reißt, dürfte sich der verstorbene Objekt-Liebhaber wegen der Interessenslosigkeit im Grab umdrehen«, raunte Marcel Adri zu.
Adri hatte, wie Trijnie auch, dem Geschehen fasziniert zugesehen. Er nickte und schmunzelte vor sich hin.
Marcel saß hier oft und fragte sich, was die alten Besitzer wohl dächten, wenn sie eine solche Auktion miterleben könnten.
»Auf diesem Platz habe ich mehr über schlechte Kunst gelernt als sonst irgendwo!«, flüsterte er Adri zu.
Adri war »vom Fach«. Er studierte im sechsten Semester Malerei und Kunstgeschichte. Adri beugte sich Marcel zu: »Dieser Auktionator tut so, als wäre jedes Objekt das seine; aber es gehört ihm nicht. Dass es ihm nicht gehört, überspielt er mit Humor, aber es tut ihm nicht echt weh, Kunst unter ihrem echten Wert zu verkaufen; es ist ja nicht sein Geld – er bekommt nur eine Provision.«
Das Geschäft verlief träge.
Sie zogen Trijnie aus der Stuhlreihe und verließen das Haus auf leisen Sohlen.
Beim Heimweg wurden sie angelockt von Kreidetafeln, die spanische Feinkost, Holundertee, Maracuja-, Sellerie-, und Rhabarber-Säfte, griechische und türkische Oliven, französische Weine und anderes anpriesen. Sie durchquerten Duftschwaden von Röstkaffee, Blumen, Gewürzen, Fisch, Gemüse, Obst, Backwaren und Bier. Achtlos weggeworfene Flaschen hatten Rinnsale und Pfützen gebildet.
Sie passierten die bronzene Erni Singerl, und Marcel war in seinem Element. Er erzählte von den Münchner Originalen, Volksschauspielern und vom »Valentin-Musäum«; seine »Münchner Geschichten für Touristen«. Am Standplatz des Karl-Valentin-Brunnens berichtete er, dass Vandalen dem Valentin schon einmal eine Hand abgerissen hatten, und er sich samt seinem Brunnen lange Monate in chirurgische Behandlung begeben musste. Jetzt spuckten die tierischen und menschlichen Köpfe im Bogen um ihn wieder Wasser. Der in rotes Papier gebundene Strauß mit Weihnachtsstern, Tannenzweigen und Kiefernzapfen, den jemand in seinen, den Schirm tragenden und deshalb abgewinkelten, rechten Arm gesteckt hatte, war wohl ein Überbleibsel der Winterzeit. Da hatte jemand seiner Freude Ausdruck verliehen, dass das Spiegelbild der bayerischen Seele wieder auf seinem Platz stand und unter seinem schwarzen, runden Hut, dem »Goggs«, wieder auf Maibaum und Alten Peter blickte. So als wollte es den Münchnern das »Grantln« austreiben und sie weiterhin mit seinem unverwechselbaren Humor auffordern, mitzumachen und das Leben auf die lustige Weise zu hinterfragen.
Den Espresso gab es daheim.
Marcel übergab Adri einen Zweitschlüssel, bereitete den beiden mit Hilfe von Trijnie ihr Gästebett, lud sie ein, dieses zu nutzen, solange sie wollten und bat sie, ihn nun für seine Reisevorbereitungen zu entschuldigen.
Marcel telefonierte mit Isabell, berichtete ihr von dem Besuch und kündigte an, wegen seiner Utensilien und Charlie vorbeizukommen, bevor er morgen in Richtung Frankreich aufbrechen würde.
Die griechische Altertumsforscherin begegnete ihm vor dem Schuhgeschäft, das wie der denkmalgeschützte, rote Backsteinbau, noch aus dem ausgehenden 19ten Jahrhundert stammte.
Er lud gerade Rucksack, Luftmatratze, Schlafsack, Plastiktüten mit Hausrat, Handfeger, sowie Flossen, Schnorchel und Taucherbrille in seinen schwarz-bordeauxroten Citroen »2 CV«.
Der Wagen war auf dem Bürgersteig abgestellt.
Auch in der Kohlstraße, obwohl diese im Verkehrsschatten von Europäischem Patentamt und Deutschen Museum lag, war Parkraumnot.
Frau Kostanidis erinnerte ihn lachend an seine Pflichten: »Sie denken doch an ihre Glocke – nicht, dass da jemand während Ihrer Abwesenheit sturmläutet. Soll ich die Tageszeitung sicherstellen?«
»Das würden Sie für mich tun?«
»Ja, aber nur unter der Bedingung zu, dass Sie für mich in der Kathedrale von Santiago de Compostela eine Kerze anzünden, für meinen verstorbenen Stavros. Er wollte einmal in seinem Leben dorthin pilgern. Dann starb er, und auch der Heilige Jakobus hätte ihn nicht retten können.«
Marcel versprach es und steckte der Nachbarin einen Reserveschlüssel für den Briefkasten zu.
Frau Kostanidis umarmte Marcel und drückte ihn zum Abschied an sich, als gehöre er zu ihrer Familie. Und als wollte sie ihn vor bösen Geistern schützen, markierte sie mit dem Daumen ein orthodoxes Kreuz auf Marcels Brust.
Wieder oben in der Wohnung war es still.
Adri und Trijnie hatten es sich auf der Couch gemütlich gemacht.
Trijnie schlief. Ihr Kopf glitt gerade unter Adris Achselhöhle.
Der nahm sie in den Arm, legte seinen Kopf auf den ihren und beide kippten sanft auf ihre Seite bis die Couchlehne dagegenhielt.
Marcel versuchte möglichst geräuschlos weiterzupacken. Er projektierte für den Kofferraum seiner »Ente« möglichst kleine Pakete, um den Stauraum gänzlich zu nutzen.
Die Vollzähligkeit seiner Reiseutensilien überprüfte er anhand einer Packliste.
Seine holländischen Gäste schliefen derweil tief und fest.