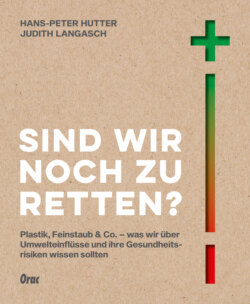Читать книгу Sind wir noch zu retten? - Hans-Peter Hutter - Страница 11
DAS BIOLOGISCH ABBAUBARE PLASTIKSACKERL
ОглавлениеBiologisch abbaubare und kompostierbare Kunststoffe werden häufig als mögliche Lösung für die Ansammlung von Plastikmüll angesehen. Am Markt gibt es derzeit viele Materialien, und das macht es für die KonsumentInnen schwer, sich zu orientieren.
So sind beispielsweise sogenannte „biobasierte“ Kunststoffe ganz oder auch nur zu einem Teil aus Biomasse hergestellte Kunststoffe (z. B. Mais, Zuckerrohr). Diese müssen nicht zwingend auch biologisch abbaubar sein. Hingegen bestehen „biologisch abbaubare“ Plastiksackerl aus Kunststoffen, die sich quasi selbst zersetzen. Diese können aus pflanzlichen Rohstoffen sein, aber genauso auch aus erdölbasierten Polymeren.
In dieser Kategorie wird noch zusätzlich unterschieden zwischen „biologisch abbaubarem“ und „kompostierbarem“ Kunststoff. Kompostierbar heißt, dass der jeweilige Kunststoff durch Mikroorganismen überwiegend in Wasser, Kohlendioxid und Biomasse „zerlegt“ wird. Das geschieht allerdings in einem kontrollierten Prozess mit definiertem Zeitrahmen.
Bei biologisch abbaubaren Kunststoffen läuft der Abbau vergleichbar ab. Er könnte zwar auch in der freien Natur von alleine stattfinden, würde dafür aber deutlich länger dauern.
Wenig berauschend sind sogenannte „oxo-abbaubare“ Kunststoffe. Diese Materialien werden zwar verhältnismäßig schneller abgebaut (sie enthalten Metallionen, die oxidiert werden). Es ist aber schwierig zu berechnen, wie lange ein oxo-abbaubares Plastiksackerl tatsächlich braucht, bis es abgebaut ist. Unter ungünstigen Bedingungen zerfällt es gar nicht oder nur in kleine Mikroplastikfragmente, die sich dann kaum weiter zersetzen. Daher finden sich auch immer mehr Stimmen, die ein generelles Verbot solcher Kunststoffe befürworten.
Zusammenfassend kann man, wenn überhaupt, nur schwer Vorteile finden, die diese „Bio-Sackerl“ haben. Nur eines ist sicher: Wir müssen unseren Verbrauch an Einwegsackerln dringend reduzieren bzw. vermeiden: Immer eigene Taschen oder alte Sackerl mitnehmen. Wenn doch einmal ein neues Sackerl nötig ist – egal, ob aus Plastik oder Papier: dieses so oft wie möglich wieder benutzen.
Aber auf Plastik zu verzichten ist in etwa so, als würde ich sagen, ich verzichte auf Strom – das ist schlicht nicht möglich. Können wir uns trotzdem schützen oder sollten wir mit bestimmten Plastikarten jedenfalls nicht mehr in Berührung kommen?
Das ist schwer zu sagen, weil man ja nie sicher sein kann, was bzw. welche Additive in welchem Kunststoffprodukt eigentlich genau enthalten sind – schon aufgrund der oft fraglichen Herkunft der Produkte.
Dennoch kann man nach einer einfachen Regel die Produkte auswählen: Je mehr ein Kunststoff „kann“, also je mehr Eigenschaften diesem zugeschrieben werden, wie z. B. farbenfroh, UV-beständig, beduftet etc. zu sein, desto mehr Zusatzstoffe werden vermutlich auch eingesetzt worden sein, um diese Eigenschaften „herbeizuzaubern“. Desto größer ist daher aber auch deren potenzielle Gefährlichkeit.
Eine weitere einfache Probe ist, daran zu riechen: Wenn ein Produkt chemisch oder auffällig riecht, ist davon auszugehen, dass aus dem Kunststoff diverse flüchtige Substanzen ausgasen und die Qualität nicht wirklich geprüft wurde.
„Rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff werden weltweit pro Jahr produziert.“
Viele andere Substanzen sind aber praktisch nicht zu riechen, wie etwa Weichmacher. Hier ist es ratsam, auf Hinweise wie etwa „phthalatfrei“ zu achten. Vorsichtiger sollte man generell mit Gegenständen sein, also auch mit diversen Kunststoffprodukten, wenn wir mit ihnen im Alltag häufiger, intensiver und/oder über eine längere Zeit Kontakt haben. Das betrifft etwa kindernahe Produkte (z. B. Spielzeug).
Jeder kann aber auch bei den Herstellern nachfragen, ob etwa diverse Additive in ihren Kunststoffen eingesetzt werden. Diese sind auskunftspflichtig, wenn das Produkt mehr als ein Gramm pro Kilogramm des Schadstoffes aufweist. Laut Europäischem Gerichtshof gilt diese 0,1-Prozent-Grenze bei Erzeugnissen, wenn sie aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind, auch für die Einzelkomponenten.
Generell weniger Plastikprodukte zu verwenden bzw. zu kaufen ist aber natürlich immer der sicherste Weg.
Auf all diese Chemikalien möchte ich in Wahrheit meinem Körper zuliebe verzichten, aber das ist wohl nicht der einzige Grund, warum man seinen Plastikkonsum im Auge behalten sollte, oder?
Keineswegs, denn Fakt ist: Die Rohstoff- und Ressourcenverschwendung sowie die anwachsende Verunreinigung aller Umweltmedien mit Kunststoffrückständen und Mikroplastik einzudämmen ist von stark wachsender Dringlichkeit. Man kann sich kaum vorstellen, dass rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff weltweit pro Jahr produziert werden. Auf Verpackungen entfällt mehr als ein Drittel aller hergestellten Kunststoffe. Und die Produktionsmenge wächst noch immer – und ein großer Teil dieser Produktion landet im Müll.
„Auch verbotene Stoffe können oft noch Jahrzehnte in der Umwelt, aber auch im menschlichen Gewebe nachgewiesen werden.“
Für ein Kilo Polyethylen benötigt man rund zehn Liter Wasser, und natürlich Erdöl, einen wertvollen Rohstoff, den wir für unnötige Produkte unseren Nachkommen entziehen, denn Erdöl wächst nicht nach. Immerhin acht Prozent des jährlich geförderten Erdöls gehen in die Plastikproduktion. Allein für die Herstellung von rund 16,4 Milliarden Plastikflaschen für Deutschland sind pro Jahr 665.000 Tonnen Rohöl erforderlich, das muss man sich mal vor Augen halten. Und in Österreich finden immerhin 1,5 Milliarden Plastikflaschen jährlich ihren Weg auf den Markt. Ein Ersatz dieser durch Mehrweg-Pfandflaschen würde eine Plastikreduktion um 45.000 Tonnen ausmachen – pro Jahr.
Betrachtet man nun die umweltschädigenden Folgen von Erdölproduktion und -transport wie etwa Tankerunglücke oder Ölverschmutzungen durch „havarierte“ Bohrinseln, Plattformen (Brent Spar) oder die Leckagen in Pipelines (z. B. Nigeria), die Gesundheitsprobleme der Bevölkerung in den Ölfördergebieten und so weiter, kann man wohl schon sagen, dass es eine Menge (ökologischer und gesundheitlicher) Gründe gibt, sich einzuschränken.
Aber das ist nur der Anfang, es geht ja an den Arbeitsplätzen in der Kunststoffproduktion weiter. Stichwort: Chemische Belastungen in den Fabriken.
Und zum Schluss: Ein erheblicher, sehr großer Teil des erzeugten Plastiks landet nach sehr kurzer Nutzungs- bzw. Verwendungszeit (Plastiktrinkflasche) nagelneu in der Umwelt. Vor allem in Ländern ohne bzw. mit mangelhaftem Recycling und Abfallbehandlung sind diese Folgen augenscheinlich in der Natur abgebildet, wo es dann möglicherweise hunderte Jahre dauert, bis der Plastikmüll abgebaut ist. Und nicht nur, dass wild deponierter und nicht recycelter Müll jährlich riesige Mengen an Treibhausgasen produziert, ist auch ein anderes Problem augenscheinlich: Mikroplastik.