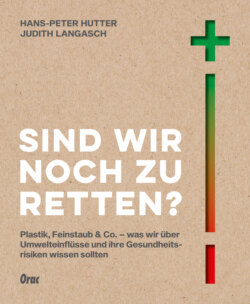Читать книгу Sind wir noch zu retten? - Hans-Peter Hutter - Страница 14
Plastikteilchen im Größenvergleich
ОглавлениеWird nicht viel Plastik einfach weggeworfen und ist damit auch Quelle von Mikroplastik?
Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge wurden bisher mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik produziert.5 Nur ein vergleichsweise kleiner Teil wird wiederaufbereitet oder verbrannt, fast 80 Prozent finden sich auf Müllhalden oder in den Weltmeeren. Das sind noch eher bekannte Fakten.
Was aber seltener den Weg in die Öffentlichkeit findet, ist die steigende Tendenz zu achtlosem Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen in der Natur oder im öffentlichen Raum. Das betrifft Getränkedosen, Plastikflaschen, Take-Away-Verpackungen oder Zigarettenstummel. Mengenmäßig dominieren häufig Plastikverpackungen und speziell Plastikflaschen. Dieses sogenannte „Littering“ findet vor allem auf öffentlichen Plätzen oder Treffpunkten, entlang stark befahrener Straßen, in der Nähe von Take-Away-Restaurants oder Tankstellen und nicht zuletzt in Naturerholungsgebieten mit vielen Besucheraktivitäten statt.
„Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu zwei Drittel aller Zigarettenstummel irgendwo in der Umwelt landen.“
Nicht sachgerecht entsorgte Zigarettenstummel sind dabei immer noch eines der größten Probleme. Das lässt sich leicht darstellen: Rund 4,5 Billionen (als Zahl: 4.500.000.000.000) Zigaretten werden jährlich weltweit nicht ordnungsgemäß entsorgt – geraucht werden 5,6 Billionen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu zwei Drittel aller Zigarettenstummel irgendwo in der Umwelt landen. Von zwölf Milliarden verkauften Zigaretten in Österreich (2019) finden sich also acht Milliarden Stummel pro Jahr in der Umwelt wieder. Sie sind damit das am häufigsten achtlos weggeworfene „Ding“. Doch aufgrund ihrer Kleinheit werden sie nach wie vor nicht als wirklich gravierender Müll wahrgenommen – und schon gar nicht als Mikroplastikquelle. Ganz zu Unrecht: Sie bestehen großteils aus dem Kunststoff Celluloseacetat, dessen biologischer Abbau sich nur langsam vollzieht. So kann es bis zu zehn Jahre dauern, bis sich ein Zigarettenfilter vollständig zersetzt hat.
Alle weggeworfenen Plastikteile zusammen enden dann irgendwann, ins Kleinste zerrieben, als diffuse Partikel-Einträge in unseren Ökosystemen.
Und alles, was in so kleiner Form in die Umwelt gelangt, landet letztendlich auch wieder in unseren Körpern. Mit Mikroplastik ist das wohl nichts anderes. Aber als gesundheitliches Risiko für den Menschen gilt Mikroplastik bis jetzt doch noch nicht?
Offen gesagt ist bisher noch nicht klar, ob, und wenn ja, wie gefährlich Mikroplastik wirklich ist. Die toxikologischen Wirkungen wurden bisher kaum untersucht. Sicher ist aber: Mikroplastikpartikel sind immer als Fremdkörper zu begreifen, weshalb sie auch immer Entzündungsreaktionen auslösen können. Das konnte an verschiedenen Meeresorganismen (z. B. Muscheln) beobachtet werden. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Wissen über die Wirkung von Mikroplastik bisher überwiegend aus Zell- und tierexperimentellen Studien stammt. An Mikroplastik können sich aber auch Weichmacher, Flammschutzmittel oder andere Problemstoffe anhaften – und einige dieser Substanzen können hormonell wirksam sein, andere wirken auf das Nervensystem, manche gelten als krebserregend.
Den größten Anteil des Mikroplastiks nehmen wir oral über die Nahrung auf. Wobei Fische und andere Meerestiere, die ihrerseits bereits Plastikpartikel aufgenommen haben, als die wesentlichsten Quellen gelten. Schließlich sind aquatische Ökosysteme und speziell die Weltmeere praktisch Sammelbecken für Kunststoffabfälle. Auch Hausstaub scheint eine besonders relevante Aufnahmequelle zu sein: Dieser besteht aus einer Mischung aus feinsten Partikeln wie Rußteilchen, Sandkörnchen oder Textilfasern und nicht zuletzt auch aus Mikroplastik.
Dass wir also Mikroplastik aufnehmen, ist bekannt und plausibel. Und natürlich auch, dass wir es wieder ausscheiden: In einer kleinen Pilotstudie haben österreichische ForscherInnen Mikroplastik im Darm von Menschen nachgewiesen. Die Kunststoffpartikel wurden in Stuhlproben von allen acht StudienteilnehmerInnen gefunden. Durchschnittlich fanden sich 20 Mikroplastik-Teilchen pro 10 Gramm Stuhl in der Größe von 50 bis 500 Mikrometer, v.a. aus Polypropylen und Polyethylenterephthalat (PET).
Eine genaue Quantifizierung der Menge, also beispielsweise wie viel Gramm jemand pro Tag aufnimmt, ist nur mittels grober Annahmen wie Ausmaß von Fischverzehr etc. möglich. So schätzten australische ForscherInnen die täglich Mikroplastikaufnahme über Nahrung, Trinkwasser und Atemluft auf bis zu fünf Gramm pro Woche.
„Förderlich für unsere Gesundheit ist aufgenommenes Mikroplastik sicher nicht.“
Bei größeren Partikeln ist davon auszugehen, dass sie über den Verdauungstrakt ausgeschieden werden. Bei kleineren Partikeln besteht hingegen die Gefahr, dass diese im Darmgewebe eingelagert werden, aber auch in den Atemwegen oder im Lungengewebe – so, wie es mit Rußpartikeln passiert. Zu solchen ultrafeinen Partikeln in der Atemluft und deren Weg und Wirken in unserem Organismus gibt es eine Fülle an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Allesamt wenig erfreulich.
Im Moment lässt sich seriös und fundiert nicht zuverlässig abschätzen, welches Risiko davon ausgeht. Aber eines kann man getrost sagen: Förderlich für unsere Gesundheit ist aufgenommenes Mikroplastik sicher nicht.
Man liest auch immer wieder, dass – eigentlich wenig verwunderlich – Mikroplastik-Rückstände im Trinkwasser gefunden werden. Einerseits heißt es von der WHO, dass das ungefährlich sei, andererseits gibt es bislang nur wenige Studien dazu. Wie kann man sich da also sicher sein?
Die WHO stellte 2019 fest, dass Mikroplastik im Trinkwasser, „basierend auf den begrenzt verfügbaren Informationen“, auf dem jetzigen Niveau kein Gesundheitsrisiko darzustellen scheine. Diese Aussage ist sicher kein beruhigendes Zeugnis für gänzliche Harmlosigkeit. Sie ist vielmehr in Relation zu anderen Risiken zu sehen, die weltweit die Gesundheit der Bevölkerung durch verschmutztes Trinkwasser bedrohen.
So sind andere Trinkwasser-Verunreinigungen, wie etwa chemische oder mikrobielle Verunreinigungen, global gesehen selbstverständlich wesentlich bedeutsamer, was das Erkrankungsrisiko betrifft, als die Aufnahme von Mikroplastik. Gerade in Ländern des Globalen Südens stehen Probleme im Vordergrund, überhaupt an einigermaßen reines Trinkwasser zu kommen. Immerhin haben nach wie vor rund zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser.
Insgesamt bedeutet das jedoch nicht, dass Mikropartikel im Trinkwasser als harmlos und als völlig irrelevant für die Gesundheit zu bezeichnen wären. Es zeigt allerdings auf, dass Vorkommen und Verbreitung von Mikroplastik gerade im Trinkwasser im Zusammenhang mit gesundheitlichen Effekten noch viel genauer untersucht werden müssen. Speziell ist die Frage zu klären, wie diese Partikel überhaupt ins Trinkwasser gelangen, damit möglichst rasch Abwehrmaßnahmen definiert und umgesetzt werden können.
Ich bin offen gesagt kein großer Fisch-Fan, aber nach allem, was du erzählst, heißt das eigentlich: Wenn man Mikroplastik vermeiden will, sollte man Fisch von der Speisekarte streichen, oder sehe ich das falsch?
Der Verzehr eines einzelnen Fisches ist sicher kein Problem. Was die Teilchen und damit verbundene Stoffe betrifft, ist diese einzelne Quelle mengenmäßig mit großer Wahrscheinlichkeit unproblematisch. Das Problem ist allerdings: Es werden laufend neue Quellen entdeckt. Plastik wird in Oberflächengewässern wie etwa in der Donau nachgewiesen, aber auch im Leitungswasser, in Mineralwässern sowie in verschiedenen Tierarten (Muscheln, Fische, Vögel), andere Forscher wiederum haben Mikroplastik in Salz, Bier oder Honig nachgewiesen. Angesichts dieser zahlreichen möglichen Aufnahmequellen könnten die aufgenommenen Plastikteilchen eine Menge erreichen, die dann möglicherweise doch ein gewisses Gesundheitsrisiko darstellen. Derzeit kann man dazu allerdings – leider – noch wenig sagen.
Das klingt alles danach, als würde die Beseitigung von Mikroplastik momentan – aus rein gesundheitlicher Sicht gesehen – nicht unbedingt auf Platz 1 unserer Prioritätenliste stehen?
Primär ist die Gefahr von Mikroplastik tatsächlich eher eine Gefahr für Ökosysteme, erst nachrangig besteht eine Gefahr direkt für die menschliche Gesundheit. Und diese Gefahren gehen nicht nur von Mikroplastik aus, sondern auch von „Makroplastik“.
Jedes Jahr landen rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren. Im Nordpazifik treibt seit Jahrzehnten ein Müllstrudel in der Größe Zentraleuropas. Bedrohlich für kleinste, kleine und große Meeresbewohner. Über 800 Spezies sind von marinen Abfällen betroffen.6 Selbst Strände unbewohnter Inseln vermüllen. Und noch immer ist vieles nur in Ansätzen erforscht, vieles unbekannt, aber plausibel. So ist der Einfluss von Plastik auf das Klima noch ungeklärt. Inwiefern etwa die immer größere Menge an Mikroplastikteilchen in den Meeren zentrale biologische Prozesse stört, wodurch die Rolle der Ozeane als Kohlenstoffsenke beeinträchtigt werden könnte.
„Im Nordpazifik treibt seit Jahrzehnten ein Müllstrudel in der Größe Zentraleuropas.“
Dennoch sind die Folgen auf Ökosysteme im Wasser besser beforscht als die Folgen der Mikroplastikverschmutzung in Ökosystemen in festen Böden. Die Folgen des Mikroplastik-Eintrages in die Bodenstruktur und Lebensgemeinschaften (von Mikroorganismen bis hin zu Regenwürmern) sind praktisch unbekannt. Dabei können die Mikroplastik-Einträge in den Böden je nach Umgebung deutlich stärker sein als beispielsweise im Meer.
Man muss sich Kunststoffe und ihre Metamorphose ansehen. Wir wissen, dass es eine völlig unkontrollierte Freisetzung von Kunststoffen gibt. Daher gilt es, die maßlose Verwendung von Plastik zu hinterfragen und auch die Sinnfrage stellen – ob man Plastikprodukte nicht einsparen und durch andere Materialien ersetzen kann, die nicht diese gravierenden ökologischen Probleme mit sich bringen. Vor allem muss man sich darüber Gedanken machen, wie die vielerorts völlig desolate „Entsorgung“ endlich deutlich kontrollierter vollzogen werden kann. Und zwar rasch. Und hier ist ebenso die Politik gefragt, die Rahmenbedingungen schaffen muss. Angefangen bei der klaren Kennzeichnung von Ein- und Mehrwegprodukten, Mindestmehrwegquoten, bis hin zum Verbot von Mikroplastik in Kosmetika und Reinigungsprodukten.
Fazit: Sind wir noch zu retten?
Wir Menschen vorerst einmal schon. Aber andere Lebewesen – speziell in unseren Weltmeeren, von der Muschel bis zur Meeresschildkröte – sind es wohl nicht mehr, wenn es so weitergeht.
Heißt also: Bequemlichkeit hin oder her. Wo man im Alltag Kunststoffe einsparen kann, sollte man das unbedingt machen. Auf ein Plastiksackerl kann jeder verzichten. Ganz ehrlich, öfter mal ein Stoffsackerl dabeizuhaben, das ist wirklich keine Einschränkung.
„Ganz ehrlich, öfter mal ein Stoffsackerl dabeizuhaben, das ist wirklich keine Einschränkung.“