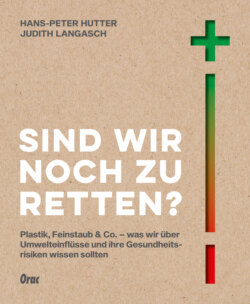Читать книгу Sind wir noch zu retten? - Hans-Peter Hutter - Страница 9
DEEP DIVE: GESUNDHEITSPROBLEM WEICHMACHER
Оглавление„Weichmacher“ sind eine viel genutzte Industriechemikalie und halten Kunststoffprodukte „geschmeidig“. Zu den wichtigsten beziehungsweise am häufigsten eingesetzten Phthalaten zählen Di-2-ethylhexyl-Phthalat (DEHP), Di-isonyl-Phthalat (DINP) und Di-butyl-Phthalat (DBP). Diese Substanzen finden sich unter anderem in Bodenbelägen, Tapeten, Folien, Beschichtungen, Kabeln, Kfz-Bauteilen, Lacken, Textilien wie Duschvorhängen, aber auch in Spielzeug, Kosmetika und in Medizinprodukten wie z. B. Infusionsschläuchen. Wesentlich dabei ist, dass die Stoffe während der gesamten Lebenszeit der entsprechenden Produkte freigesetzt werden können.
Da sie heute überall aufzufinden sind und über viele Pfade (Nahrungsmittel, Luft, Wasser, Hausstaub – speziell bei Kindern durch den Hand-Mund-Kontakt von Bedeutung) aufgenommen werden können, ist es schwer, die Gesamtbelastung gegenüber dieser Substanzgruppe abzuschätzen. Seitdem spezifische Stoffwechselprodukte dieser Substanzen im Harn bestimmt werden können, ist jedoch bekannt, dass die durchschnittliche tägliche Aufnahme etwa von DEHP höher ist als bisher angenommen. Für spezielle Bevölkerungsgruppen (Kinder!) liegt diese sogar über der zulässigen Grenze.
Obwohl Umweltschutzorganisationen immer wieder vor diesen Chemikalien gewarnt hatten, wurde viele Jahre lang die Gefährlichkeit von Phthalaten unterschätzt. Immer mehr Studien beobachten neben einem fruchtbarkeitsschädigenden auch ein hormonschädigendes Potenzial bei diesen Stoffen. Es gibt Hinweise auf Beeinträchtigung der Samenqualität bei Männern durch Phthalate und vorzeitige Geschlechtsreife bei Mädchen. Außerdem können die Chemikalien die Plazentaschranke passieren und bereits das Kind im Mutterleib beeinträchtigen.
Andere Studien wiederum belegten Einflüsse auf die Lungenfunktion und geben Hinweise auf entzündliche Effekte bei der Einatmung. So zeigte sich u.a. ein deutlicher Zusammenhang zwischen Phthalat-Konzentrationen im Hausstaub aus Kinderzimmern und dem Auftreten von Asthma, Ekzemen und Katarrhen der Nasenschleimhaut bei den betroffenen Kindern.
Anzumerken ist aber, dass nur einige Phthalate hinsichtlich ihrer toxikologischen Eigenschaften umfassend untersucht sind. Auch aus diesem Grund sollten diese Stoffe so weit als möglich vermieden werden.
Warum kann man nun nicht einfach sagen: Auf diese Chemikalie müssen wir verzichten, sie ist zu gefährlich? Wie kann es sein, dass die Beurteilung von „Plastik-Chemikalien“ so schwammig und scheinbar nicht eindeutig ist?
Eines der vorrangigen und schwierigsten Probleme ist die Beurteilung der (gleichzeitigen) Einwirkung vieler chemischer Stoffe in zumeist sehr geringen Mengen, die aus vielen Quellen stammen können. Wir nehmen im Alltag praktisch einen Cocktail aus den unterschiedlichsten Chemikalien zu uns, denn Menschen sind meist nicht nur einem (dominanten) Schadstoff ausgesetzt, sondern höchstkomplexen Substanzgemischen mit unterschiedlichen oder ähnlichen Wirkungsweisen.
Und hier konnte schon vor Jahren gezeigt werden, dass beim Einwirken von mehr als zehn Stoffen in geringerer, „unschädlicher“ Konzentration, also unter jener Schwelle, wo Effekte zu sehen sind, andere, durchaus relevante Wirkungen auftreten („Cocktaileffekt“), das heißt, sie verstärken ihre Wirkung gegenseitig.1
Nun ist es aber so, dass Chemikalien in der Regel nur als Einzelsubstanz toxikologisch geprüft werden, was die Beantwortung der Frage, welcher Stoff für welche Gesundheitsfolgen verantwortlich ist, bei gleichzeitiger Einwirkung vieler dieser Stoffe sehr schwierig oder fast unmöglich macht.
Außerdem ist bei vielen Chemikalien die Datenlage zu gesundheitlichen Effekten bei einer langfristigen, dauerhaften Belastung spärlich. Das ist zumindest für WissenschaftlerInnen wenig überraschend, denn es gibt erhebliche methodische Probleme bei der Erforschung eines Gefährdungspotenzials für die Bevölkerung. Tierexperimentelle Untersuchungen oder Zellversuche können beispielsweise die Anfälligkeit für Erkrankungen beim Menschen nur begrenzt abbilden.2 Tierversuche können auch keinen Aufschluss über Beeinträchtigungen des Wohlbefindens geben, die beim Menschen aber sehr wohl von Bedeutung sein können.
Wenn nun ein Stoff als gefährlich beurteilt und deshalb verboten wird, dann wird er von der Industrie natürlich durch chemisch ähnliche Stoffe ersetzt, damit weiterhin die gewünschte Funktion erhalten wird. Doch über diese Ersatzstoffe weiß man oft noch deutlich weniger. Es vergeht dann wieder Zeit, bis erkannt wird, dass auch diese Ersatzstoffe gesundheitlich bedenklich sind (Beispiel: Bisphenol A wird durch andere Bisphenole ersetzt).
Außerdem darf man nicht vergessen, dass selbst lange, nachdem verbotene Substanzen durch neue ersetzt wurden, die früher verwendeten noch immer in die Umwelt zirkulieren können, wenn es sich um schwer abbaubare Stoffe handelt. Solche Stoffe können noch Jahrzehnte in der Umwelt, aber auch im menschlichen Gewebe nachgewiesen werden. Oft zeigt es sich also, dass wir im Streben, uns das Leben leichter zu machen und rasch Erfolge zu erzielen, unseren Nachkommen eine Bürde auferlegen. Nicht nur im Ressourcenverbrauch leben wir auf Kosten zukünftiger Generationen.