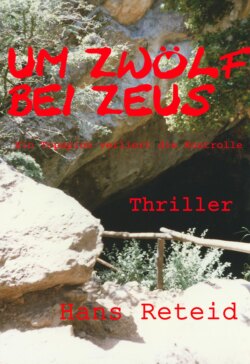Читать книгу UM ZWÖLF BEI ZEUS - Hans Reteid - Страница 10
Kapitel 4
ОглавлениеDie Haustür knallte hinter ihm zu. Es wehte ein frischer Wind durch die Oranienburger Straße. Marco Brandes schob den Kragen seines Mantels hoch und ging mit flotten Schritten in Richtung Monbijouplatz. Dort, in einer der Nebenstraßen, vermutete er seinen alten Ford. In der Linienstraße? Oder doch in der Auguststraße? Auf jeden Fall hatte er ihn nicht weit von seiner Wohnung entfernt geparkt.
Als er um die nächste Ecke bog und die Tucholskystraße einsehen konnte, stoppte er. Da stand sein alter Kombi und unmittelbar daneben ein Polizeifahrzeug. Ein Beamter hockte vor dem Ford, betrachtete das Nummernschild und schrieb etwas auf einen kleinen Block. Der zweite Polizist saß im Auto und sprach in sein Funkgerät.
Brandes wich zurück in den Eingangsbereich der Postfuhrhalterei und beobachtete von dort, wie der Beamte langsam um das Auto herum schlich, aufmerksam ins Rückfenster und in die Seitenfenster schaute.
„Wenn der sich auch noch det Profil an den Hinterreifen anguckt, legt der mir die Kiste still“, sagte er leise vor sich hin. „Kein Geld. Keine Reifen. Engpass momentan. Wenn die Sache mit Stachynskij schon gelaufen wäre, dann hätte ich jetzt Kohle satt. Drei Tausender! Aber wie soll ich det alles ohne Auto schaffen?“
Als hätten sich die nur geflüsterten Worte auf die Reise begeben, zog der Polizist ein kleines Gerät aus der Tasche, beugte sich hinter dem Fahrzeug nach unten und kam nach kurzer Zeit hoch. Er schrieb wieder etwas auf seinen Block, riss das oberste Blatt ab und schob es unter den Scheibenwischer.
„Det war’s dann, Alter!“, sagte sich Brandes. „Von jetzt an observieren aus der Straßenbahn, Verfolgungsfahrten mit dem Doppeldecker: So wird die Arbeit zu ´ner richtigen Herausforderung!“
Im selben Augenblick fühlte er sich beobachtet. Der Polizist hinter dem Lenkrad schaute ihn geradewegs an, als er wieder einmal seinen Kopf um die Hausecke geschoben hatte. Brandes sah, wie er seinem Kollegen zuwinkte und den Motor startete.
Jetzt wird’s eng, dachte er und sprintete los, an der Häuserfront der Oranienburger Straße entlang, immer mit einem Blick nach hinten. Noch sah er den Streifenwagen nicht. Er rannte an seiner Haustür vorbei. „Bloß nicht in die Falle springen! Die Adresse haben sie sicher schon per Funk abgefragt.“ Er lief, als ginge es um sein Leben. Einige Passanten sprangen entsetzt zur Seite, drehten sich kopfschüttelnd um.
„Bis zur Ecke Auguststraße muss ich es schaffen! Nur nicht wieder in den Knast.“ Er keuchte. „Scheiß Alkohol! Schlapp hat er dich gemacht, Jenosse Brandes! Gleich fällste tot um.“
Er biss die Zähne zusammen und versuchte vor den eigenen Gedanken davon zu laufen. An der nächsten Straßenecke stoppte er kurz, schaute zurück. Das Polizeifahrzeug war nicht zu sehen. Auch nicht verdeckt hinter den parkenden Autos. Er hörte zwar ein Martinshorn, aber es klang so, als würde es sich entfernen.
Brandes bog in die Auguststraße ein, mehr stolpernd als laufend. Er musste sich an der Hauswand abstützen. Ihm wurde übel. Der Magen rebellierte, und schon sprudelte der bittere Schleim aus seinem Mund. Er konnte ihn nicht zurückhalten, spuckte ihn an der rostigen Dachrinne entlang auf den Bürgersteig.
„Wie kann man nur mittags schon so besoffen sein“, schimpfte eine alte Frau, die vollbepackt mit Obst- und Gemüsetüten vorbei humpelte. „Schämen se sich nich? Jejenüber is ´ne Kirche!“
„Bin nich besoffen!“ Brandes schnappte nach Luft, winkte ab. Hat ja doch kein Zweck. Er wischte sich mit der Hand über den Mund und suchte im Mantel nach einem Taschentuch. Langsam beruhigte sich sein Magen. Er ließ die Dachrinne los, richtete sich auf und torkelte benommen weiter.
„Und wer putzt die janze Sauerei hier wieder weg?“, hörte er hinter sich eine andere Frauenstimme keifen. Sie klang endlos weit entfernt, obwohl er nur drei Hausnummern weiter gegangen war. Brandes drehte sich nicht um. Seine Schritte wurden fester, sein Gang aufrechter. Dann wechselte er zielstrebig die Straßenseite und verschwand kurz danach in einem Hauseingang.
*
„Hallo Marco! Komm rein.“
Sie war Anfang zwanzig und trug nur einen knapp geschnittenen schwarzen String und einen ebenso spärlichen BH mit Spitzen und vielen kleinen kunstvoll verzierten Löchern. Ihren gebräunten glatten Körper drückte sie so eng an Brandes, dass er mit seinen Händen zwangsläufig den nackten Po berühren musste. „Soll ick dich ein bisschen anheizen, bevor du zur Chefin jehst?“
Er blieb unschlüssig stehen. Wer war dieser Typ, der mir da auf der Treppe entgegengekommen ist? Dieses wissende Grinsen in seinem Gesicht? Und die Duftwolke? Wo habe ich solch ein Rasierwasser schon einmal gerochen?
„Hey Marco! Wo biste mit deine Gedanken? Gefall ick dir nich mehr?“
„Ach Monique. Lass det.“ Brandes schob sie zur Seite. „Sag mir lieber, wer det war. Dieser Kerl im Treppenhaus. Gerade.“
„Weiß nich. Komischer Kunde. War schon zwei-, dreimal hier. Kam unjefähr vor ´ner Stunde. Hat mit der Chefin jequatscht, die janze Zeit bloß jequatscht. Manchmal ziemlich laut. Und dann isser weg. Eben.“
„Bloß gequatscht?“ Brandes Stimme klang erleichtert. Er hasste alle so genannten Kunden von Bärbel.
Er hasste auch diesen Eingangsbereich: Den rosa Plüsch, den bunten Kitsch in allen Ecken, die vielen goldumrahmten Nacktfotos an den Wänden, diese langen feinmaschigen Vorhänge, die alles in ein so merkwürdiges Zwielicht hüllten. Er hasste das ganze Etablissement. Wenn da nicht Bärbel wäre. Bärbel Wiesheu, die Chefin, zu der er sich seit einiger Zeit hingezogen fühlte, weil sie so warmherzig und so voller Verständnis ist und, weil sie so gut zuhören kann - zuhören, ohne blöde Fragen zu stellen.
In irgendeiner Kneipe hatte sie ihn angesprochen, bei einer seiner üblichen Sauftouren. Sie hatte ihn angesprochen! Im Silberstein? Oder war es im Tacheles gegenüber? Im Obst und Gemüse oder in Clärchens Ballhaus? Jedenfalls irgendwo im Kiez der Spandauer Vorstadt, wo er sich seit der Entlassung aus dem Knast einigermaßen zu Hause fühlte.
Eigentlich war sie ja auch keine richtige Nutte. Bärbel war die Chefin über immerhin acht Mädels. Oder waren es neun? Oder sogar noch mehr?
„Beischlaf mit Freiern, das gibt’s schon lange nicht mehr bei mir“, hatte sie ihn mehrmals beruhigt. „Höchstens die Illusion davon. Die meisten sind ohnehin schon fertig, wenn ick ihnen den Pariser jlattstreiche.“ Und das hatte sie in einer sprachlichen Mixtur gesagt, der man leicht die bisherigen Stationen ihrer horizontalen Karriere entnehmen konnte: München, Hamburg und Berlin.
Da hörte er sie auch schon vom oberen Teil der großzügig geschwungenen Freitreppe herunter kommen: „Monique, bitte ruf doch mal die Susi an und Carmen und Cornelia. Und die drei Neulinge. Heute Abend, so ab zweiundzwanzig Uhr. Ich brauche euch alle, meine Lieben. Wirklich alle. Es kommt wieder eine Delegation aus Bonn.“
Mitten auf der Treppe blieb sie überrascht stehen. „Marco, mein Liebling! Was machst du schon so früh hier?“ Sie streckte ihm beide Arme entgegen und ging weiter.
Brandes bewunderte die Art, wie sie eine Treppe abwärts schritt, wie sie einer Tänzerin gleich die Füße aufsetzte und wie sie die Hüften dabei bewegte. Er kam sich, wenn er an seine Art zu gehen dachte, reichlich unbeholfen vor. Und jetzt stand er da auch noch in seinem ausgebeulten alten Wintermantel. Monique war fast nackt und Bärbel trug ein dünnes, langes, hellgrau glänzendes Seidennegligé. Etwas verlegen drehte er an einem Mantelknopf.
Sie kam die restlichen Stufen herunter und nahm ihn in die Arme. Er liebte ihren Duft und fühlte es gern, wenn ihre weichen Haare über seine Wangen streiften. Der Duft erinnerte ihn an Gisela. Ebenso das geheimnisvolle Leuchten in ihren Augen.
„Marco, was ist mit dir? Siehst ja aus, als hätteste rückwärts gefrühstückt.“
„Hab noch gar nicht gefrühstückt“, brummte er und löste sich aus ihrer Umarmung.
„Komm mit nach oben“, sagte sie besorgt. „Ich mach dir ´ne anständige Brotzeit mit Weißwürschterln und ´nem echten bayerischen Bier dazu“.
„Bloß kein Bier!“, wehrte er ab. „Und keine Weißwurst! - Zwieback und Kamillentee, das könnte ich jetzt gebrauchen.“
„Ja, ja. Des kriegen ma scho wieder hin.“ Sie schob ihn vor sich her die Treppe nach oben. „Und nach der Brotzeit gibt’s noch a Busserl und a bisserl Brusttee. Und dann steht er wieder wie ´ne Eins, der Kleine.“
*
Brandes ließ sich erschöpft auf das Ledersofa plumpsen. Bärbels Wohnzimmer war tabu für Freier, aber er gehörte ja inzwischen zur Familie, sozusagen. Sie hatte es im bayerischen Landhausstil eingerichtet, mit einem kleinen Herrgottswinkel in der Fensterecke. Ein Stückchen Heimat, das sie auf all ihren Stationen in Ehren gehalten hatte, auch wenn sie ihr Elternhaus verachtete.
„Erzkatholisch war der Vater“, hatte sie ihm einmal erzählt. „Und ein Monarchist. Ein ganz ein Frommer. Sogar Kassierer im Kirchenvorstand ist er gewesen. Und die Mutter hat ihn fast nicht wieder aus dem Beichtstuhl heraus gekriegt, als man ihm berichtet hatte, womit seine einzige Tochter ihre Semmeln verdient.“
Brandes liebte ihre Art zu sprechen, diese Mischung aus Bayerisch mit Berliner Akzent und den gelegentlichen Ausflügen in das steife mit der Zunge angestoßene norddeutsche „Es-Te“. Bärbel konnte sich hervorragend auf ihre Kunden einstellen. Notfalls sprach sie sogar ganz vornehm und mit akademischen Fachausdrücken. „Kundenorientiertes Einfühlungsvermögen“ nannte sie das. „Die Spezialität meines Hauses ist das ganzheitliche Bumsvergnügen.“
Sie brachte den Kamillentee. „Zwieback hab ich nicht, mein Lieber. Tut´s auch Knäckebrot? Oder magst lieber Butterkeks?“
„Egal. - Nein, Keks.“
„Ziemlich wortkarg biste heute.“ Sie reichte ihm die Keksdose, setzte sich zu ihm auf das Sofa und streichelte über seine Schenkel. „Was ist los?“
Brandes erzählte, während er den heißen Tee schlürfte, sein Erlebnis mit der Polizei und, dass sein Auto wohl stillgelegt werden würde, weil er sich im Moment keine neuen Reifen leisten könnte.
„Und wie viel brauchste dafür?“, fragte sie und zog einen Fünfhunderter aus der Seitentasche ihres Negligés. „Hier nimm. Oder reicht das nicht?“
Brandes wehrte ab.
„Komm, zier dich nicht so. Hast mir auch schon oft geholfen. Da! Nimm!“
Zögernd faltete er den Geldschein zusammen und schob ihn in die Jackentasche. Dabei blieb sein Blick starr auf die Keksdose gerichtet.
„Vielleicht sollte ich dir, statt Reifen, besser ´n ganzes Auto kaufen“, sagte sie und lächelte herausfordernd. „So ´n ganz flotten Flitzer. Weißt du, so einen mit Funkgerät oder so ´nem Autotelefon. Dann kann ich dich schnell mal anbimmeln, wenn ich Lust kriege.“ Dabei streichelte sie wieder herausfordernd über seine Schenkel.
„Haste denn Lust auf mich? So zwischendurch mal?“
Bärbel sagte nichts, stand betont langsam auf und öffnete mit verführerischer Pose ihr Negligé, tänzelte zur Stereoanlage, drückte auf einen Knopf, und während aus den Lautsprechern leise die Hammondorgel mit dem Lied „Je t`aime“ einsetzte, ließ sie nach und nach ihre Hüllen nach unten gleiten. Nur mit Strapsen und Strümpfen bekleidet kam sie zum Ledersofa zurück.
Speck hat sie um die Hüften gekriegt, dachte Brandes. Aber so janz ohne Griffleiste, det is ooch nix. Und dann griff er beherzt zu. Bärbel quietschte vor Vergnügen.
*
Die schwere Haustür knallte wie gewohnt ins Schloss. Aber das Licht im Treppenhaus schaltete sich nicht an. Brandes beschlich sofort wieder dieses Gefühl, das ihn schon seit Tagen beunruhigte, wenn er in seine Wohnung zurückkehrte. Er drückte erneut auf den Schalter. Es blieb dunkel. Blitzschnell lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Tür, hielt den Atem an und lauschte gespannt in den Hausflur.
Langsam gewöhnten sich die Augen an die Dunkelheit. Der Schimmer der Straßenlampen, der durch das gelbgrüne Oberlicht über ihn hinweg auf die Fußbodenfliesen schien, ließ das Rautenmuster gespenstisch aufleuchten. Die schwarzen Kacheln erschienen wie ausgestanzte Löcher inmitten eines Netzes aus phosphoreszierenden Fäden. Brandes fing an, die Löcher zu zählen und dachte dabei: Wenn sich am Ende nichts bewegt hat im Treppenhaus, denn war´s wieder bloß blinder Alarm.
Er wartete noch einen Augenblick. Eine Straßenbahn fuhr vorbei. Dann zog er die Schuhe aus und schlich vorsichtig die Treppe hinauf, immer darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen, um beim kleinsten fremden Rascheln sofort reagieren zu können.
Es blieb still. Auch als er den Schlüssel vorsichtig herumdrehte, die Korridortür öffnete und mit angehaltenem Atem die Wohnung betrat.
Plötzlich strauchelte er. Es war, als würde ihm jemand den Teppich unter den Füßen wegreißen. Er konnte sich nicht halten, fiel auf den Boden, und dann hörte er es auch schon: Dieses kalte Klicken, wenn der Hahn eines Revolvers gespannt wird. Er hörte es zusammen mit dem Zuschlagen der Wohnungstür. Aber er wusste genau, es waren zwei Geräusche.
Jemand sprang auf ihn, drückte mit aller Gewalt ein spitzes Knie in den Rücken und drehte ihm den rechten Arm nach hinten. Gleichzeitig spürte er, wie seine Füße umwickelt wurden, blitzschnell. Es waren mindestens zwei Personen, die sich mit ihm beschäftigten. Dann wurde es schwarz vor seinen Augen.
*
Der Schmerz war unerträglich. Er zog vom Hinterkopf durch das Rückenmark bis in die Hüfte und von dort durch beide Oberschenkel bis in die Zehen. Langsam wich der Schleier aus dem Gesichtsfeld. Die Stimmen der zwei Männer hatte er schon längere Zeit gehört, auch den russischen Akzent des einen. Der andere sprach sehr leise.
Brandes merkte jetzt, dass sie ihn auf seinem Schreibtischsessel festgebunden hatten, die Hände auf dem Rücken. Sein Zimmer war total verwüstet: die Regale von der Wand gerissen, die Matratze seiner Liege aufgeschlitzt, die Seitenfächer des Schreibtisches ausgeräumt. Nur die kleine Schublade unter der Schreibplatte, in der er unter anderem die Pistole aufbewahrte, schien unangetastet. Schließlich saß er unmittelbar davor.
„Err macht Augen auf“, hörte er den einen sprechen, einen dürren Kerl mit ungepflegten Bartstoppeln, langen Haaren und einem fleckigen Mantel. Er kam auf Brandes zu, klatschte mit beiden Händen gleichzeitig gegen seine Wangen. „Häii!“, schrie er dabei. „Mach Augen auf, ganz weit. Und Ohrren. Damit du alles gut gucken und hörren, was Borris will von dirr.“
Brandes schaute an ihm vorbei. Der Mann auf dem alten roten Ledersessel neben dem Fenster interessierte ihn mehr. Er war elegant gekleidet, trug einen dunklen Anzug und glänzende Lederschuhe. Seinen Tuchmantel hatte er akkurat über die Lehne gehängt.
„In die Augen sollst du Borris gucken!“, schimpfte der Dürre und schlug Brandes ins Gesicht.
Marco schüttelte sich, holte tief Luft und schrie auf Russisch: „Lass das, du Ratte!“ Und dann leiser, schon fast höflich und in perfektem Russisch an den Mann im Sessel gewandt: „Wenn Sie Informationen von mir möchten, mein Herr, müssen Sie mich schon direkt fragen. Am besten, bevor ...“, und jetzt wurde er wieder lauter und schaute seinem Gegenüber scharf in die Augen, „... bevor mich dieses Scheusal hier in Stücke zerlegt!“
Der Dürre schnaufte vor Wut, holte mit seinem rechten Arm weit hinter sich aus und wollte gerade losschlagen, da rief der Mann im Sessel: „Stoy!“, und fügte noch etwas hinzu, das Brandes nicht verstand. Dieser Dialekt war ihm fremd. Der Mann redete plötzlich, während der Dürre langsam und widerwillig seinen Arm nach unten sinken ließ, in fast akzentfreiem Deutsch weiter: „Sie haben gestern gegen vierzehn Uhr ein Geschäft in der Charlottenburger Kantstraße fotografiert. Warum?“
„Ich fotografiere leidenschaftlich gern.“
„Geschäfte oder Menschen?“
„Manchmal beides.“
„Und wer bezahlt Sie dafür?“
„Kommt drauf an.“
„Wer habe ich gefragt! Wer ist ihr Auftraggeber?“
„Muss ich einen haben?“
Der Dürre trat näher an Brandes heran, beugte sich über ihn und grinste mit weit geöffnetem Mund. Sein Körpergeruch war unerträglich. Von dem Mundgeruch wurde Brandes übel. Sein Magen krampfte sich zusammen. Er begann zu würgen. Als der Dürre das sah, drückte er mit seiner Hand auf den Kehlkopf, immer kräftiger, immer fester. Vor Brandes Augen drehte sich plötzlich alles.
Dann ließ er wieder los und trat einen Schritt zurück. Brandes schnappte nach Luft.
„Stachynskij“, hörte er den Mann im Sessel sagen. „Ihr Auftraggeber ist Stachynskij. Stimmt’s?“
Brandes schwieg.
Der Mann stand auf, schob den Dürren beiseite und sagte siegessicher: „Stanislav Stachynskij können Sie vergessen. Den gibt´s nicht mehr.“ Dabei streifte er sorgfältig seine Lederhandschuhe glatt.
Brandes erschrak. Stachynskij tot?
Der Vornehme zog eine Drahtschlinge aus seiner Jackentasche und ließ sie langsam vor Brandes Gesicht baumeln, so als wollte er ihn gleichzeitig warnen und hypnotisieren.
Scheiß auf die drei Tausender, dachte Brandes, während seine Augen der Drahtschlinge folgten. Dass der Auftrag gefährlich war, hätte ich mir denken können. Und Stachynskij ist eben ein Schlitzohr. Schon damals, als er noch für Schalck-Golodkowski krumme Geschäfte einfädelte, mit Ost und West gleichzeitig. Stachynskij war nicht einmal sein richtiger Name.
„Wo ist der Film?“ Der Vornehme riss ihn mit scharfer Stimme aus seinen Gedanken, spannte die Drahtschlinge zwischen den Händen, zupfte mit dem kleinen Finger daran und hielt sie so an das Ohr, das Brandes die Schwingungen deutlich als hohen Ton wahrnahm.
Brandes sagte kein Wort. Aber in seinem Kopf hämmerten die Gedanken: So will ich nicht sterben! So nicht. Und wenn das Leben noch so beschissen ist: Genau an diesem jämmerlichen Rest, an dem hänge ich. Und zwar sehr!
„Wo?“
„Im Kühlschrank“, sagte er mit gepresster Stimme.
„Wo genau?“
„Im Gemüsefach, zwischen den Salatblättern.“ Schade um das gute Versteck, dachte er im Stillen weiter. Aber wenn´s nur diese Chance gibt? Solche Typen fackeln nicht lange.
Der Dürre verschwand lachend in der Küche. Brandes hörte ihn, wie er mit lautem Getöse den Kühlschrank aufriss, die Gemüseschale und andere Teile polternd auf die Erde warf.
„Ha!“, hörte er kurz danach einen freudigen Aufschrei. Und schon sah er den Dürren triumphierend mit dem schwarzen Filmdöschen im Türrahmen stehen. „Ha!“, rief er noch einmal und zeigte dabei seine unförmigen gelben Zähne.
Der Vornehme rollte die Schlinge zusammen, nahm das Filmdöschen, hob den Deckel kurz ab, schob seinen kleinen Finger hinter vorgehaltener Hand hinein und lächelte zufrieden. Dann steckte er alles in die Tasche und sagte:
„Wenn die Bilder gut sind, hören Sie von uns. Wenn da was anderes drauf ist, hören Sie erst recht von uns. Herr Brandes!“ Die letzten beiden Wörter betonte er drohend.
„Und denk dran: Borris findet dich!“, hörte Brandes den Dürren sagen. Dann fühlte er einen stechenden Schmerz am Kinn, seine Kieferknochen schlugen gegeneinander, der Kopf flog nach hinten. Ihm war, als hätte jemand das Licht ausgeknipst.
*
Er wollte aufstehen. Doch die Füße versagten. Er wollte sich mit den Händen abstützen. Es ging nicht. Brandes stemmte sich mit ganzer Kraft gegen alles, was ihn am Fortgehen hinderte. Er strampelte mit den Füßen, dehnte und streckte sich. Der Gedanke, ein Gefangener zu sein, machte ihn rasend. Er kam nicht von der Stelle. Der Kopf schmerzte und besonders sein Kinn.
Dann gelang es ihm doch, die verklebten Augen einen Spalt zu öffnen, und er sah sein durchwühltes Zimmer. Und nach und nach bemerkte er die feine Kunststoffschnur, mit der man ihn auf seinem Bürostuhl festgezurrt hatte. An den Handgelenken, die auf dem Rücken zusammengebunden waren, schnitt sie schmerzhaft in die Haut.
Ganze Arbeit, dachte Brandes. Profis. Hätten mich auch sofort umlegen können. Aber die stehen wohl eher auf langsamem Tod. Mord auf einem gottverdammten Bürostuhl! Durch Austrocknen. Verhungern. Oder so ähnlich.
Mit den zusammengebundenen Füßen konnte er den Boden berühren und sich schubweise ein wenig abstoßen. Die Rollen unter dem Stuhl bewegten sich schwerfällig auf dem Teppichboden. Er kam nur langsam weiter, Zentimeter, manchmal nur Millimeter.
„In der Küche, auf dem Linoleum, wird es leichter sein“, flüsterte er sich Mut zu. „Und in der Höhe, in der die Hände gefesselt sind, müsste es mit etwas Geschick möglich sein, an die Besteckschublade mit den Messern zu gelangen.“
Die Küchentür stand offen. Aber davor versperrten auf dem Fußboden mehrere Regalbretter und Aktenordner das Weiterrollen. Die Ordner ließen sich zur Seite schieben, aber die Bretter hatten sich ineinander verkeilt. Außerdem rutschte Brandes mit seinen Strümpfen immer wieder auf der glatten Oberfläche ab. Er versuchte es mit Gewalt, stemmte sich gegen den Türpfosten und drückte die Rollen ruckweise gegen die Bretter, immer wieder. Sie gaben etwas nach. Aber dann schwankte der Stuhl. Brandes verlor das Gleichgewicht, fiel nach hinten, stieß mit dem Kopf gegen die Tür, rutschte nach unten und lag auf dem Rücken in der Küche.
„Au! Verdammt!“, schrie er. Seine Finger waren zwischen Rückenlehne und Fußboden eingeklemmt. Wie eine hilflose Schildkröte kam er sich vor und jeder Versuch, durch Gewichtsverlagerung auf die Seite zu rollen, erzeugte höllische Schmerzen in den Fingern und Handgelenken. Wenn da nicht schon was gebrochen ist, dachte er.
Er biss die Zähne zusammen, hielt den Atem an und versuchte es noch einmal. Zuerst nach rechts. Dann nach links. Über die Hände hinweg. Und noch einmal. Es gelang ihm erst nach mehreren Versuchen, auf die Seite in eine stabile Lage zu rollen. Er bewegte die Handgelenke und die Finger. Sie schmerzten entsetzlich, aber er spürte sie. Sie waren nicht taub. „So kann ich det aushalten, zumindest fürs Erste“, sagte er leise. „Auch im Koppe. So jeht det.“
Das Blut pochte in den Schläfen und ihm war, als würden die Gedanken wie in einem riesigen Strudel immer schneller kreisen: Man müsste sie alle umbringen. Alle! Die ganze Brut: CIA, MAD, BND, MI6 und wie sie heißen. Sonst hört det nie auf. Sein Kopf dröhnte: Observieren, sabotieren, spionieren. Wachsam sein immerzu.
Mit einem Male war er hellwach. Er spürte, dass sich die stramme Kunststoffschnur etwas gelockert hatte, und je mehr er sich von der Sitzfläche nach oben bewegte, umso lockerer wurde sie. Er drückte noch einmal mit den Knien von unten dagegen und zog gleichzeitig die Arme und Schultern hoch. Das war die Lösung! Die Rückenlehne lief nach oben konisch zusammen. Mit etwas Geduld müsste es gelingen, sich aus den Fesseln herauszuwinden.
Brandes schob und drückte, rekelte und streckte sich. Aber es gelang nicht so leicht, wie er gehofft hatte. Der Dürre hatte ganze Arbeit geleistet und die Schnur in zahlreichen Windungen gewickelt; wenn die unteren nicht gleichmäßig mit nach oben gedrückt wurden, zogen sie sich auseinander und alles wurde wieder stramm. Außerdem schmerzte der linke Arm, auf dem das ganze Körpergewicht ruhte.
„Scheiße!“, fluchte Brandes und blieb einen Augenblick erschöpft liegen. Es war ihm, als würde das ganze Gebäude seiner halbwegs sortierten Gedanken zusammenbrechen. Alles wirbelte durcheinander. Im Augenblick geht aber auch alles schief, dachte er: Stachynskij tot. Auftrag im Eimer. Drei Tausender futsch. Das Auto lahmgelegt. Und bei Bärbel krieg ich ihn nich mehr so steif wie früher.
Dann versuchte er wieder, nach oben zu rutschen. Zentimeterweise arbeitete er sich weiter. Der linke Arm war das größte Problem. Er konnte ihn kaum bewegen. Nach zehn Minuten musste er wieder eine Pause einlegen. Die Kleidung war schweißnass. Die Haut juckte. Er atmete wie nach einem langen Dauerlauf, kam sich ziemlich elend vor.
Ackermann! Wie ein Blitz schoss ihm wieder dieser Name durch den Kopf. „Dieser verdammte Ackermann!“, schimpfte er. „Der ist an allem Schuld! Hätte der sich damals nicht zwischen Gisela und mich gedrängt, müsst ich jetzt nicht auf dem Fußboden liegen, in dieser gottverdammten Küche hier, zwischen Salatblättern, aufgeplatzten Joghurtbechern und Ketchup-Flaschen - gefesselt und gedemütigt. Alles wäre anders! Mit Gisela hätte ich sogar den Absprung geschafft.“
Das Bild aus Bad Ems: Er fühlte es in seiner Jackentasche; er sah es vor sich. Ja, so müsste es werden, genau so: Ackermann, der elende Bettler. Und ich, der Millionär!
Brandes spürte, wie sein Herz zu rasen anfing, während er sich in Gedanken die Situation und die weiteren Schritte ausmalte. Irgendwie war es gar nicht so verkehrt, dass Ackermann bei dem Bombenanschlag nicht draufgegangen ist. Ein Wink des Schicksals! Vielleicht komm ich jetzt an seine Forschungsunterlagen, jedenfalls solange er in irgendwelchen Kliniken festgehalten wird. Neue Keramikbeschichtung in Flugzeugtriebwerken? Det wird sicher fürstlich bezahlt. Und wie sagt der pfiffige Bauer? Nur lebende Kühe kann man melken! Det ist die Chance! Die muss genutzt werden, bevor da wieder ein anderer ins Handwerk pfuscht.
Mit neuer Kraft drehte und wälzte er sich aus den Fesseln.