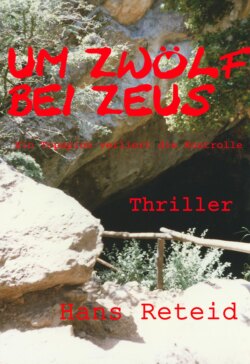Читать книгу UM ZWÖLF BEI ZEUS - Hans Reteid - Страница 8
Kapitel 2
ОглавлениеEr schwankte, hielt sich am Treppengeländer fest, blieb stehen, verschnaufte einen Augenblick.
„Keine Müdigkeit, Jenosse Brandes“, trieb er sich wieder an und nahm die letzten Stufen. Als er das Schlüsselloch der Korridortür auf Anhieb traf, schwärmte er: „Siehste, jeht doch. Det Bier im Tacheles is nun mal det beste Sszielwasser.“
Beim Öffnen der Tür entglitt ihm die Tüte, die er die ganze Zeit wie ein Kellner auf der linken Hand balanciert hatte. Erst kurz über dem Boden fing er sie wieder auf. „Det ma bloß nix an die Currywurst kommt.“ Er lachte dabei übertrieben.
Mit zu viel Schwung erreichte er das Arbeitszimmer und stieß dort gegen den Schreibtisch. Die Tüte fiel auf die Platte, riss an der Seite auf. Eine Wurstscheibe rollte heraus, zog in Schlangenlinien eine rote Spur. Brandes kicherte, ging weiter, knipste den Fernsehapparat an, zog sich im Zurückgehen umständlich den Mantel aus, wankte zur Korridortür, stieß sie mit dem Fuß zu und warf den Mantel über den Garderobenständer. Der schwankte ihm entgegen. Er fing ihn auf und drohte mit erhobenem Zeigefinger: „Wer hat hier zu viel jesoffen? Du oder icke?“ Er stellte ihn gerade und schlich an der Wand entlang in die Küche. „Muss noch ´n Bier, damit die Pommes besser flutschen.“ Ein kräftiger Rülpser beendete den Satz.
Es dauerte eine Weile, bis er mit Besteck und geöffneter Bierflasche an seinen Schreibtisch zurückkehrte und das verspätete Abendessen anfangen konnte. Inzwischen hatte im Fernsehen das Nachtmagazin angefangen. Ein Filmbericht aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok flimmerte über den Bildschirm. Im Vorfeld des Europa-Asien-Gipfels seien Bundeskanzler Helmut Kohl und Chinas Premierminister Li Peng zusammengetroffen, um über den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu beraten, erläuterte der Nachrichtensprecher.
„Kiek mal, der Helmut“, lachte er und zeigte mit einigen aufgespießten Pommes frites in Richtung Fernseher, „da strahlt er und schüttelt dem alten Peng die Hand. Und hier bei uns, da kiekt er immer muffig und meckert über die roten Socken.“ Ein Rülpser setzte erneut den Schlussakkord.
Das Thema wechselte. Ein Bild von Konrad Porzner wurde eingeblendet. Wegen Unstimmigkeiten mit dem Kanzleramt habe der Chef des Bundesnachrichtendienstes die Versetzung in den Ruhestand beantragt, und Bundespräsident Roman Herzog habe auf Anraten des Kanzleramtsministers Bohl bereits dem Wunsche Porzners entsprochen.
„Schade“, kommentierte Brandes und spülte sich mit einem kräftigen Schluck aus der Bierflasche den Mund leer. „Die nennen den alle den Glülücklosen von Pullach. Dabei war det echt ´n Glücksfall - für uns, zssumindest. Prost Konni!“
Die nächste Meldung ließ ihn aufhorchen:
„Osnabrück. Heute Vormittag ist es während einer akademischen Feierstunde in der Fachhochschule Osnabrück zu einem Sprengstoffanschlag gekommen. Es gab einen Toten und zahlreiche Verletzte. Sehen sie hierzu einen Bericht unseres Reporters Gerhard Wunse.“
Die Kamera schwenkte über die Dächer Osnabrücks mit der Katharinenkirche, dem Dom, der Marienkirche, den Windrädern auf dem Piesberg und blieb einen Augenblick auf die Rauchsäule gerichtet, die über den Hochschulgebäuden am Westerberg schwebte. Schnitt.
Es folgte ein Interview mit einem Polizeisprecher. Im Hintergrund hektisches Treiben und laute Geräusche von Löschfahrzeugen und Notstromaggregaten.
Der Sprecher erläuterte, dass es sich bei dem Toten um den britischen Professor Bryan Scantlebury handeln würde, einen international renommierten Wirtschaftswissenschaftler, der während des heutigen Festaktes wegen seiner Verdienste für die Entwicklung deutsch-britischer Studienangebote zum Ehrensenator ernannt werden sollte. „Da er kürzlich wegen eines Zeitungsartikels gegen den Terror in Nordirland in die Schusslinie der Irisch-Republikanischen-Armee geraten war, ist nicht auszuschließen, dass die Bombe auf das Konto dieser Terrororganisation geht.“
Nun wurden kurze Ausschnitte aus einem Amateurvideo eingeblendet: die Reihe der Ehrengäste in der Aula, die festlich geschmückte Bühne, Professor Scantlebury im Gespräch mit Berthold Ackermann. Dazu der Kommentator:
„Professor Ackermann, der Vizepräsident der Hochschule, wurde bei diesem Anschlag schwer verletzt. Die Bombe explodierte in dem Augenblick, als er die Bühne betrat, um die Festveranstaltung offiziell zu eröffnen. Seit den Abendstunden wird vermutet, dass der Anschlag eventuell auch im Zusammenhang mit Ackermanns Forschungsarbeiten stehen könnte. Die von ihm neu entwickelte Keramikbeschichtung in Flugzeugturbinen ist nämlich für den britischen Triebwerkhersteller Rolls-Royce ...“
Brandes sprang auf. „Welcher verdammte Idiot war das?“
Er trat gegen den Schreibtischsessel, stolperte fluchend in die Küche, riss die Kühlschranktür auf und fing an, zwischen Käsetüten, Aufschnittpäckchen und Jogurtbechern aufgeregt nach etwas zu suchen: eine Flasche Wodka! Er hatte sie selbst versteckt. Im Eisfach, ganz hinten.
Hastig schraubte er den Verschluss ab und goss den kalten Schnaps in sich hinein, als könnte er nur so das krampfartige Reißen in seiner Brust betäuben. Im Hintergrund war noch die Stimme des Reporters zu hören. Er berichtete von zahlreichen Prominenten mit erheblichen Verletzungen; darunter der Bischof von Osnabrück, der Oppositionsführer des niedersächsischen Landtages und der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung.
Brandes schluckte weiter. Seine Finger schmerzten von der Eiskruste an der Flasche. Er schluckte, schluckte - und setzte die Flasche erst ab, als die Kälte ihm die Kehle zuschnürte. Hustend hielt er sich am Kühlschrank fest, knallte die Flasche auf die Ablage. In seinem Magen rumorte es. Er musste würgen, rannte los in Richtung Toilette, blieb mit der Schulter am Türrahmen hängen, fluchte, löste sich wieder, stolperte weiter. Sein Gesicht: eine Grimasse.
*
Brandes saß aufrecht im Bett, rieb sich die Augen, wischte mit dem Hemdsärmel über die Stirn. Sein Herz jagte. Ein Schrei hallte in seinen Ohren, verzerrt, wie aus einem vorbei rasenden Zug. Er hatte sich angehört wie „Rache!“
Die blassrosa Leuchtreklame von der anderen Straßenseite warf flackrige Schatten an die Wand. Dazwischen entdeckte er, wenn auch nur verschwommen, die kleine minoische Doppelaxt, den vertrauten Kalender mit den farbigen Steckwürfeln und daneben das silberfarbige Holzbrett mit der Collage aus aufgeklebten Dioden, Transistoren, Widerständen und bizarr verwinkelten Drähten: Erinnerungsstücke aus vergangenen Zeiten, wie sie nur in seinem Zimmer, dem Kombizimmer, hängen konnten. Das beruhigte ihn.
Er rutschte auf die Bettkante, stemmte sich hoch und schlurfte zur Toilette. „Wieso muss ich nachts eigentlich mehr unten rauspissen, als ich tagsüber oben reinschütte?“, schimpfte er. „Fehlkonstruktion - verdammte!“
Erst als er wieder den Weg zurück auf den Rand seines Bettes gefunden hatte und diese stechenden Schmerzen im Nacken und am Hinterkopf spürte, ahnte er, dass er nach dem Zusammentreffen mit Stachynskij noch in mehreren Kneipen heftig zugelangt haben musste. Der faulige Geschmack im Mund und der Geruch, der nach jedem Aufstoßen in die Nase strömte, waren weitere Indizien.
„Und wie bin ich nach Hause gekommen? Weshalb hab ich noch Schuhe an? Und det Hemd? Und die Hose?“
Er versuchte sich zu erinnern, krampfhaft. Aber da war nichts! Kein noch so kleiner Gedankenzipfel. Nur dumpfe Leere im Kopf und diese entsetzlichen Schmerzen; sie kamen und vergingen im Rhythmus des Pulsschlages.
Drei Uhr sieben zeigte der Radiowecker mit roten Leuchtziffern. Zu früh, um aufzustehen.
Brandes zog sich im Sitzen aus, schob die Beine unter die Bettdecke. Mit den Händen massierte er Hals und Schultern. Dadurch wurden die Schmerzen erträglicher. Sein Blick streifte über die Wand und blieb auf dem Kalender mit den Steckwürfeln hängen.
Stiepnaya! Wie ein Geschoss bohrte sich dieses Wort durch sein Gehirn. Selbst in der kasachischen Steppe ist er mir in die Quere gekommen: dieser gottverdammte Ackermann!
Stiepnaya! Die große Hoffnung nach der Flucht aus Bad Ems 1973 und dem Scheitern im amerikanischen Hartford einige Jahre später.
„Für die BRD und die USA bist du verbrannt“, hatte Oberst Warnke im Ministerium für Staatssicherheit gesagt, damals, so im Frühjahr 79 muss das gewesen sein. „Aber die Jenossen vom KGB schätzen deine besonderen Fähigkeiten. Immer noch. Sie wollen dich in der Stiepnaya für Italien präparieren. Siehst ja schließlich aus wie ein Italiener. Oder?“
Brandes legte sich auf den Rücken, zog die Decke langsam bis unters Kinn und starrte auf die Wand.
Stiepnaya! Wo war die eigentlich? Wo genau?
Er erinnerte sich dunkel an eine Akte. Während seiner Zeit bei der Schule für Nachrichtenwesen in Bad Ems hatte er sie wegen einer kleinen Unachtsamkeit des Verschlusssachenverwalters kurz durchblättern können. Als Fabrik für russische Spione in den romanisch sprechenden Ländern wurde sie darin beschrieben und an der nördlichen Grenze Kasachstans vermutet, in der Nähe von Schkalow. Er erinnerte sich auch an Zeichnungen mit den verschiedenen hermetisch abgeschirmten Sektionen innerhalb des riesigen Areals: für Frankreich im nordwestlichen Teil, Spanien im Norden, Italien im Nordosten und für Portugal, Brasilien, Argentinien, Mexiko im Süden.
Ähnliche Einrichtungen gab es, so hatte er gelesen, auch für andere Sprachregionen. Die Prakowka, zum Beispiel, für Deutschland und für die nordeuropäischen Länder. Sie lag bei Minsk.
Alle waren sie nach dem Vorbild der Gatschina aufgebaut. Über die Gatschina bei Kuibyschew gab es reichlich Material. Sie war die berühmteste dieser Art, speziell für die Agenten in den englischsprachigen Ländern: eine fast naturgetreue Nachbildung städtischen und dörflichen Lebens mit Kneipen, Friseur und allem, was dazugehört. Zehn Jahre dauerte das Training in der Gatschina. Zehn Jahre Leben mit englischem Namen unter englischen Verhältnissen, oder amerikanischen. Meisterspione wie Gordon Lonsdale, Reginald Kenneth Osborne oder Geoffrey Nobel hatten dort ihre Ausbildung erhalten. Niemand wollte nach ihrer Enttarnung glauben, dass sie in Wahrheit Russen waren.
Stiepnaya! Eine Ausnahme für jemanden, der kein Bürger der Sowjetunion war. Eine seltene Ausnahme. Zumal die jungen russischen Agenten, selbst nachdem sie die Marx-Engels-Schule in Gorkij und anschließend die weiteren Etappen in Moskau und Werchownoje absolviert hatten, nicht im Geringsten etwas von der Existenz der Gatschina, Stiepnaya oder Prakowka ahnten. Ein Schauer kroch über seinen Rücken.
*
„Ich hoffe, du bist dir der jroßen Ehre bewusst, Jenosse Brandes“, hatte mich Oberst Warnke damals verabschiedet und mir noch den Satz nachgerufen: „Wolf und Mielke erwarten von dir, dass du unsere Sache würdig vertrittst. Also, keine Weibergeschichten diesmal! Hörst du?“ Und noch etwas vom „Sieg des Sozialismus“ flatterte hinterher. Aber das war irgendwie untergegangen, im Echo des langen Flurs.
Dann dieser Schock, unterwegs, im Bahnhof von Kuibyschew. Ich sehe es wieder deutlich, spüre es in den Muskeln, den Knochen, wie sie mich einem Schwerverbrecher gleich aus dem Zug gerissen, in einem abgedunkelten Wagen auf holprigen Wegen stundenlang umhergefahren und anschließend in eine feuchte, stinkende Zelle geschubst haben. Ohne irgendein Wort.
Ich weiß nicht mehr so genau, wie lange ich darin gestanden oder gelegen habe. Aber dieser Gestank von Urin und Angstschweiß, der steigt wieder in die Nase. Und dieser Ekel, der immer aufkam, wenn ich mich vor lauter Erschöpfung nicht mehr auf den Beinen halten konnte und im Halbschlaf auf diese widerliche Matratze plumpste. Oder wie ich in dem Verhörraum stehen musste, bewegungslos, mit dem Gesicht zur Wand ...
*
„Hände in den Nacken!“, höre ich eine Stimme im Hintergrund, in beinahe akzentfreiem Deutsch, unüberhörbar roh und mit sadistischem Unterton. Immer wieder peitscht dieser Satz durch die Stille, bei jeder kleinen Regung. Der Schmerz in der Schulter nimmt zu. Arme, Beine, Füße werden von Minute zu Minute schwerer. Jeder Teil des Körpers, jedes noch so kleine Fingerglied fühlt sich an, als würden Tonnen voller Müdigkeit daran hängen.
Eine Verwechslung? Ich hab Angst um mein Leben. Alle guten Worte sind bisher abgeprallt. Die russischen Wachposten wechseln ständig.
Kalter Schweiß bricht aus den Poren, lässt die Haut immer unerträglicher jucken. Als ich mich kratze, nur ein bisschen, obwohl mir danach ist, als müsste ich den ganzen Leib mit einer Drahtbürste abschrubben, schreit die Stimme wieder: „Hände in den Nacken!“
Es fällt zunehmend schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Ich schwanke.
„Bleib stehen! Gerade!“ Und nach einiger Zeit wieder: „Hände in den Nacken!“
Stundenlang zieht sich dieses Ritual hin. Ich wundere mich, wie lange man so etwas aushält. Obwohl ich vergleichbare Methoden von der Stasi-Ausbildung kenne. Mit Händen im Nacken bewegungslos stehen, das weicht unwillkürlich die Widerstandskraft auf. Bei dem einen früher, bei dem anderen etwas später. Aber sie weicht auf.
Ist diese Tortur etwa nur eine dieser gar nicht so seltenen Scheinverhaftungen? Ich habe zumindest davon gelesen. Will der KGB sich, wie bei anderen erstaunten Geheimdienstanwärtern, nur von meiner Standfestigkeit überzeugen?
„Halt durch, Junge!“, befehl ich mir. „Lass dir nichts anmerken!“
Und wieder bewegt sich der Zeiger der inneren Uhr ein bisschen weiter.
Dann höre ich plötzlich ein sattes Klicken, wie bei einem Revolverhahn, der nach hinten gezogen wird und einrastet. Schweiß bricht aus. Ich zucke zusammen, als ein kaltes Metallstück meinen Hinterkopf berührt. Ich bin nicht mehr in der Lage mich zu wehren. Dabei hätte ich doch nur mit den Händen ...
*
Jetzt sitze ich einer jungen Frau gegenüber, einer Frau in der Uniform eines russischen Oberleutnants. Sie lächelt.
„Du weißt, warum wir dich verhaften mussten?“ Ihre Stimme klingt einschmeichelnd. Wo habe ich diese weiche Aussprache, dieses sanft rollende russische „R“, schon einmal gehört?
„Nein“, antworte ich. Die Grundregeln über das Verhalten im Verhör! Und überhaupt: Wachsam sein - immerzu!
„Soll ich dir ein Stichwort geben?“
Ich schweige. Nur mit Mühe kann ich mich auf dem Stuhl gerade halten.
„Nun gut, Genosse.“ Die Stimme wird eine Kleinigkeit härter. „Denk mal an die Zeit in Bad Ems. Gute Berichte hast du damals aus der Schule für Nachrichtenwesen der Bundeswehr geliefert. Sehr gute, und viele Mosaiksteinchen, die uns vorher fehlten, um Struktur und Ausbildung beim Militärischen Abschirmdienst, dem Frontnachrichtendienst und den anderen Abwehreinrichtungen der westdeutschen Klassenfeinde und der NATO präziser einschätzen zu können. Wirklich, Towarischtsch, beeindruckende Arbeit aus der Höhle des Löwen.“
Sie schaut mich mit listigem Augenaufschlag an und beugt sich vor. „Aber was mich im Augenblick noch mehr beschäftigt, ist all das, was du uns nicht berichtet, - was du uns sozusagen verheimlicht hast.“
Ich starre mit unbewegter Mine auf die Akte auf ihrem Schreibtisch, bin hellwach.
„Du antwortest nicht?“ Ihre Stimme nimmt an Härte weiter zu. „Nun gut. Gisela Ackermann, geborene von Kanitz. Sagt dir der Name etwas?“
„Ja.“
„Hattest du mit ihr eine - wie sagt man doch? - Beziehung?“
„Ja.“
„Von wann bis wann?“
„Ist schon so lange her.“
„Erinnere dich!“
„Weiß nicht so genau.“
„Von 1967 bis zu ihrem Tod 1973!“, schreit sie mir ins Gesicht, wird dann aber wieder leiser. „Sechs Jahre waren das. Habt ihr miteinander geschlafen?“
„Gehört dazu, als Romeo.“
„Du wusstest, dass sie für die CIA arbeitet?“
Ich stutze einen Moment, dann frage ich zurück: „CIA?“
„Marco Brandes, der Meisterspion der DDR, bumst sechs Jahre lang eine CIA-Agentin und merkt das nicht?“ Ihre Stimme wird lauter. „Für wie dumm hältst du mich?“
„Militärischer Abschirmdienst“, sage ich knapp, „dafür hat sie vielleicht gearbeitet. Ihr Vater war Kommandeur der MAD-Lehrgruppe in Bad Ems.“
„Sie hat dich um den Finger gewickelt.“ Ihre Stimme schwillt wieder an. „Sie hat dich umgedreht, langsam aber sicher!“
Was wird hier gespielt? Ohne zu antworten, beobachte ich, wie sie aufsteht, meinen Stuhl mehrere Male schweigend umkreist und sich wieder hinsetzt.
„Gisela Ackermann“, fährt sie fort, „war verheiratet mit Dr. Berthold Ackermann. Und der war ihr Führungsoffizier, getarnt als Mitarbeiter des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz. Du hast das wirklich nicht gewusst?“
Ich bleibe stumm. Mein Gehirn arbeitet fieberhaft.
„Ihr habt beide mit ihr geschlafen? Abwechselnd? Oder sogar zusammen? Der flotte Dreier von der CIA?“
Perverse Sau!, denke ich. Wenn du wüsstest, wie sehr ich Gisela geliebt habe.
„Ihr habt sie zu Tode gefickt!“, schreit sie provozierend auf Russisch.
Ich springe hoch, klammere mich an der Stuhllehne fest und schreie erregt zurück: „Du hast kein Recht, sie in den Dreck zu ziehen! Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest.“
“Und ob ich das weiß. Ich habe ihren Abschiedsbrief gelesen. Sie wusste nicht mehr ein noch aus, wusste nicht, wo sie eigentlich hingehört: zu dir, zu Ackermann, zu ihrem Vater, zur STASI, zur CIA, zum MAD. Und außerdem: Sie war schwanger!“
Ich falle auf den Stuhl zurück. Mein Atem wird flach, nervös.
„Ich lass dich jetzt allein“, sagt sie wieder in ruhigem Ton. „Auf dem Schreibtisch liegt ein Geständnis. Unterschreibe es. Lass dir Zeit, aber unterschreibe es.“
„Geständnis? Für was?“ Ich will aufspringen, sacke wieder zusammen. Kraftlos.
„Dass du die Stiepnaya ausspionieren sollst, für die CIA!“
„Ich?“
„Wer sechs Jahre so exzellent aus Bad Ems berichten kann, ist der ideale Kandidat für zehn Jahre exzellente Berichte aus der Stiepnaya. Oder?“
„Schwachsinn.“ Ich sage es leise, schüttele meinen Kopf.
„Unterschreibe, und ich lasse dich zurückreisen in die DDR. So als wäre überhaupt nichts weiter geschehen. - Andernfalls“, sie macht eine Pause. „Ach was! Du bist intelligent. Du wirst unterschreiben“.
Sie streichelt dabei über meine klebrigen Haare, merkwürdig liebevoll, und verlässt dann das Zimmer.
In meinem Kopf dreht sich alles. Gisela und Berthold? Beide Agenten der CIA? Unmöglich. Oder doch? Und Gisela. Schwanger. Von mir? Von Berthold? Bin ich am Ende wirklich schuld an ihrem Tod? Oder mitschuldig? Und Berthold, hat der mich damals vielleicht doch ans Messer geliefert? Nur um sich selbst und die CIA aus der Schusslinie zu bringen? Wieso konnte der so kurz nach Giselas Tod die Leitung dieser Forschungsgruppe bei Pratt & Whithney in den Staaten übernehmen?
Mir ist plötzlich, als würde ich vornüberstürzen, in einen Strudel, tiefer, immer tiefer.
*
„Hände in den Nacken!“
Ich zucke zusammen, stehe mit dem Gesicht zur Wand. Die Glieder sind schwer wie Blei. Sind das überhaupt meine Glieder, die ich da fühle? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nur, dass ich den Wisch nicht unterschrieben habe, das haftet noch in meinem Gedächtnis, verschwommen. Und dieser Rest an Erinnerung, der lässt mich hoffen.
Ich denke, also bin ich! So hatte es der berühmte Descartes gesagt, damals, im 17. Jahrhundert, auch wenn er dabei nicht mit dem Gesicht zur Wand stehen musste.
Ich lebe! Also bin ich. Aber wie lange noch?
Ich höre, wie sich eine Tür öffnet, jemand den Raum betritt, einige unverständliche Worte gewechselt werden, jemand den Raum verlässt. Dann ist es wieder still. Ich spüre aber, wie sich langsam und mit leisen Schritten jemand von hinten nähert. Eine Frau? Dieser Geruch?
Ich fühle eine warme Hand in meinem Nacken. Vorsichtig berührt sie mich, fast zärtlich. Eine zweite Hand legt sich auf meine Schulter. Ich werde herumgedreht und zu dem Stuhl vor dem Schreibtisch geführt. Mein Herz klopft und stolpert. So habe ich die Angst im Nacken noch nie erlebt. Ein Würgegriff, und ich hätte gewusst, woran ich bin. Aber so?
Gerade, als ich die verklebten Augen langsam öffnen will, um mich zu vergewissern, wer mir jetzt gegenübersitzt, blitzt eine Lampe auf und verdeckt alle Konturen. Von einer grellen Lichtwand werde ich geblendet.
„Los! Unterschreib endlich!“, schreit eine Frauenstimme, sie überschlägt sich fast dabei, aber das rollende „R“ verrät mir, dass ich richtig vermutet habe.
Ich gebe mir einen Ruck, atme tief ein, straffe den Oberkörper und die Bauchmuskulatur und sage kraftvoll und entschlossen: „Nein!“
„Unterschreibe!“
„Nein!.“
„Verdammt! Du sollst unterschreiben!“
„Ich denke nicht dran.“
„Du willst also nicht?“
„Nein!“
„Wirklich nicht?“
„Und wenn ihr mich unter Drogen setzt, oder was weiß ich noch für Schweinereien mit mir anstellt! - Nein!!“
Es ist einen Augenblick still in dem Raum, beängstigend still. Dann höre ich ein leises „Danke, das genügt.“
Was hat sie gesagt? Habe ich mich verhört? Ein neuer Trick? Eine neue Variante des Psychoterrors, dem ich schon seit etlichen Stunden - oder sind es schon Tage? - zu widersetzen versuche. Hat sie wirklich „Danke, das genügt.“ gesagt?
Ich horche in die Stille, höre nur das nervöse Klopfen in meinen Adern und wie meine Atemluft in unregelmäßigen Stößen durch die Nase strömt. Die Zeit dehnt sich wie ein Gummi.
Ich vernehme Schritte. Sie kommen von außerhalb. Die Geräusche werden lauter. Stimmen mischen sich darunter. Der grelle Scheinwerfer erlischt und die Deckenleuchte wird eingeschaltet. Eine Seitentür öffnet sich, mehrere Soldaten treten ein. Voran ein russischer General. Mit strahlendem Lachen, die Hände weit zur Begrüßung ausgestreckt, stürmt er auf mich zu, reißt mich vom Stuhl hoch und umarmt mich.
„Bravo!“, sagt er mit seiner sonoren Stimme. „Endlich kann ich unseren Ostberliner Meisterspion einmal persönlich in die Arme schließen.“
Der General trommelt dabei übermütig auf meinen Schultern herum. Als ich wieder frei atmen kann und auf dem Stuhl sitze, höre ich ihn sagen:
„Verzeih, lieber Freund, was wir dir so alles zugemutet haben. Das war gewiss nicht angenehm. Es hat auch mir in der Seele wehgetan. Und ganz besonders der Genossin Olga Werenskaja, die das Verhör leiten musste, obwohl - oder sagen wir: Gerade, weil sie dich wegen deiner grandiosen Arbeit in Bad Ems so verehrt. Es war notwendig, lieber Freund.“
Ich sehe die Augen der Frau, die jetzt neben dem Schreibtisch steht, ihre straffe, durchtrainierte Figur, die Offiziersuniform und den Stolz in ihrer aufrechten Haltung. Das passt überhaupt nicht zu ihrem weichen Blick. Die Worte „Danke, das genügt“ sind darin noch immer zu lesen.
„Ich bin Pjiotr Wassiljenko“, fährt der General fort und erklärt langatmig und umständlich, weshalb es notwendig war, mich vor der Weiterfahrt in die Stiepnaya dieser letzten Überprüfung zu unterziehen.
„Es gab Widerstand gegen deine Aufnahme in die Stiepnaya. Den konnten wir nur auf diesem Weg brechen, und es gab Leute, die der oft gerühmten Wunderwaffe aus der HVA misstrauten und deine Fehler in den Vordergrund spielten. Außerdem gibt es ein altes Sprichwort im KGB: Ein Agent lebt rund zehn Jahre. Du bist da schon weit drüber.“
Als müsse er sich für all das entschuldigen, drückt er dann mit blumigen Worten und weit ausholenden Gesten seine „große Freude über die beeindruckende Standfestigkeit in den Verhören“ aus. „Man kann nicht vorsichtig genug sein, mein Freund“, fügt er hinzu, „das verstehst du. Bist ja selbst Geheimdienstexperte. Und gerade, weil du so ein Experte bist und weil ich überzeugt bin, dass auch wir von deiner Erfahrung profitieren können, will ich dich unbedingt in der Stiepnaya haben.“
Danach erläutert er, dass die Leiche - „nicht deine richtige natürlich!“ - schon auf dem Wege nach Ostberlin sei. Eine „stattliche Anzahl russischer Offiziere und Diplomaten“ werde sich an den „außerordentlich gefährlichen Einsatz“ erinnern, bei dem es „zu dem tragischen Tod des Meisterspions Marco Brandes“ in der Gegend um Nowosibirsk gekommen sei. Dabei lacht er so heftig, dass der unterste Knopf seiner Uniformjacke abspringt und über den Fußboden rollt.
„Und was wichtiger ist, mein Freund: Die westichen Geheimdienste werden diese Nachricht gern hören, nein: Aufsaugen wie Nektar werden sie alles.“
Er hält mir ein riesiges Glas Wodka hin.
„Nas da rowje, Towarischtsch! Trink es aus, und dann wird dich Olga in eine behagliche warme Badewanne stecken und dann ins Bett. Und wenn du wieder wach wirst, bist du wie neugeboren. Du heißt dann Salvatore Cesare.“
Nachdem ich unter dem Beifall des Generals und seiner Soldaten das Glas geleert habe, falle ich um.
*
Die Sonne scheint hell und warm auf mein Gesicht. Es duftet nach Tee und frischgebackenem Brot. Eine Hand berührt vorsichtig meine Nasenspitze. Ich höre eine weiche Stimme und das sanft rollende „R“.
„He, Salvatore. Du hast schon zwei Tage geschlafen. Jetzt wird´s langsam Zeit.“
Olga Werenskaja sitzt auf der Bettkante neben mir und lächelt. Ihre dunkelbraunen Augen, die geschwungenen dichten Brauen darüber, die leichte Stupsnase, die fülligen feuchten Lippen, die beiden Grübchen links und rechts davon: Nichts erinnert mehr an Uniform, soldatische Selbstbeherrschung, raffinierte Verhörtechnik. Nur, dass sie die schwarzen glänzenden Haare nach hinten zu einem Knoten zusammengebunden hat, gibt ihr einen Rest von Strenge.
Meine Arme bewegen sich auf den Knoten zu. Die Finger ziehen vorsichtig an den Nadeln. Olga wehrt sich nicht, scheint die Berührung meiner Hände zu genießen, neigt mir ihren Kopf zu. Ich halte einen Augenblick inne, streichele über ihre Wangen, über den Hals, ziehe weiter an den Nadeln, bis die Haare dicht über meinem Gesicht hängen. Sie wiegt ihren Kopf hin und her, kommt näher und näher, streicht mit den Haarspitzen über meine Stirn, die Nase, meine Lippen.
Bereits bei dem Verhör, gestern, vorgestern, oder wann das war, als sie hinter mir stand und meinen Nacken und die Schultern berührte, da hatte mich das erregt, obwohl ich mit meinen Kräften am Ende war.
Als sich unsere Lippen berühren, erst vorsichtig tastend, dann immer leidenschaftlicher, gibt es kein Zurück mehr.
*
Erschöpft liegen wir nebeneinander. Der Atem wird gleichmäßiger. Mit den Fingerkuppen streichelt Olga über meine Haut; das Vibrieren darunter lässt nur langsam nach. Ihre warmen Finger ziehen kleine Kreise um den Bauchnabel, wandern weiter nach unten. So hatte es Gisela auch oft gemacht.
Ich drehe mich zur Seite, nähere mich ihrem Arm, berühre ihn mit der Zunge, gleite weiter über die Armbeuge zu den Brustspitzen. Die Haut schmeckt salzig. Der Duft bringt mich zur Raserei. Sie riecht wie Gisela! Ich wandere mit meinem Mund weiter nach unten. Olga dreht und wendet sich lustvoll, zieht meinen Kopf nach oben, drückt ihren Körper eng an mich und öffnet die Schenkel. Langsam, zärtlich, sanft kreisend, dann wilder und immer leidenschaftlicher heben wir ab zu einem neuen Höhenflug. Genau wie bei Gisela!
Plötzlich sind da Olgas Worte aus dem Verhör: „Ihr habt sie beide zu Tode gefickt!“ Und ich liege nackt genau neben dieser Frau? Irgendwo bei Kuibyschew?
*
Brandes sprang in die Höhe, stand plötzlich neben dem Bett, rieb sich die Augen und sah seine vertraute Wand: blassrosa, Kalender mit Steckwürfeln, minoische Doppelaxt und ein silberfarbenes Brettchen.
„Scheiß Träume! Ich muss wieder pinkeln!“
Auf dem Rückweg von der Toilette hatte er schon die Flurgarderobe und alle Schränke im Kombizimmer durchgewühlt. Jetzt versuchte er sein Glück in den Schubladen seines Schreibtisches. „Wo ist nur dieses verdammte Foto?“
Während der Fernsehbilder über den Anschlag in der Hochschule war es ihm in den Sinn gekommen: das Foto von der Karnevalsfeier, damals in Bad Ems.
Er erinnerte sich. Sie waren in bester Laune gewesen: Gisela, Berthold, er und die ganze ausgelassene Gesellschaft, die sich oft zu kleinen oder größeren Festen traf, mal im Offizierskasino der Bundeswehrschule, mal in der Kantine oder in diversen privaten Kellerbars.
Dieses Karnevalsfest hatte bei „Clarence“ geendet. Jeder Lehrgangsteilnehmer von Bad Ems kannte die Kneipe. Sie lag genau an der Ecke der Alten Kemmenauer Straße, die zur Nachrichtenschule hinauf führte. Bei „Clarence“ wurde der obligatorische „Schlürschluck“ genommen. „Clarence“ war die letzte Tankstelle vor dem Bett. Den richtigen Namen wusste er nicht mehr. Aber, dass die Wirtin „Clarence“ genannt wurde, weil sie so fürchterlich schielte, genau wie der gleichnamige Löwe in der Fernsehserie „Daktari“, die in den Sechzigerjahren über die Bildschirme flimmerte. Und, dass man bei „Clarence“ so richtig die „Sau rauslasse“ konnte, wie die Emser das nannten. Das müsste auch auf dem Foto zu sehen sein.
Brandes kramte nervös in der Schublade unten rechts: Videobänder, verschiedenfarbigen Kassetten des Diktiergerätes, Disketten, eine angebrochene Knäckebrotpackung. Und die halbleere Weinbrandflasche rollte ihm entgegen.
„Scheiß Fusel! Das Zeug muss weg. Ab in den Ausguss.“
Er zögerte, rollte sie wieder zurück, schob die Schublade zu, behutsam. Hilflos blickte er umher, kratzte sich an der Schulter, rieb über seine Brusthaare und murmelte: „Irgendwo muss das Scheißfoto doch zu finden sein. Gerade das habe ich nicht verbrannt.“
Dann fiel es ihm ein: die schmale Blechdose! - Mensch, die habe ich doch damals, kurz vor der Verhaftung, im Schreibtisch hinten festgeschraubt. Die passte doch genau zwischen Mittelschublade und Rückwand. Und davor hatte ich ein Sperrholzbrett geklemmt, damit sie nicht sofort zu sehen ist, wenn jemand die Schublade herausreißt und mit der Taschenlampe in die Öffnung leuchtet.
Es waren nur ein paar Handgriffe und schon lag alles auf seinem Schreibtisch, auch das Foto.
Genau so, wie er es in Erinnerung hatte: Gisela eingehakt zwischen ihm und Berthold, äußerst spärlich bekleidet, ordinär wie eine Hure. Berthold mit Augenbinde, als Bettler maskiert, reichlich heruntergekommen. Er trug einen Stoppelbart und eine kaputte Quetschkommode. Und er? Marco Brandes? Der war der große Millionär! Mit Monokel, am Hut festgehefteten Geldscheinen, und aus den vollgestopften Jackentaschen quollen dicke Bündel.
„Ob Berthold damals wusste, dass ich immer noch mit seiner Frau schlief? Sieht man das in seinen Augen?“ Die Finger zitterten, als er das Foto dicht unter die Schreibtischlampe hielt. Doch da war nichts zu sehen. Die Köpfe drehten Kreise, tanzten vor seinen Augen, kamen nicht zur Ruhe.
„Scheiß Alkohol!“
Brandes ließ das Foto auf den Schreibtisch fallen, löschte das Licht und schlurfte mürrisch zum Kühlschrank. Es war noch ein Rest Mineralwasser in einer Flasche. Den kippte er in sich hinein, knallte die Kühlschranktür zu, schlurfte zurück und kroch unter die Bettdecke.
Mit der Wärme, die sich langsam ausbreitete, stieg ein Gefühl der Genugtuung in ihm auf, so etwas wie Triumph - verspäteter Triumph! Egal ob Berthold damals von dem Verhältnis wusste oder nicht: Gisela hatte auch nach der Hochzeit nicht aufgehört, mich zu lieben, zumindest nicht das, was ich ihr an Manneskraft bieten konnte.
„Berthold ist wie die Pflicht beim Eislaufen“, hatte sie einmal gesagt. „Aber du, Marco, du bist die vollendete Kür.“
Es klebten aber auch Niederlagen und Demütigungen in seinem Gedächtnis. Berthold Ackermann hatte sich in die Beziehung hineingedrängt, rücksichtslos, wie ein Borkenkäfer zwischen Holz und Rinde. Und er hatte es sehr geschickt verstanden, die Aversion zu seinen Gunsten zu nutzen, die Giselas Vater von Anfang an gegen mich hatte und erst recht gegen ein allzu enges Verhältnis zu seiner einzigen Tochter.
„Kapitänleutnant Schulte“, hatte Oberst von Kanitz mehrfach gesagt, „immer wenn ich Sie sehe, geht bei mir eine rote Warnlampe an. Es ist besser, Sie kommen nicht zu oft in meine Nähe.“
Kapitänleutnant Schulte? - Es dauerte etwas, bis es Brandes wieder einfiel. Schulte! Genau. So hieß ich damals in Bad Ems. Hannes Schulte. Der flotte Kaleu aus Kiel.
Er lachte - aber nur kurz. Denn ein anderes Gefühl breitete sich jetzt aus. Ein Gefühl, das von der Magengegend in alle Richtungen ausschwärmte und sich nach und nach des ganzen Körpers bemächtigte. Ein Gefühl, das zu dem Schwur anschwoll: „Ackermann! Für all das wirst du jetzt büßen! Wie auf dem Foto, genau so heruntergekommen wirst du enden!“
*
Brandes wälzte sich im Bett hin und her. Alle Rachepläne gegen Berthold Ackermann, die er in den zurückliegenden Jahren entwickelt, aber nicht vollendet hatte, waren durch seinen Kopf gegeistert. Er hatte sie erneut geprüft, variiert, kombiniert, verbessert und wieder verworfen. Sie waren nicht perfekt genug.
Dazwischen durchlebte er kurze Phasen mit skurrilen Träumen, die mit seiner Vergangenheit zusammenhingen. Auch jetzt nickte er wieder ein.
Er sieht sich plötzlich in dem Büro von General Wassiljenko. Es hat die Ausmaße eines Saales, der bei jedem Schritt länger, breiter und höher zu werden scheint. Wortlos und mit herablassender Handbewegung bedeutet ihm Wassiljenko, er solle in fünf Meter Abstand vor seinem riesigen Schreibtisch stehen bleiben.
Rechts, an einem der hohen Fenster, sitzt Olga Werenskaja. Sie schaut nur kurz zu ihm herüber, dann senkt sie ihren Blick auf einen großen Schreibblock. Kein Lächeln um die Mundwinkel, kein Strahlen in den Augen.
Missmutig blättert Wassiljenko in einer Akte, liest einen längeren Computerausdruck, schüttelt den Kopf, räuspert sich. Plötzlich knallt er die rechte Faust auf den Schreibtisch.
„Du hast mich enttäuscht“, sagt er, „tief enttäuscht!“ Mit jedem weiteren Wort schwillt seine Stimme an wie ein heraufziehendes Gewitter. „Da haben wir dich in einem Spezialprogramm fünf Jahre lang vorbereitet auf Italien. Und dann so was!“
Ich schweige, frage mich, was der General damit meint.
„Persönlich habe ich mich für dich verbürgt!“, schreit er. „Und wie stehe ich jetzt da? Vor meinen Kameraden? Vor dem ganzen Geheimdienst! - Total blamiert!“
Ich nehme Haltung an, wie bei der Formalausbildung, früher, in der Nationalen Volksarmee.
„Genosse General ...“
„Schweig!“, herrscht er mich an. „Du wirst heute noch deine Koffer packen und die Stiepnaya verlassen. - Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen, du Blindgänger!“
Ich zucke zusammen. Die Zwischenprüfung? Die war doch gut verlaufen. Oder etwa nicht?
Der Computerausdruck! Hatte sich darin eine Unstimmigkeit eingeschlichen? Bei der Plausibilitätskontrolle? Oder war es in der Hypnosekammer? Oder etwa bei dem von allen so gefürchteten Frustrationstoleranz-Test?
Blitzschnell lasse ich die letzten Wochen vor meinem inneren Auge zurücklaufen, finde aber keine Anhaltspunkte. Dann konzentriere mich auf das Jetzt, atme tief durch, straffe Bauch und Oberkörper.
„Genosse General. Bitte sagen Sie mir, durch was ich Sie so bitter enttäuscht habe.“
Wassiljenko lässt die Augen rollen, holt schnaufend Luft, so als wolle er jeden Augenblick explodieren, beruhigt sich aber und wendet den Kopf zur Seite: „Olga, sagen Sie es ihm.“
Olga steht auf und kommt langsam auf mich zu. Erst jetzt fallen mir die neuen Kragenspiegel und Schulterklappen ihrer Uniform auf. Sie ist zum Major befördert worden. Stolz umkreist sie mich, bleibt stehen und sagt mit abwertendem Blick schräg über die Schulter:
„Du hast deine Gefühle nicht im Griff!“ Das sonst so weich rollende „R“ klingt wie eine eiskalte Rasierklinge. „In mehreren psychologischen Tests ist das deutlich geworden und zuletzt in der Hypnosekammer.“
Olga umrundet mich noch einmal und blättert dabei in ihrem Notizblock.
„Dein Problem heißt Berthold Ackermann. Du hast es immer noch nicht geschafft, deinen Hass auf ihn zu zügeln.“
Sie umrundet mich erneut.
„Dein zweites Problem heißt Gisela Ackermann. Ihren Tod hast du auch noch nicht verarbeitet. Durch ständig neue sexuelle Abenteuer versuchst du, die Gefühle und Erinnerungen an sie zurückzuholen. Eine Sucht ist das! Damit bist du ein unkalkulierbares Risiko und für den vorgesehenen Auftrag in Italien ungeeignet.“
Ungeeignet! - Ungeeignet! - Ungeeignet!
Wie ein Echo verhallen diese Worte; Olga hat sich schon längst auf dem Absatz umgedreht und zu ihrem Platz am Fenster begeben.
Risiko wegen Ackermann! - Ackermann! - Ackermann!
Doch in der Hypnosekammer! Wo sonst hätte ich mich jemals zu einer Äußerung über Ackermann oder Gisela hinreißen lassen.
Diese Schweine! Bis in die tiefsten Verästelungen der Seele dringen sie ein. Vor nichts schrecken sie zurück. Sie müssen mich ständig beobachtet haben. Die ganzen Jahre in der Stiepnaya. Auch wenn ich gebumst habe, waren sie wahrscheinlich dabei. Obwohl Bumsen erlaubt war. Wir sollten schließlich alle so italienisch wie möglich miteinander leben. Das geht ohne Bumsen nicht.
Und Olga? Die hatte es damals in Kuybischew doch genossen. Vielleicht ist sie ja nur sauer, weil sie es als Vorgesetzte nicht mehr durfte. Sex mit Untergebenen - das ist auch in der italienischen Sektion der Stiepnaya verboten. Wie im echten Leben.
Aber was ist das überhaupt für ein Leben? Und was ist schon echt daran?
Meine neue Identität etwa? Dass man mich seit fünf Jahren Salvatore Cesare nennt? Dass ich inzwischen wie Salvatore Cesare fühle? Dass ich schon denke wie Salvatore Cesare?
Nein! Mögen die Kinos, Restaurants, die möblierten Wohnungen, die Taxen, die Busse, die Kleidung, die Zeitungen, die Gespräche noch so italienisch anmuten: Es bleibt eine künstliche Welt, mit Stacheldraht abgeschirmt von der Realität und bewacht von Soldaten.
Die Zigaretten, der Cappuccino, die Pastagerichte und Pizzen, selbst das Bezahlen der Miete - vom eigenen Gehalt natürlich und in Lira, zu Originalpreisen! - all das hat doch gleich wieder seine Jungfräulichkeit verloren, wenn der tägliche Drill beginnt, wenn das Trainieren der körperlichen Kräfte an den eigentlichen Grund des Hierseins erinnert: Laufen mit Gepäck, Erklettern von Mauern, Balancieren auf Dächern, Springen von hohen Gerüsten und immer wieder Karate, Jiu-Jitsu, Boxen und Freistilringen ohne Rücksicht auf sportliche Regeln.
Dann die Scharfschützenausbildung, der Unterricht und die praktische Ausbildung mit Dynamit, Semtex, TNT und anderen Sprengstoffen. Wie man die wirksamste Stelle zur Zerstörung bestimmter Objekte herausfindet, Fernzündungen auslöst und entdeckte Zeitbomben entschärft. Wie man Schlösser, Panzertüren und vermeintlich sichere Safes sprengt und dabei die Explosionsgeräusche dämpft.
Oder der Kursus, in dem man lernt, wie man Schokolade, Getränke, Zigarren vergiftet, oder welche Drogen für verschiedene Zwecke besonders wirksam sind, einschließlich der erkennbaren Symptome und präziser Zeitangaben über den Todeszeitpunkt des Opfers.
Oder wie man Fernsprechleitungen, Telefone, Computer anzapft, Wanzen einbaut, Tonbandaufnahmen für Erpressungen manipuliert, Fotos retuschiert, Filme entwickelt und zu Mikropunkten verkleinert, wie man ausländische Minikameras bedient, falls die eigene kaputt ist.
All das beherrsche ich meisterhaft! Die Russen konnten sogar noch was lernen von mir.
Und dann stecken die einen in so eine dämliche Hypnosekammer und alles soll umsonst gewesen sein?
Plötzlich sind da verschwommene Bilder von einer voll besetzten Eisenbahn. Ich höre das Rattern der Räder auf minderwertigen Gleisen, spüre das Vibrieren des Abteilbodens. Der Zug fährt rückwärts. Immer schneller. Ich rieche den Schweiß der Menschen, die schon seit Tagen auf Reise sind. Der Knoblauchduft aus ihren Esspaketen steigt in die Nase und diese seltsame Mischung aus Hühnermist, Sonnenblumenkernen und Tabakrauch. Gesprächsfetzen in kaum verständlichem Russisch erfüllen den engen Raum und ein merkwürdiges Lachen, Grunzen, Kichern alter Frauen. Als sich der Kondukteur in meine Blickrichtung dreht, um die Fahrausweise zu kontrollieren, schaue ich in eine Fratze: Ackermann!