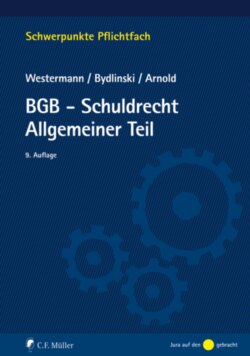Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 106
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Voraussetzungen des § 311b Abs. 1
Оглавление162
§ 311b Abs. 1 greift bei allen schuldrechtlichen Verträgen ein, die für eine Partei eine vertragliche Verpflichtung zur Übertragung oder zum Erwerb eines Grundstücks begründen. Es geht also um Pflichten, die auf Veränderung der bestehenden Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück gerichtet sind. Paradigma ist der Kaufvertrag über ein Grundstück. Aber auch Schenkungsverträge oder Tauschverträge kommen in Betracht.[48] Gleiches gilt für den Aufhebungsvertrag, wenn der ursprüngliche Vertrag bereits vollzogen war, also bereits die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgt sind. Denn dann verpflichtet der Aufhebungsvertrag zur Rückübertragung eines Grundstücks.[49] Anders liegt es, wenn der Kaufvertrag noch nicht vollzogen war: Dann kann der Aufhebungsvertrag formfrei geschlossen werden.[50] Die Rechtsprechung hält den Aufhebungsvertrag auch dann für formbedürftig, wenn zwar noch kein vollständiger Vollzug stattgefunden hat, der Erwerber aber bereits ein Anwartschaftsrecht innehält. Das ist dann der Fall, wenn die Auflassung erklärt und ein Antrag auf Eintragung gem. § 13 GBO gestellt wurde.[51] Auch der „Kauf eines Hauses“ ist ein Kaufvertrag über ein Grundstück: Denn Häuser sind mit dem Grundstück fest verbunden und daher wesentliche Bestandteile des Grundstücks iSd §§ 94 Abs. 1, 93. § 311b Abs. 1 betrifft aber nur das Verpflichtungsgeschäft, nicht etwa auch das Verfügungsgeschäft. Für letzteres gelten vielmehr die §§ 925, 873. Keine Verpflichtung zur Übertragung oder zum Erwerb eines Grundstücks liegt vor, wenn lediglich die Nutzung eines Grundstücks Vertragsgegenstand ist, also bei Miet- oder Pachtverträgen.
163
Wenn eine Vollmacht zum Erwerb oder zur Veräußerung eines Grundstücks erteilt wird, greift § 311b Abs. 1 seinem Wortlaut nach nicht ein. Gem. § 167 Abs. 2 bedarf die Vollmacht selbst nicht der Form, die für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sie sich bezieht. Nach dem Gesetzeswortlaut könnte eine Vollmacht zum Erwerb oder zur Veräußerung eines Grundstücks also immer formfrei erteilt werden. Das ist jedoch mit Blick auf die Warnfunktion des § 311b Abs. 1 problematisch, wenn die Vollmacht schon zu einer ähnlich weitgehenden Bindung des Vollmachtgebers führt wie der Abschluss des Kaufvertrags selbst. § 311b Abs. 1 gilt deshalb auch für die Vollmacht, wenn schon die Vollmachtserteilung den Vollmachtgeber rechtlich oder tatsächlich bindet, also vor allem bei der unwiderruflichen Vollmacht.[52] Die unwiderrufliche Vollmacht zur Vornahme eines Grundstücksgeschäfts nach § 311b Abs. 1 S. 1 muss deshalb notariell beurkundet werden.[53] Nach wohl hM kann dagegen der durch einen vollmachtlosen Vertreter abgeschlossene Grundstückskaufvertrag vom Vertretenen formlos genehmigt werden.[54] Dafür wird § 182 Abs. 2 ins Feld geführt, wonach die Zustimmung nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form bedarf. Das steht freilich in einem gewissen Widerspruch zur Anwendung des § 311b Abs. 1 auf unwiderrufliche Vollmachten zu Grundstücksgeschäften – trotz § 167 Abs. 2.
164
Das Beurkundungserfordernis aus § 311b Abs. 1 S. 1 erstreckt sich auf den gesamten Vertrag einschließlich etwaiger Nebenabreden. Das ergibt sich vor allem aus der Beweissicherungsfunktion der Norm. Ein Verweis in dem beurkundeten Vertrag auf etwaige Vertragsanlagen genügt nicht.[55] Allerdings genügt es, dass der rechtsgeschäftliche Wille in der Urkunde zumindest angedeutet ist (Andeutungstheorie).[56] Wenn versehentlich ein anderes als das wirklich gewollte Grundstück als Vertragsgegenstand bezeichnet ist, liegt eine unschädliche Falschbezeichnung vor (falsa demonstratio non nocet).[57] Für die Wahrung der Beurkundungspflicht kommt es nämlich nicht auf den objektiven Wortlaut, sondern – wie auch in Fällen außerhalb des § 311b Abs. 1 – auf das von den Parteien tatsächlich Gewollte an. Darin liegt zwar eine Einschränkung der Dokumentations- und Beweisfunktion. Schutz- und Informationsfunktion der Norm bleiben aber gewahrt.
Um eine solche Konstellation handelt es sich freilich bei Fall 14 nicht: Zum einen haben die Parteien nicht aus Versehen eine falsche Information zugrunde gelegt, sondern in vollem Bewusstsein gehandelt. Zum anderen wurde hier nicht ein falsches Grundstück bezeichnet, sondern die Summe des richtigen Grundstücks verfälscht.