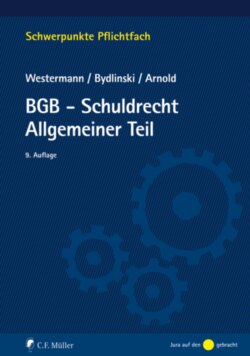Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 91
На сайте Литреса книга снята с продажи.
aa) Kontrahierungszwang auf Grundlage des § 826
Оглавление138
Schon vor Inkrafttreten des AGG hat die Rechtsprechung Kontrahierungszwänge vor allem auf Grundlage von § 826 entwickelt. Das mag auf den ersten Blick wegen der Rechtsfolge des § 826 erstaunen: Sie besteht ja im Schadensersatzverlangen. Schadensersatz wird indes gem. § 249 Abs. 1 in erster Linie dadurch geleistet, dass derjenige Zustand verwirklicht wird, der ohne das schädigende Ereignis bestünde (sog. Naturalrestitution[14]). Wenn aber die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung gerade darin besteht, dass der Schädiger den Vertragsschluss verweigert, verwirklicht der Kontrahierungszwang eben den von § 249 Abs. 1 ins Auge gefassten Zustand, der ohne diese Schädigung bestünde. Voraussetzung des Kontrahierungszwangs ist, dass es um für den Berechtigten notwendige Güter geht, der Verpflichtete eine Art Monopolstellung innehält (so dass der Berechtigte keine ausreichende und zumutbare Möglichkeit hat, auf andere Anbieter auszuweichen) und dass er diese Monopolstellung missbraucht, indem er den Vertragsschluss ohne rechtlich gebilligten Sachgrund verweigert.
In Fall 12 mag der Betreiber tatsächlich daran interessiert sein, ein gewisses Geschlechtergleichgewicht innerhalb seines Fitnessstudios zu garantieren. Dieses Interesse wird hier indes nicht durch das Recht gebilligt: Bei solchen Fitnessstudioverträgen wird in der Regel das Geschlecht gerade nicht in den Blick genommen und eine Quotenregel ist nicht notwendig.
139
Beispielsweise trifft nach der Rechtsprechung des BGH Vereine mit einer erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Machtstellung ein Zwang zur Mitgliederaufnahme, wenn die Bewerber auf die Mitgliedschaft angewiesen sind, um ihre Interessen zu wahren.[15] Den Vereinen muss freilich eine monopolartige Stellung zukommen, wofür allerdings eine erhebliche wirtschaftliche und soziale Machtstellung ausreichend ist. Wenn solche Vereine die Aufnahme verweigern, beeinträchtigen sie Freiheitsrechte der Menschen, die Aufnahme begehren – ohne, dass sie eine ausreichende Kompensationsmöglichkeit haben.
140
Auch im kulturellen Bereich sind Kontrahierungszwänge möglich, wenn eine monopolartige Position einer kulturellen Einrichtung besteht. Das liegt im Bereich anspruchsvoller Kunst nahe, die in der Regel einzigartig ist: Die Neuinszenierung des „Faust“ am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg kann nicht ohne Weiteres durch eine entsprechende Neuinszenierung am Schauspiel Köln ersetzt werden. Keine der Inszenierungen mag besser oder schlechter als die andere sein, beide sind aber jedenfalls für sich genommen einzigartig. Daher erfordert die Verweigerung eines entsprechenden Vertragsschlusses gute Gründe. Berühmt – und im Ergebnis kaum überzeugend – ist die Entscheidung des Reichsgerichts in RGZ 13, 388: Das Bochumer Stadttheater hatte einem Theaterkritiker den Theaterzugang verwehrt, da von ihm nur Negativrezensionen zu erwarten seien. Das Reichsgericht billigte dies, was wegen der hohen Bedeutung der Kunst für unsere Persönlichkeitsentfaltung und mit Blick auf die Presse- und Meinungsfreiheit kaum überzeugt. Die Grundrechte (beispielsweise aus Art. 5 und 12 GG) wirken gerade über Generalklauseln wie § 826 auch in das Privatrecht hinein (sog. mittelbare Drittwirkung der Grundrechte).
141
§ 826 ist grundsätzlich neben den auf das AGG gestützten Ansprüchen anwendbar. Auch nach Inkrafttreten des AGG ist der auf § 826 gestützte Kontrahierungszwang praktisch bedeutsam. Das ergibt sich vor allem daraus, dass das AGG bestimmte Diskriminierungsgründe abschließend aufzählt. Dadurch entstehen zwangsläufig Lücken, soweit die Ablehnung eines Vertragsschlusses auf Gründen beruht, die von den Diskriminierungsgründen des AGG nicht erfasst werden. Das zeigt sich gerade im Fall des Theaterkritikers, der ja nicht etwa wegen seiner Rasse oder seiner Religion diskriminiert wird, sondern weil das Theater schlechte Kritiken von ihm erwartet. Dafür hält das AGG keine Diskriminierungskategorie bereit.
Würde M in Fall 12 etwa abgewiesen, weil er als Rechtsanwalt tätig ist und Betreiber F es vermeiden möchte, als reines „Akademiker-Fitnessstudio“ zu gelten, könnte M sich mangels Aufzählung des Merkmals „Beruf“ in § 19 Abs. 1 AGG also nicht auf das AGG stützen. Ein Rückgriff auf § 826 BGB bliebe aber möglich.