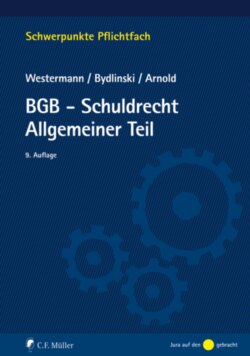Читать книгу BGB-Schuldrecht Allgemeiner Teil - Harm Peter Westermann - Страница 124
На сайте Литреса книга снята с продажи.
bb) Beschaffungspflicht des Schuldners
Оглавление185
Innerhalb der soeben beschriebenen Grenzen des § 243 Abs. 1 kann der Schuldner frei darüber entscheiden, mit welchem konkreten Leistungsgegenstand er erfüllt. Das hat gewisse Vorteile für ihn. So kann er sich etwa zu einem günstigen Zeitpunkt bei seinen Zulieferern eindecken. Allerdings sind mit § 243 Abs. 1 auch Gefahren für den Schuldner verbunden, denn ihn trifft eben auch die Pflicht, einen Gegenstand aus der Gattung zu beschaffen (Beschaffungspflicht). Daher trägt der Schuldner grundsätzlich auch die Leistungsgefahr, solange noch aus der Gattung geleistet werden kann. Damit ist die Gefahr gemeint, trotz Untergang einer Sache noch leisten zu müssen. Bei der Gattungsschuld trägt dieses Risiko der Schuldner, so lange nicht alle Leistungsgegenstände aus der jeweiligen Gattung untergegangen sind. Ist das nicht der Fall – also solange noch der Gattung zugehörige Leistungsgegenstände existent sind – bleibt der Schuldner zur Erfüllung verpflichtet. Wie weitreichend dieses Risiko ist, kann der Schuldner allerdings gewissermaßen mitbestimmen: Denn dafür kommt es entscheidend darauf an, wie weit oder eng die Gattung in der Parteivereinbarung definiert ist.[15] So kann der Schuldner etwa seine Beschaffungspflicht einschränken, wenn er in der Parteivereinbarung entsprechende Klauseln durchsetzen kann, also etwa die Klausel „Selbstbelieferung vorbehalten“[16].
Da A wie aufgezeigt eine (marktbezogene) Gattungsschuld übernommen hat, bleibt ihr in Fall 17 daher nichts anderes übrig, als vier neue Reifen zu besorgen. Dass sie Mehrkosten iHv 200 Euro zu beklagen hat, ist ihr Geschäftsrisiko.
186
Bei Vorratsschulden wird der Schuldner dagegen schon dann von der Leistungspflicht frei, wenn der gesamte Vorrat untergeht oder bereits an Dritte weiterveräußert ist.[17] Eine schwierige Frage stellt sich, wenn der Vorrat des Schuldners nur teilweise untergegangen ist, der Schuldner aber mehrere Gläubiger hat, die er jedenfalls nicht alle vollständig befriedigen kann. Klausurklassiker dieser Situation ist der Brand in der Mühle der Müllerin M: Von ihren 5 Tonnen Mehl werden 3 Tonnen vernichtet, so dass sie die Käufer A und B, die beide 2,5 Tonnen aus ihrer Mühle bestellt hatten, nicht mehr voll befriedigen kann. Überzeugend ist es, den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242) in dieser Situation zum Tragen zu bringen und zu berücksichtigen, dass die Gläubiger – bildlich gesprochen – „in einem Boot sitzen“, also eine Risikogemeinschaft bezüglich des teilweisen Untergangs sind. Die Gleichbehandlung aller Gläubiger ist daher ein Gebot aus Treu und Glauben. Der Schuldner ist also grundsätzlich dazu verpflichtet, alle Gläubiger anteilig zu befriedigen (Repartierung).[18] Im Klassikerfall des Brandes in der Mühle müsste M also A und B jeweils 1 Tonne des verbliebenen Mehls liefern.