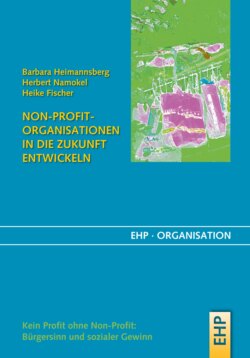Читать книгу Non-Profit-Organisationen in die Zukunft entwickeln - Heike Fischer - Страница 10
2. Paradigmenwechsel von der Bedarfs- zur Marktorientierung
ОглавлениеZu Zeiten der Rivalität wirtschaftspolitischer Weltbilder zwischen Ost und West gab es in der Bundesrepublik Deutschland einen ganz eigenen Weg der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik: die Soziale Marktwirtschaft. Dieses Programm stammte vom »Vater des Wirtschaftswunders«, Ludwig Erhard (1949-1962 Bundeswirtschaftsminister im Kabinett Adenauer und 1962-1969 Bundeskanzler). Die sozialpolitische Rahmung der Marktwirtschaft gehörte in den Jahren des Kalten Krieges zum Grundkonsens der großen Volksparteien und Wirtschaftsverbände in der BRD.
Nach der Implosion des Ostblocks konnte sich der Westen im Wettstreit der politischen Systeme als Sieger fühlen, da sich die Maxime der marktmäßigen Steuerung schließlich durchsetzte. Im Laufe dieser Entwicklung kam seit den frühen 1990er-Jahren der Sozialstaat ins Gerede. Im Weiteren wurden dann sozialstaatliche Funktionen aktivierenden arbeitsmarktpolitischen Instrumenten untergeordnet.
Die Neuordnung des Sozialstaates auf der Basis geopolitischer Veränderungen war aber nur ein Aspekt des dann folgenden weitreichenden Paradigmenwechsels in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Die Übertragung ökonomischer Sinnstrukturen auf den Rest der Gesellschaft entwickelte sich zu einem Megatrend. Der bildete zusammen mit technischen Innovationen einen mächtigen Sog für Umstrukturierungen.
Seit den 1980er-Jahren brachte die Betriebswirtschaftslehre in raschem Tempo immer neue Wettbewerbsstrategien und Managementmethoden hervor. Die Optimierung von Geschäftsprozessen im Sinne hoher Kundenorientierung und ständiger Qualitätsverbesserung erzielte zuerst in der Autoindustrie spektakuläre Erfolge. Darauf wurde das Prinzip schlanker Unternehmensführung (Lean-Konzept) zunächst in anderen privatwirtschaftlichen Branchen eingeführt und schließlich als »Lean Service Management« auch auf den Dienstleistungssektor und den Non-Profit-Bereich übertragen. Der Caritasverband Wiesbaden war z. B. eine von vielen Non-Profit-Organisationen, die in den 1990er-Jahren diesem Weg folgten (vgl. Zöller 1994). Wirtschaftlicher Druck und die Abhängigkeit vieler Trägervereine von staatlicher Finanzierung spielten dabei sicher eine große Rolle. Die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Zuge der Globalisierung erhöhten zu Beginn der 1990er-Jahre auch den Druck auf den öffentlichen Sektor. Zudem verstärkten die Kosten der Deutschen Einheit die Finanzprobleme öffentlicher Haushalte.
In dieser Situation fand die Idee Interesse, durch eine Verwaltungsreform die Haushaltskrise zu überwinden und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Dazu bot sich das Neue Steuerungsmodell (NSM) zur strategischen Steuerung öffentlicher Verwaltungen nach dem Tilburger Modell an. Die hoch verschuldete Stadt Tilburg hatte Instrumente der Betriebswirtschaft eingeführt, um aus der Ämterstruktur quasi eine Konzernstruktur zu formen. Diese Maßnahme folgte in weiten Teilen dem internationalen Trend des New Public Management (NPM). In vielen Kommunen wurden im Zuge des NPM neue finanzwirtschaftliche Instrumente eingeführt – z. B. die Doppik, die dem betrieblichen Finanzmanagement ähnelt. Das neue Steuerungsmodell ersetzte die bis dahin für Behörden typische Inputsteuerung (jährlicher Haushaltsplan) durch einen ergebnisbezogenen Ansatz. Dabei wird die Leistungserstellung öffentlicher Verwaltungen über »Produkte« gesteuert, die sich am Markt ausrichten.
Der Umbau von Behörden in moderne Verwaltungen mit dezentralen unternehmensähnlichen Organisationsstrukturen zog weitere Umstrukturierungen in Trägervereinen und Verbänden nach sich. Auch dort setzten sich weitgehend die Prinzipien des Lean Managements durch. Dazu gehört Zielvereinbarung ebenso wie Kundenorientierung und Qualitätsmanagement (vgl. Buestrich / Wohlfahrt 2008). Die Steuerung von »Dienstleistungsunternehmen« im öffentlichen wie im Non-Profit-Sektor erfolgt somit über Kontrakte auf der Basis von Produkt- oder Leistungskatalogen.
Nachdem Wirtschaftsstandorte miteinander weltweit konkurrierten, schien die grundsätzliche Neuordnung des Sozialstaates unausweichlich. Auf das Ausgabenvolumen des Sozialsektors wurde vor allem aus Wirtschaftskreisen hingewiesen. Es mehrten sich kritische Stimmen, die sozialstaatliche Aufwendungen nicht mehr als historischen Erfolg bewerteten, sondern als Belastung. Der Blickwinkel verschob sich von der Bedarfslage zu den Kosten. Dem entsprach die politische Forderung nach mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Bürger bei der Daseinsvorsorge. Der Staat solle sich aus der Versorgerrolle zurückziehen und seine Interventionen lediglich auf Anregung und Rahmensetzung beschränken.
So kam Anfang der 1990er die Rede von der Krise des Wohlfahrtsstaates auf. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger hatte sich seit den 1970er-Jahren vervierfacht. Soziale Leistungen kamen zunehmend unter Rechtfertigungsdruck: Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels sei der Sozialstaat in der bisherigen Form nicht mehr finanzierbar. Deshalb solle sich der Staat auf seine Kernaufgaben besinnen. Die richtigen Anreizsysteme und die Effizienz von Märkten seien in der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit wirksamer und gerechter als die »soziale Hängematte«. Doch gleichzeitig sprudelten in den 1990er-Jahren reichlich steuerlich begünstigte Spekulations- und Aktiengewinne. Die Zahl der Vermögensmillionäre nahm in dieser Zeit überproportional zu. Die öffentlichen Kassen dagegen leerten sich.
Haushaltsprobleme und neoliberale Prinzipien, die den Primat der Wirtschaft suggerierten, prägten das politische Klima der 1990er-Jahre nicht nur in Deutschland. In allen westlichen Industrienationen begann man, die sozialen Sicherungssysteme nach dem Modell von Anreiz und Sanktion (Fördern und Fordern) umzubauen. Umverteilung als Mittel der Sozialpolitik entsprach nicht mehr dem Geist der Zeit.
Durch den weltweiten Wettbewerb gerieten Löhne und Wohlfahrtsleistungen unter Druck. So wurde in Deutschland mit der Agenda 2010 ein umfassendes Reformprogramm auf den Weg gebracht. Dazu gehörten Einschnitte beim Arbeitslosengeld, die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie eine Flexibilisierung beim Kündigungsschutz. Im Jahre 2004 billigte der Bundesrat die Hartz-IV-Reformen.
Auch die Trägerlandschaft der Wohlfahrtspflege konnte sich dem Megatrend zu mehr Wettbewerb nicht entziehen. Mit der Einführung der Pflegeversicherung waren private Anbieter und freigemeinnützige Träger der Altenhilfe gleichgestellt. Damit wurde Trägerkonkurrenz erzeugt. Die Neufassung des SGB XI §80 von 1994 formulierte erstmals Wirtschaftlichkeitsregeln für Träger von sozialen Einrichtungen. Durch Präzisierungen der Sozialgesetzgebung (1996-2003) wurden Leistungsvereinbarungen und Qualitätsentwicklung bindend. Auf diese Weise regeln Rahmenverträge im Pflegebereich nicht nur Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene Pflege, sondern auch Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Personalrichtwerte. Leistungsvereinbarungen zwischen Kommunen und freien Trägern sind inzwischen in allen sozialen Bereichen Standard.
Auch in anderen Feldern – z. B. Wissenschaft, Kultur und Bildung – ist der Paradigmenwechsel deutlich spürbar. Museen präsentieren und vermarkten ihre Ausstellungen zunehmend mit Blick auf bestimmte Besucherschichten. Im Hochschulbereich organisiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in Kooperation mit dem Wissenschaftsrat bereits die dritte Runde der Exzellenzinitiative. Deren erklärtes Ziel ist die Förderung der Spitzenforschung sowie die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Deutschland.
Auf den Wettbewerb von Hochschulstandorten und die Internationalisierung der Arbeitsmärkte berufen sich auch die Initiatoren des Bologna-Prozesses zur schulischen Bildung. Im Mai 1998 wurde von Bildungsministern aus vier europäischen Staaten (Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland) die Sorbonne-Erklärung (Gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulbildung) auf den Weg gebracht. Die Erklärung enthielt bereits Hinweise auf Reformziele, die ein Jahr später die Agenda des Bologna-Prozesses (Bologna Declaration 1999) bestimmen sollten: internationale Anerkennung von leicht verständlichen und vergleichbaren Abschlüssen, gestufte Studienstrukturen und die Einführung eines Leistungspunktesystems.
Im Bereich der schulischen Bildung sollen die PISA-Studien für internationale Vergleichbarkeit sorgen. Dieses Programm zur internationalen Schülerbewertung ist ein Projekt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In Deutschland wird die Studie von der Kultusministerkonferenz durchgeführt. Seit 2000 untersuchen OECD-Mitgliedsstaaten in dreijährigem Turnus Kenntnisse und Fähigkeiten von 15-jährigen Schülern. 2009 beteiligten sich daran insgesamt 34 Saaten.
In Deutschland hatte die Veröffentlichung der ersten Studie 2001 den sogenannten PISA-Schock ausgelöst. Denn die Leistungen deutscher Schüler waren im internationalen Vergleich mäßig bis schlecht ausgefallen. Zudem offenbarte das Ranking soziale Ungerechtigkeit. In keinem anderen Land war der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft abhängig wie in Deutschland. Der »PISA-Schock« führte zum Ausbau von Ganztagsschulen und zu vermehrten Anstrengungen zur Förderung frühkindlicher Bildung.
Schon bei der Betreuung der Jüngsten in Kindertagesstätten beginnt die Wettbewerbsorientierung. Fremdsprachen und Mathematik sollen den Kindern bereits im Vorschulalter nahegebracht werden. Manche Eltern wollen ihrem Nachwuchs durch die Wahl einer besonderen Kita verbesserte Startchancen verschaffen. Und Einrichtungen, die diesen Wünschen nachkommen, erfreuen sich langer Wartelisten.
Komparative Kriterien wie schneller, besser, effektiver haben sich in den Köpfen festgesetzt. Wir sind »überdurchschnittlich«, »im oberen Drittel«, »bei den Besten« oder »Spitze«. Sicherlich gehört Wettstreit zu Sport und Spiel und macht Spaß – produziert aber auch Verlierer. Im organisierten Sport, speziell im Spitzensport, geht es dabei schon lange auch um Kommerz.
Die Sinnstrukturen der Marktlogik ziehen sich als Spur der Modernisierung durch alle Non-Profit-Bereiche. Der Anpassungsdruck ist stetig gewachsen. Insofern sind die häufig genannten Sachzwänge als Auslöser für Strukturmaßnahmen real. Aber es gehören immer auch bewusste Entscheidungen dazu – vor allem politische Weichenstellungen.
Die Devise »mehr Markt, weniger Staat« war ja nicht nur ein Appell der Wirtschaft, sondern wurde von den politischen Akteuren – z. B. durch die Veräußerung öffentlicher Einrichtungen an Privatinvestoren – aktiv umgesetzt. Viele NPO wurden in Aktiengesellschaften, GmbH oder andere Kapitalgesellschaften umgewandelt. Umstrukturierungen, die vornehmlich betriebswirtschaftlich ausgerichtet sind, haben auch heute noch Konjunktur. Und immer mehr Einrichtungen in sozialen Feldern oder im Gesundheitssektor verstehen sich als Marktteilnehmer. Freie Bildungsträger oder karitative Verbände oder Kliniken wirtschaften wie gewinnorientierte Unternehmen. Partnerschaften zwischen staatlichen und Profit-Organisationen (Private Public Partnership ) gelten als innovativ und kostengünstig. Inzwischen treten aber auch die Risiken dieser Praxis deutlicher in den Blick. Manche wirtschaftlichen Erwartungen an die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen oder an deren betriebswirtschaftlichen Umbau haben sich sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Außerdem lässt heute die weltweite Erschütterung der Finanzmärkte im Herbst 2008 die neoliberale Doktrin in einem neuen Licht erscheinen. Die Finanzmarktkrise und die Verschuldung von Staaten und Haushalten in der Folge haben vielen Menschen bewusst gemacht, dass ungezügelte Märkte Ungerechtigkeit, Ungleichheit und gefährliche Exzesse produzieren können.
In der Praxis der Organisation erfordert Wettbewerb die Messbarkeit und Vergleichbarkeit von Leistungen. Marktgerecht verhält sich eine Non-Profit-Organisationen, wenn sie einen Leistungskatalog mit wettbewerbsfähigen Angeboten präsentiert. Damit wirbt sie um Aufträge und Kostenübernahmen. So werden soziale Aufgaben in Angebote umformuliert, katalogisiert und als standardisierte Leistungen abgerechnet.
Das führt immer öfter zu Qualitätseinbußen, etwa bei der Pflege hochbetagter oder kranker Menschen. Denn für diese Leistungen ist die Qualität des zwischenmenschlichen Kontaktes entscheidend. Allerdings ist die Beziehungsgestaltung nicht quantifizierbar.
So nehmen Qualitätszirkel und andere Maßnahmen zur Qualitätssicherung in intersubjektiven Arbeitsfeldern zu. Der Paradigmenwechsel von sozialer Arbeit zur »Sozialwirtschaft« fordert die Einführung von Qualitätsmanagement geradezu heraus, besteht doch immer die Gefahr, dass sich ein Preis- und Verdrängungswettbewerb entwickelt, der nicht zwingend mit der Güte der erbrachten Leistungen zu tun haben muss. Die Qualitätsdebatte ist eine Antwort auf die Risiken der Ökonomisierung. Denn der Legitimationsdruck, Leistung und Erfolg in Zahlen nachzuweisen, ist hoch, obwohl Qualität, die bei den Menschen ankommt, kaum auf diese Weise darstellbar ist. Höhere Fallzahlen pro Zeiteinheit in einer Beratungsstelle oder erhöhter Patientendurchlauf in einem Klinikbetrieb sind eben nicht identisch mit qualitätsvoller Beratung oder guter medizinischer Versorgung.
Obwohl die oben genannten Entwicklungsmaßnahmen einen Zugewinn an Effizienz und Professionalisierung bedeuten können, bleibt dennoch die Sorge, dass sich die Situation für die beteiligten Menschen verschlechtert. Wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin einer Seniorenhilfe in der Supervision äußert: »Ich übernehme zu viel Verantwortung für meine Klienten. Mein Problem ist, dass ich mich in der Beratung so schlecht abgrenzen kann«, dann liegt eine klassische Rollenreflexion mit der Frage nahe, was ist hier mein institutioneller Auftrag, welche Erwartungen stellen andere an mich, und wie definiere ich selbst meine Rolle? Man könnte aber auch der Frage nachgehen, ob denn die Seniorenberaterin in ihrem beruflichen Alltag genügend Anerkennung und Rückhalt für ihr Engagement bei der Arbeit mit den Senioren erfährt. Wird denn die Einfühlung und Achtsamkeit ihrer Beziehungsgestaltung vom Arbeitgeber hinreichend gewürdigt? Manche Rollendiffusion könnte unter anderem auch Ausdruck eines allmählichen Kulturwandels in NPO sein – eines Wandels, durch den routinierte Effizienz beispielsweise mehr Anerkennung erfährt als mitmenschliche Empathie.
Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Modernisierung werden mit neuen Strukturen zunehmend auch klassische Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Verhältnisse etabliert. Und zwar häufig mit der Folge, dass Mitarbeitende ihre Arbeit als »einen Job wie jeden anderen« verstehen. Die ursprüngliche Motivation, Menschen zu helfen und im Dialog mit ihnen passende Unterstützungsformen auszuhandeln, rückt dabei in den Hintergrund. Und Verhaltenserwartungen der Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Beziehung treten in den Vordergrund.
Neue Kontroll- und Steuerungsinstrumente führen außerdem häufig zu vermehrtem Dokumentations- und Verwaltungsaufwand. Die Zeit für diese Aufgaben geht dem direkten Kontakt mit Klienten verloren. So wird es schwieriger, sich mit Werten der Organisation zu identifizieren, die sich ursprünglich auf die Güte der Arbeit mit Menschen beziehen. Was wiederum Leitbilddiskussionen oder entsprechende Entwicklungsmaßnahmen erforderlich macht.
Die Nachteile des Wandels ehemals bedarfsorientierter in marktorientierte Organisationsstrukturen spüren zuallererst die betroffenen Klienten. Bei der Patientenversorgung oder der Betreuung Hochbetagter in Pflegeeinrichtungen ist diese Entwicklung besonders kritisch zu beurteilen. Hier ist der Bedarf an menschlicher Zuwendung besonders hoch. Und es besteht eine spezielle Verantwortung, die Würde der Betroffenen zu achten. Die zunehmende Rationalisierung von Arbeitsprozessen erschwert den Aufbau kontinuierlicher Beziehungen zu den Hilfebedürftigen. Patienten oder Pflegebedürftige erleben ihre Lage zunehmend als prekäre Abhängigkeitssituation.
So birgt Produktorientierung die Gefahr, dass die Qualität der Beziehungsgestaltung (z. B. in der Pflege, Betreuung, Erziehung und in Lehr-/ Lernverhältnissen) vernachlässigt wird. Die Wettbewerbslogik lenkt den Blick auf Fallzahlen oder verführt zum »Abhaken« von Leistungen im Zeittakt. Die Ausrichtung auf Produkte, die auf »Sozialmärkten« angeboten und in Leistungskatalogen aufgelistet werden, führt von den spezifischen Bedürfnissen der Menschen weg. Das lässt sich mit formalen Qualitätssystemen, d. h. Standards, die zwischen Kostenträgern und Einrichtungen ausgehandelt werden, allein nicht ausgleichen.
Angesichts jüngster Marktexzesse und wiederkehrender Krisen muss der Glaube an effiziente und zum Gleichgewicht tendierende Märkte – selbst in der Welt des Profitstrebens – als widerlegt gelten. Welchen Sinn sollte es also haben, Systeme in anderen gesellschaftlichen Bereichen marktlich zu koordinieren? Speziell, wenn es sich dabei um Organisationen handelt, die öffentliche Güter bereitstellen oder gemeinnützig arbeiten. In den meisten Feldern der sozialen Arbeit, der Patientenversorgung oder der öffentlichen Verwaltung ist Wettbewerbslogik nicht angemessen. Viel naheliegender sind dagegen Prinzipien der Gegenseitigkeit, Solidarität und Kooperation.
Im Non-Profit-Sektor muss sich also der Organisationserfolg in erster Linie an den originären Non-Profit-Zielen messen lassen. Umso erstaunlicher ist es, dass bei Umstrukturierungen so häufig ökonomische Ziele die Hauptrolle spielen. Schließlich sind die jeweiligen Non-Profit-Werte und -Funktionen nicht nur für die jeweilige Zielgruppe wichtig, sondern auch für die Reputation der Einrichtung. Letztlich wird die Organisation daran gemessen, ob sie ihrer wertegebundenen Ausrichtung gerecht wird. Keine NPO kann Vertrauen allein aus wirtschaftlichem Erfolg generieren.
In der Gesellschaft übernehmen NPO das, was profitorientierte Organisationen nicht leisten können. Profit- und Non-Profit-Bereiche ergänzen sich. Viele NPO gehen denn auch auf Initiativen zurück, durch Märkte produzierte Ungerechtigkeiten und Krisen abzufedern. Bürgerschaftliches Engagement ist eine Triebfeder vieler genossenschaftlicher Organisationen. Bürgerbeteiligung oder soziale Inklusion, Minderheitenrechte und Selbstbestimmung oder Verantwortung für die Umwelt haben in den Leitlinien vieler Non-Profit-Organisationen einen hohen Stellenwert.
Ohne das entsprechende Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen, ohne den Beitrag kirchlicher und säkularer Wohlfahrtsverbände im Rahmen sozialer Hilfssysteme und ohne das breite Spektrum von Non-Profit-Zwecken wäre unsere Gesellschaft sehr viel ärmer und es stünde schlecht um den sozialen Zusammenhalt.
Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, weshalb der Paradigmenwechsel von der Bedarfs- zur Marktorientierung kritisch zu bewerten ist. Immer mehr Menschen beschäftigt die Frage, wie Mehrwert geschaffen werden kann, der nicht nur dem Geldverdienen dient, sondern Grundbedürfnisse eines »guten Lebens« und eines »guten Miteinanders« stärker berücksichtigt. Ökonomische Faktoren erscheinen heute überbewertet. Der Nachholbedarf bei Entwicklungskonzepten im Non-Profit-Bereich liegt eher bei der Konturierung der jeweiligen Non-Profit-Identität und der Stabilisierung ausgleichender Non-Profit-Funktionen.
NPO sollten sich nicht in Profit-Organisationen zweiter Klasse wandeln, sondern ihre Identität stärken, indem sie Entwicklungsmaßnahmen in erster Linie an den jeweiligen Organisationszwecken ausrichten. Profilrelevant sind Kriterien, die das Vertrauen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen in die NPO rechtfertigen. Wozu gibt es uns als Organisation? Wer profitiert am meisten von unserer Arbeit? Was würde fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Auf welche Werte stützt sich unsere Vitalität? Solche und ähnliche Fragen helfen, nachhaltige Erfolgskriterien zu identifizieren. Non-Profit-Werte gehören nicht nur in Präambeln und Leitbilder, sondern müssen auf allen Ebenen der Organisationspraxis und systematisch verankert und gepflegt werden.