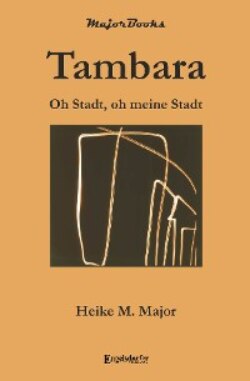Читать книгу Tambara - Heike M. Major - Страница 11
4
ОглавлениеSoul saß an ihrem großen, fast leeren Schreibtisch und betrachtete einen Apfel. Es war ein ganz besonders schöner Apfel. Er lag vor ihr auf der Tischplatte und war groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite. Seine Haut war feinporig und schimmerte wie Porzellan, vielleicht sogar wie Seide, wie ganz besonders feine Seide, doch wenn man sie berührte, diese Haut aus Seide, fühlte sie sich fest an und fast ein wenig lederartig, so wie ein dicker Schutzmantel, der etwas zu bewahren hatte und nur unter Einsatz von Gewalt bereit war, sein Inneres zu offenbaren.
Soul nahm den Apfel in die Hand und hielt ihn in das Licht. In Zeitlupe drehte sie ihn, fuhr mit den Fingern über seine Schale, hauchte diese an und putzte sie an ihrem Blusenärmel blank, drehte den Apfel ein weiteres Mal im Schein der durch die großzügigen Scheiben ihres Wohnraumes einfallenden Sonnenstrahlen hin und her und legte ihn wieder auf der Tischplatte ab.
Ein Apfel.
Der Apfel.
Der Tambara-Apfel.
Waren sie nicht alle gleich, diese Äpfel? Ein Apfel sah doch aus wie der andere? Früher, so überlegte sie, da gab es große und kleine Äpfel, dickbäuchige und schlanke, Äpfel mit grünen, gelben, roten oder bunt gefärbten Schalen, mit süßem Fruchtfleisch oder herzhaftem Innenleben. Wie sie gehört hatte, bevorzugten die Kunden von damals sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen und kauften ihren Vorstellungen entsprechend auch ganz verschieden ein. Heutzutage gab es nur einen Apfel: den Tambara-Apfel. Er sah immer gleich aus: groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite. Vor gar nicht allzu langer Zeit konnten die Bewohner der Stadt noch zwischen zwei miteinander konkurrierenden Apfelsorten wählen. Doch dann kam der Tambara-Apfel. Er war größer als seine Vorgänger, fester im Fleisch und extrem haltbar – schlichtweg konkurrenzlos. In kürzester Zeit verschwanden die beiden alten Sorten vom Markt.
Soul platzierte ihre Unterarme auf der Schreibtischplatte, bettete das Kinn auf die übereinandergelegten Hände und begutachtete die Frucht aufs Neue. Auch aus dieser Perspektive betrachtet, war es immer noch ein Tambara-Apfel: groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite.
So sinnierend fand Reb seine Schwester, als er sie nach dem Frühstück aufsuchte, um mit ihr die Pressereaktionen durchzugehen.
„Nanu?“, wunderte er sich. „Bei welch wichtiger Gedankensitzung habe ich dich denn gerade gestört?“
Soul hob den Kopf.
„Findest du nicht auch, dass dies ein ganz besonders schöner Apfel ist?“, fragte sie, ohne auf seine Neckerei einzugehen.
„Mag sein“, entgegnete Reb halbherzig und steuerte auf das Sofa zu.
„Findest du nicht, dass dies ein ganz besonders schöner Apfel ist?“, wiederholte seine Schwester die Frage und schaute weiter unbeirrt auf den Gegenstand ihrer Unterhaltung.
Reb wusste nicht so recht, was er davon halten sollte.
„Es ist halt ein Tambara-Apfel.“
Als Soul nichts entgegnete, fügte er hinzu: „Ein Tambara-Apfel ist immer schön, sonst wäre er kein Tambara-Apfel.“
„Genau das meine ich.“
„Also komm, Schwesterchen, worauf willst du hinaus?“
Soul setzte sich auf und blickte ihren Bruder an.
„Du hast es gerade selber schon gesagt. Er muss schön sein, weil er ein Tambara-Apfel ist. Dieser Apfel ist nämlich genau definiert: seine Größe, seine Farbe, die Konsistenz des Fruchtfleisches, der Geschmack. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht erst den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er schön ist. Wir wissen, dass er es ist, sonst hätte er in unserer Gesellschaft nicht überlebt.“
„Ich weiß, was du meinst“, erwiderte Reb, „aber lass uns jetzt die Sonntagszeitung ausdrucken.“
Doch Soul war noch nicht fertig.
„Vielleicht ist er ja gar nicht schön.“
Reb stieß einen Seufzer aus und ließ sich auf das Sofa plumpsen.
„Woher wollen wir eigentlich wissen, wie ein schöner Apfel aussieht? Die meisten von uns haben doch noch nie einen anderen Apfel zu Gesicht bekommen. Vielleicht waren die ausgestorbenen Sorten ja auch schön. Vielleicht waren sie sogar noch schöner als dieser Apfel hier. Wie wollen wir das überhaupt beurteilen? Uns fehlt doch der Vergleich.“
Reb blieb unbeeindruckt.
„Der Markt hat verglichen.“
Seine Antwort machte Soul wütend.
„Himmel, ich weiß, dass unser Alltag marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Aber schließlich mussten Forscher durch gezielte Veränderungen des Erbgutes diese Frucht doch erst einmal entwickeln.“
„Richtig, und dann hat der Markt entschieden. Und geforscht wurde immer schon nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten.“
„Aber vielleicht waren unter den vielen dazwischenliegenden Entwicklungsstufen ja auch attraktive Sorten. Vielleicht gab es sogar unter den natürlich gewachsenen Äpfeln schöne Exemplare, und vielleicht schmeckten einige von ihnen ja sogar besonders gut.“
Reb wusste, wenn seine Schwester sich in ein Thema verbissen hatte, war mit ihr nicht zu spaßen. Also holte er ein wenig aus.
„Wie du weißt, konnten die natürlichen Äpfel unseren Ansprüchen irgendwann nicht mehr genügen. Die im Labor entworfenen Früchte sahen besser aus, waren widerstandsfähiger und da die natürlichen Äpfel niemand mehr kaufte, pflanzte auch niemand mehr Bäume mit diesen Sorten an. Davon abgesehen hatte sich das Erbgut der Gen-Äpfel längst mit dem der Naturfrüchte vermischt. Die Vorstellung, Samen manipulierter Pflanzen auf Dauer vom natürlichen Bestand fernhalten zu können, erwies sich als Illusion. Die Wissenschaftler hatten die Macht der Evolution schlichtweg unterschätzt. Und da sich das Erbgut der Laborprodukte aufgrund der höheren Widerstandskraft durchsetzte, starben die natürlichen Früchte allmählich aus. Was übrig blieb, waren Mischsorten. Das heißt, Natur oder natürlich gezogene Pflanzen ohne gentechnische Veränderung gab es ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber auch diese Mischfrüchte, die bei unseren Vorfahren noch in freier Wildbahn wuchsen, verschwanden allmählich von der Erdoberfläche. Man brauchte mehr Platz für die guten und schönen Äpfel, die auf dem Markt bestanden. Die besten haben überlebt. Heutzutage gibt es eben nur noch den Tambara-Apfel, die Lianca-Birne, die Chicotora-Banane. Die meisten Kunden haben sich vor langer Zeit für diesen Apfel entschieden. Immerhin gehört Tambara zu den wenigen Städten auf unserem Erdball, die sich mit der Entwicklung einer marktbeherrschenden Design-Frucht schmücken können.“
„Weißt du was“, unterbrach Soul ihren Bruder, „ich besäße gern einmal einen natürlichen Apfel, einen von der Art, wie er auf der Erde wuchs, noch bevor die Menschen die Gentechnik entdeckten.“
„Und was würdest du mit ihm anfangen?“
„Ich würde ihn essen und ausprobieren, wie er schmeckt. Vielleicht schmeckt er ja ganz gut. Vielleicht schmeckt er mir, und ich betone ausdrücklich ‚mir’, ja sogar noch besser als unser Tambara-Apfel. Und vielleicht wäre er auf seine eigene, ganz besondere Art ja sogar schön.“
„Schön ist, was sich verkaufen lässt und auf dem Markt besteht!“
Reb wollte nun endlich seine Zeitung lesen.
„Ja, ich weiß, und die Katze beißt sich in den Schwanz.“
Missmutig wandte Soul sich ihrem Computer zu. Geräuschlos spuckte das Gerät die Sonntagszeitung aus.
Der Schriftzug des Titels fiel sofort ins Auge: „Triumph der Forschung – Fotografien vergangener Jahrhunderte dokumentieren medizinischen Fortschritt.“
Neugierig breiteten die Geschwister das Endlospapier auf dem Fußboden aus.
Reb hatte recht behalten. Seine Kollegen waren verlässlich. In ihrem Artikel lobten sie die Fleißarbeit des Medienfachmannes, beschrieben die einzelnen Abteilungen der Ausstellung, Größe, Art und Zusammenstellung der präsentierten Fotografien und vermerkten lobend, wie dem aufmerksamen Besucher beim Rundgang durch die Ausstellung bewusst würde, mit welch enormem Fortschritt der Alltag der modernen Menschheit gesegnet sei. Nur eine kleine Notiz am Ende des Artikels verwies auf Bezugsquellen weiterführender Literatur. Souls Jazzkonzert wurde als ungewöhnlicher, aber schmackhafter Kunstgenuss eingestuft, der Auftritt des Louis-Armstrong-Doubles als Höhepunkt herausstaffiert und als Hintergrundinformation gab es detaillierte Beschreibungen über Maske, Kostüme und Beleuchtungseffekte. Kein Wort über die Geschichte des Jazz, über den kulturellen Hintergrund oder das damit verbundene Lebensgefühl. Nichts …, doch, wieder diese unscheinbare Fußnote am unteren Seitenrand. Dem Durchschnittsleser mochte sie nicht viel sagen. Auf ergänzende Quellen wurde an solchen Stellen häufig hingewiesen, auch wenn kaum ein Abonnent heutzutage noch die Zeit fand, sich eingehender mit Zeitungsnotizen dieser Art auseinanderzusetzen. Wer sich jedoch mit solch oberflächlicher Information, wie der Artikel sie lieferte, nicht begnügen wollte, konnte im Net mithilfe der Schlüsselwörter ausführliche Erläuterungen zu den Schlagzeilen abrufen – vorausgesetzt, die Regierung hatte die Seiten noch nicht gelöscht.
Es war immer ein Wettlauf mit der Zeit. Vom Staat eingesetzte Controlsurfer sollten Netbetrüger aufspüren und Firmen bzw. deren Kunden vor Missbrauch schützen. Merkwürdigerweise verschwanden dabei aber immer wieder auch Informationen, die private Nutzer eingegeben hatten in der Absicht, mit Gleichgesinnten über ein Thema aus der Medienwelt vergangener Jahrhunderte zu diskutieren. Jemand hatte zum Beispiel einen Artikel über einen missglückten Forschungsversuch ausfindig gemacht und eine Datei dazu angelegt. Wer Fragen stellen, eigene Gedanken äußern oder Ergänzungen zum Thema anbieten wollte, schloss sich an. Man traf sich auf anonymen Plattformen, deren Absender dank eines ausgeklügelten Sicherheitssystems nur selten zu ermitteln waren. Auf diese Weise gelangte man häufig an Informationen, die nirgendwo sonst mehr nachzulesen waren. Oft befanden sich darunter auch Seiten offiziell nicht mehr existierender Bücher. So mancher Leser erinnerte sich beim Durchforsten dieser Sammlungen an ein von seinen Vorfahren ererbtes Schriftstück und vervollständigte die Dateien mit Texten aus seiner privaten Informationsquelle. Reb und Soul waren der Überzeugung, dass in vielen Haushalten noch Bücher von unschätzbarem Wert schlummerten, die aufgrund ihrer Einstufung als wertlos oder minderwertig im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten waren. Diese galt es zu aktivieren.
Neuerdings erfreuten sich solche Plattformen eines regen, stetig zunehmenden Interesses. Nur gab es anscheinend Kräfte in der Regierung, denen dieser unkontrollierte Informationsaustausch ein Dorn im Auge war. Wie sonst sollte man es sich erklären, dass diese Seiten immer wieder von den Bildschirmen verschwanden.
Soul machte die Probe aufs Exempel. Sie tippte den Schlüssel zum Thema „Jazz“ ein. Das Inhaltsverzeichnis erschien. Sie klickte eines der Stichwörter an und las: „Jazz: Wo das Leben noch Lust, Leid und Risiko ist und nicht vom Staat geschützte Gleichförmigkeit und Langeweile (Improvisation = Freiheit, Risiko, Wagnis!).“1
Sie öffnete ein zweites: „Der Jazz ist so ziemlich die einzige heute existierende Kunstform, in der es die Freiheit des Individuums gibt, ohne dass das Gemeinschaftsgefühl verloren geht.“1
Anscheinend war alles noch da.
„Es ist Sonntag“, meinte Reb ironisch, „sie sitzen wahrscheinlich noch am Frühstückstisch.“
„Meinst du wirklich, es sind die Controlsurfer, die unsere Plattformen immer wieder vernichten?“, fragte Soul.
„Wer sollte es sonst sein?“
„Aber warum nur machen sie sich die Mühe, solche für sich genommen doch harmlosen Informationen zu löschen? Was kann denn schon passieren, wenn private Nutzer auf diese Weise miteinander kommunizieren?“
„Aufmerksame Leser würden anfangen, Fragen zu stellen“, erklärte Reb.
„Aber was wäre denn so schlimm daran?“
„Es wären die falschen Fragen.“
„Die falschen Fragen?“
„Fragen, die schon beantwortet worden sind – in früheren Jahrhunderten. Damals ist entschieden worden, dass wir sie nicht mehr brauchen, diese Fragen. Erinnere dich an deinen Apfel.“
Soul begriff.
„Sie waren bestimmt nicht schön genug und ihre Antworten auch nicht.“
„Genau“, fuhr Reb fort, „sie waren zu nichts nutze, weil sie die Produktivität der Wirtschaft nicht steigern konnten. Denk immer daran: Das Beste bleibt!“