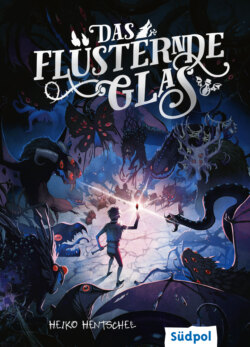Читать книгу Das flüsternde Glas (Glas-Trilogie Band 2) - Heiko Hentschel - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMoritz erwachte mit einem Japsen, das einem Ertrinkenden zur Ehre gereicht hätte. Ein kühles Tuch bedeckte seine Lider und hüllte die Welt in milchiges Licht.
Als er den Lappen von den Augen zog, starrte ihn jemand mit triefenden Schielaugen an. Ein Mann mit fettigen Haaren und schiefem Gesicht. Der Fremde musterte Moritz, pustete ihm seinen käsigen Atem ins Gesicht und wandte sich dann nuschelnd ab.
Sofort kam eine große Frau herbei und sah ihn von oben herab an. Moritz kannte diesen Ausdruck. Er erinnerte ihn an den seiner Mutter. Sie hatte ihn immer aufgesetzt, wenn er tief in der Patsche saß. Frauen mit Autorität. »Du lebst«, sagte sie. »Erstaunlich.«
Moritz’ Kopf hämmerte und seine Augen schmerzten. Er saß auf dem Boden, sein Oberkörper wurde von einer zerschmetterten Tischplatte gestützt. Etliche Lagen feuchtwarmer Tücher waren um seinen Körper gewickelt. Sie umschlangen den Hals, die Hände und Beine.
Im Raum herrschte ein einziges Chaos. Nur ein paar zerbrochene Krüge und Fässer verrieten, dass dies einmal der Schankraum eines Wirtshauses gewesen war.
»Sind alle unverletzt?«, krächzte er und versuchte sich aufzusetzen.
»Glücklicherweise«, sagte eine Stimme mit österreichischem Akzent. Sie gehörte einem jüngeren Mann, der neben Rita einen Schritt vortrat. »Wir haben uns Sorgen um dich gemacht.« Der Fremde kam dicht an ihn heran und kniete nieder. Er setzte einen Zwicker auf und untersuchte Moritz’ Augen. »Ich bin Dr. Julius Mehltau. Wie viele Finger siehst du?«
Moritz zögerte. »Drei.«
»Es sind vier«, schmunzelte der Doktor. »Hast du Kopfschmerzen?«
Sanft bewegte Moritz seinen Schädel – sein Nacken brannte wie Feuer. Vor Schmerz zog er scharf die Luft ein.
»Ich sehe schon, der Kopf ist nicht das Problem«, sagte der Arzt. »Aber dein Körper ist übersät mit Stichen. Sogar deine Lider sind durchstochen. Es ist besser, wenn du die Kompressen mit der Tinktur vorerst darauf lässt. Versuch dich so wenig wie möglich zu bewegen.«
Moritz wollte nicken, stoppte und antwortete nur mit »Ja«.
Der junge Doktor lächelte. Sein Gesicht strahlte Ruhe aus. Moritz sah unzählige Sommersprossen und Haare, die so blond und hell waren, dass sie fast weiß wirkten.
»Woran erinnerst du dich?«, fragte der Arzt.
»Wir haben gegen eine Mimose gekämpft«, sagte Moritz. »Wir wollten die gefangenen Männer befreien. Ich habe den Kopf des Monsters attackiert, um ihm das Horn von der Stirn zu schlagen.«
Hinter der Schulter des Arztes erkannte er die vier Männer. Sie hatten den dornigen Würgegriff der Mimose scheinbar gut überstanden, wenn auch der Vierte bei genauerem Hinsehen an eine wandelnde Leiche erinnerte – der triefäugige Herr mit dem Käseatem. Neben ihm entdeckte er Helene, Konstanze und die Elster. Die drei waren wohlauf.
»Du hattest unglaubliches Glück«, sagte Helene. »Leider hatte Brummi das nicht …«
Sie kam näher und hob vorsichtig Moritz’ Käfig an. Der graue Boogelbie lag reglos am Boden. Sein gesamter Körper war zerstochen und zerquetscht. Sein Kopf war auf den Rücken gedreht.
»So hättest auch du enden können«, sagte Helene, woraufhin die Elster zustimmend krächzte.
»Aber ich dachte, dass niemand verletzt wurde …« Moritz schluckte. Brummi war einer ihrer letzten beiden Boogelbies gewesen. Die anderen hatten in den vergangenen Monaten allmählich den Verstand verloren und Moritz kannte den Grund dafür. Nun blieb ihnen nur noch der kleine Fips.
»Verzeih«, sagte Dr. Julius Mehltau, »ich nahm an, du hättest dich nur nach Menschen erkundigt.« Er erhob sich und machte Platz für Helene und Konstanze. Die Mädchen ließen sich neben Moritz nieder und auch die Elster flog hinzu.
»Wir dachten, du wärst tot«, sagte Konstanze leise. »Deshalb hat Frau Rita schnell den Herrn Doktor gerufen.«
Die große Frau im Hintergrund nickte knapp.
»Das sind nur ein paar Kratzer«, scherzte Moritz und besah sich Helenes geschundenes Gesicht und ihr zerrissenes Kleid. »Ist bei dir alles in Ordnung?«
Sie sah ihn aus großen violetten Augen an. »Es geht mir immer gleich«, antwortete sie tonlos.
Moritz hob einen Arm, um sie zu berühren, doch ein sengender Schmerz machte seinen Versuch zunichte.
»Sachte, mein Junge. Es wird noch eine Weile dauern, bis du wieder gesund bist«, bremste Dr. Mehltau ihn. »Ich bereite alles für einen Aderlass vor, danach fühlst du dich besser.«
Moritz riss die Augen auf. »Das ist nicht nötig!« Allein der Gedanke, dass irgendjemand ihm den Arm aufschnitt, um Unmengen Blut abfließen zu lassen, weckte schlimme Erinnerungen. »Welche Stadt ist das hier?«
»Bad Greifenstein«, antwortete die Frau namens Rita. »Der ehemalige Wallfahrtsort.«
Bei der Erwähnung des Ortsnamens begann Moritz’ Herz zu rasen. »Wirklich?« Er atmete durch den Schmerz. »Aber wieso ehemalig?«
Dr. Mehltau legte die Fingerspitzen aneinander. »Nun, es kommen kaum noch Menschen nach Greifenstein, um zu gesunden, denn wir teilen uns diesen Ort mit, äh, diversen anderen Gästen.«
»Ich wette, Sie meinen damit weder Russen noch Franzosen«, entfuhr es Moritz.
Dr. Mehltaus Lachen klang freudlos. »Nicht, wenn Russen und Franzosen jetzt wie Mimosen, Nachtgiger oder Rasselböcke aussehen.«
»Dann sind wir hier richtig«, sagte Helene und sah in die Runde.
Eine Pause entstand, bis Moritz schließlich das Wort ergriff: »Wir sind auf der Suche nach einem Wesen mit besonderen Fähigkeiten. Laut Alphons Deysingers Atlas fantastique gehört Bad Greifenstein zu den am meisten heimgesuchten Orten. Deshalb wollten wir hierher.«
»Waf füh eiin Wefen?«, fragte der Mann mit den Triefaugen.
Moritz starrte ihn irritiert an.
»Was für ein Wesen?«, übersetzte Rita.
Da war sie, die große Frage. Moritz sog tief die Luft ein, was höllische Schmerzen verursachte. Er versuchte, sich zu entspannen. »Wir suchen nach einem Wesen, das Mock genannt wird. Es verfügt angeblich über die Gabe, Krankheiten zu heilen. Wir brauchen es, weil …«, sein Blick glitt zu Helene, »… wir hoffen, dass es einen Fluch brechen kann.«
Keiner der Anwesenden lachte. Niemand rümpfte die Nase oder griff zu einer Mistgabel, um Moritz und seine Freunde aus der Stadt zu jagen. Das lief besser als gewohnt.
»Was ist passiert?«, fragte Rita nur.
Helene erhob sich. »Ich wurde gebissen. Von einem Nachtalb.« Sie schien zu jedem der Anwesenden einzeln zu sprechen. »Seitdem bin ich untot.« Niemand unterbrach sie. »Es heißt, der Atem des Mock hätte heilende Kräfte. Vielleicht kann er mir helfen.«
Wieder entstand eine Pause, in der niemand nach einem Irrenarzt schickte. Die Menschen von Bad Greifenstein schienen das Ungewöhnliche längst in ihr Leben gelassen zu haben. Es aß mit ihnen zu Abend.
»Und wie sieht dieser Mock aus?« Ohne es zu wissen, hatte Dr. Julius Mehltau die zweite große Frage gestellt.
»Es gibt verschiedene Beschreibungen«, sagte Helene. »In Bellhopps Dämonenlexikon Band IX und Herrmann Liebkinds Werk Die sieben Sünden des Hubertus Langsam steht geschrieben, dass der Mock so groß sei wie ein Bär und sechs Beine hätte, mit denen er nur rückwärts laufen könne. Bei Prinzlein und Eggerts Schwarze Verheißungen und Verwünschungen ähnelt er einem Habicht mit Menschenkopf und Schlangenschwanz. Und in Dillbert Gelbfußʼ Enzyklopädie der geringen Wunder heißt es, der Mock hätte zwei Beine, die sich auf seinem Kopf befänden, und er könne sich nur kriechend bei Vollmond fortbewegen. Mit anderen Worten …«
»Wir wissen es nicht«, sagte Moritz bitter.
Helene schlug die Augen nieder.
Während sich das Schweigen wie ein Tintenfleck in dem verwüsteten Gasthaus ausbreitete, spürte Moritz eine Bewegung unter den Kompressen. Ein Krabbeln. Er wandte den Kopf, soweit es die Schmerzen zuließen, und sah aus dem Augenwinkel, wie ein wurmähnliches Etwas unter den Verbänden seinen Ellenbogen hochkletterte. Als es die Schulter erreicht hatte, lugte es unter den Tüchern hervor. Der Schattengeck war zurück.
Die Elster keckerte leise und Konstanze zupfte das Geschöpf vorsichtig von seiner Schulter. Es rollte sich zusammen und bildete auf ihrer Handfläche eine schützende Kugel aus weichem dunkelrotem Flaum.
»Ich sperre ihn besser in ein Glas«, murmelte Konstanze.
Moritz nickte und begriff, dass alle Anwesenden die seltsame Szene mitverfolgt hatten.
Rita stemmte die Hände in die Hüften und Dr. Mehltau polierte verwundert seinen Zwicker. Die vier Männer blickten sich gegenseitig an.
»Hast du schon mal von einem Mock gehört, Tonke?«
»Nein, Kante, noch nie. Stiller?«
Kopfschütteln.
»Jauche?«
»Gnumpf … hbn …«
Schweigen.
»Wer will ein Bier?«
Rita reckte das Kinn. »So weit kommt das noch! Macht dass ihr rauskommt! Und ich erwarte euch morgen früh für die Aufräumarbeiten. Pünktlich um acht!«
»Aber Rita …«, versuchte es der Mann namens Tonke.
Der strenge Blick der Wirtin ließ ihn sofort verstummen.
»Wir nehmen besser die Hintertür«, murmelte der Herr namens Kante. Es schien ihm sicherer zu sein, nicht noch mal an Rita vorbeizumüssen. Die Männer verschwanden in einem Durchgang links von dem, was einmal der Schanktisch im hinteren Teil des Wirtshauses gewesen war.
Dr. Mehltau wandte sich an Moritz. »Tut mir leid, Junge, aber ich habe noch nie von diesem Mock gehört.« Er blickte Rita hilfesuchend an.
»Die Hintertür?«, brummte diese mehr zu sich selbst. »Entschuldigt, ich schaue kurz, dass diese Halunken nichts mitgehen lassen.« Sie hob einen der letzten unversehrten Krüge vom Boden auf und folgte den Männern.
Moritz, Konstanze und die Elster sahen sich an. Helene hingegen glättete ihr zerrissenes Kleid und ging hinterher.
Ein kleiner, niedriger Raum erwartete Helene auf der anderen Seite des Durchgangs. Bruchsteinwände und Deckenbalken, die von Ruß geschwärzt waren. Die Küche der Schwarzen Katze.
Ein großer Arbeitsblock, quadratisch und steinern, stand in der Mitte des Raumes, bedeckt mit Töpfen, Kellen, Messern, Tellern und allerlei anderen Küchenutensilien. Der Rest der Einrichtung presste sich an die umliegenden Wände. Helene entdeckte zu ihrer Rechten eine große Tür, die von einer Sitzbank und einer offenen Feuerstelle flankiert wurde.
Dort standen die Herren Kante, Tonke, Stiller und Jauche – Namen, die zweifellos zu ihren Besitzern passten. Einer nach dem anderen passierte Rita auf dem Weg hinaus in die stinkende Nacht und musste eine kurze Taschenkontrolle über sich ergehen lassen. Ein halber Krug Bier, eine Wurstpelle und eine vertrocknete Mohrrübe kamen zum Vorschein. Letztere zog Rita dem Mann namens Stiller aus der Manteltasche, der nur entschuldigend die Schultern hob.
»Morgen früh um acht«, knurrte Rita den Herren hinterher, ein Küchentuch vor den Mund gepresst. Im Hintergrund schlug eine Turmuhr die dritte Stunde.
Der Einzige, der nichts hatte mitgehen lassen, war Jauche. Dafür verweilte er etwas länger auf der Schwelle und sog die unappetitliche Luft in vollen Zügen ein. Rita schloss die Tür erst, als auch er in der Dunkelheit verschwunden war. Dann legte sie ihre absurde Waffe auf einem Schränkchen ab und kramte in einer Schublade. Sie fand ein Medizinfläschchen und entkorkte es mit den Zähnen, bevor sie etwas von der Arznei auf ein Tuch träufelte. Vorsichtig betupfte sie damit ihren Arm.
»Wie ist der Schmerz?«
»Himmel Herrgott!« Rita stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. »Schleich dich nie wieder so an, Mädchen!«
»Das war keine Absicht.«
Ein Moment verstrich, in dem Helene sie anstarrte. »Können Sie den Schmerz beschreiben?«
»Es brennt höllisch«, brummte die Wirtin.
»Möchten Sie, dass ich Dr. Mehltau hole?«
Rita schüttelte den Kopf und wickelte sich den Lappen um den Arm. »Lass nur, mein Täubchen. Das heilt schneller, als du denkst.« Mit einer Hand versuchte sie, einen Knoten festzuzurren.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Rita ließ das Mädchen gewähren.
»Eine interessante Waffe haben Sie da«, sagte Helene mit einem Blick auf das dickbäuchige Schießeisen.
»Mein Brezelwächter? Der ist uralt.« Rita tätschelte den Lauf des Unikums. »Aber funktioniert noch wie am ersten Tag!«
»Brezelwächter?«
Rita grinste schief. »Mein Mann Alfred hat ihn so getauft. Hat ihn selbst gebaut, von unseren letzten Groschen.«
Helene suchte die Augen der Frau und tauchte einen Moment darin ein. Sie fand Schmerz und Einsamkeit und Vermissen. »Wie ist er gestorben?«, fragte sie leise.
Ritas Gesicht veränderte sich. »Du redest nicht lange um den heißen Brei herum, was?«
»Verzeihen Sie«, sagte Helene.
»Schon gut. Das Ganze ist ein paar Jährchen her.« Rita lächelte. »Zu viele.«
»Was ist ihm zugestoßen?«
»Eines dieser Biester«, sagte Rita und deutete vage in die Nacht jenseits der Küche hinaus. »Er wurde verschleppt. Habe ihn nie wieder gesehen …«
Helene nickte kaum merklich.
Rita rang sich ein Lächeln ab. »Mein Alfred war ein zäher Hund. Ich schätze, das Biest ist an ihm erstickt.« Sie mühte sich redlich, ihren Schmerz zu verbergen. Helene sah jedoch, wie ihre Hand flüchtig etwas an ihrer Brust berührte: einen silbernen Anhänger – die Hälfte einer zerbrochenen Brezel. »Möchtest du etwas trinken, mein Täubchen?«
»Danke, ich trinke nie.«
Rita sah sie betroffen an. »Verstehe. Aber die andere Kleine, äh, Konstanze? Sie trinkt doch bestimmt etwas, oder?«
»Sicher.« Helene versuchte erneut, einen Blick in Ritas Augen zu erhaschen. »Es ist bestimmt nicht leicht, hier zu leben.«
»Man gewöhnt sich daran.« Rita holte einen Krug hervor und füllte ihn mit Wasser. »Wenn diese Biester nicht wären, hätten sich zuerst die Franzosen und jetzt die Russen oder die Schweden hier breitgemacht. Wir haben also Glück im Unglück.« Sie reichte Helene ein Tablett.
»Sie leben mit diesen Wesen Seite an Seite?«
»Mehr oder weniger.« Rita stellte ein paar Becher auf das Servierbrett. »Wir haben uns daran gewöhnt, in der Stadt zu bleiben. Meine Großmutter hat immer gesagt: Halt dich fern vom Beschwipsten Pfaffen und der alten Wesselburg! Das ist verfluchtes Land.«
»Der Beschwipste Pfaffe?«
»Der Berg, auf dem die Wesselburg steht. Niemand geht dort hin – seit Jahrhunderten nicht.«
Helene legte den Kopf schräg. »Warum nicht?«
»Dort wimmelt es nur so von diesen Ungeheuern«, sagte Rita. »Manchmal hört man sie bis in die Stadt. Was auch immer die dort treiben, es ist nichts Gutes, so viel steht fest.«
»Die Monster kommen von der Burg?«
»Worauf du deinen Hintern verwetten kannst, mein Täubchen.«
Helene senkte die Lider. Ein Gedanke flammte in ihrem Geist auf. So nahe waren sie noch nie an der Möglichkeit gewesen, in Kontakt mit unterschiedlichen Monstern zu treten. »Vielleicht …«, murmelte sie.
»Vielleicht was?«
Helene sah Rita geradeheraus an. »Vielleicht kann uns eines dieser Wesen helfen, den Mock zu finden.«
Rita reckte das Kinn. »Ich glaube, du machst dir keine Vorstellung davon, wo du hier bist, mein Täubchen. Das ist Greifenstein! Wir leben hier, weil wir hier unsere Wurzeln haben. Wir haben uns mit den Biestern arrangiert.« Sie deutete zum Fenster. »Der Gestank, der draußen durch die Stadt weht, das sind die! Mit dieser Teufelei wollen sie uns loswerden. Jede gottverdammte Nacht! Aber wir gehen hier nicht weg. Das ist unsere Stadt und wir verteidigen sie! Und ihr Kinder solltet besser gar nicht hier sein. Wir gehen nicht hinauf und die kommen nicht herunter, so lautet die Regel.«
»Die sind aber doch schon da!«
Die Stimme kam von der Tür. Moritz lehnte zittrig im Rahmen. Hinter ihm standen Konstanze mit der Elster und Dr. Julius Mehltau. »Diese Kreaturen kommen hierher und zerstören euer Zuhause. Konstanze sagte, es wäre bereits das dritte Mal in diesem Jahr – abgesehen von den getöteten Tieren.«
Rita schwieg.
»Regeln nützen nur dann etwas, wenn sich beide Seiten daran halten.« Moritz blickte finster drein. »Ich glaube, es wird Zeit, dass jemand da hochgeht und herausfindet, was dort vor sich geht.«