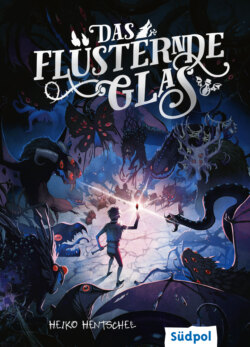Читать книгу Das flüsternde Glas (Glas-Trilogie Band 2) - Heiko Hentschel - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWenig später schlug Moritz den Kragen seiner Jacke hoch, zum Schutz vor den Dämpfen. Mit wackligen Knien brachte er die wenigen Stufen der Schwarzen Katze hinter sich und trat in die Nacht hinaus. Überall lauerte dunkelgrauer Stein. Er blickte die schmucklose Pflasterstraße hinunter, die im fahlen Licht des Halbmondes diesig und verwaschen aussah.
Die wenigen Schritte bis zur rückwärtigen Tür des Dampfwagens schienen seine letzten Kräfte aufzuzehren. Der allgegenwärtige Gestank, der ihn umwehte, hatte sich verändert. Er hatte von schwer und bitter zu einer süßlichen Note gewechselt. Ein Aroma, das er nur allzu gut kannte. Nicht zum ersten Mal in dieser Nacht fühlte er sich an das Innere des Dampfwagens erinnert. Und sein Gefühl wurde bestätigt, als er mit schmerzenden Händen den Türgriff herunterdrückte.
Im Wagen müffelte es wie auf der Straße. Schwächer zwar und weniger niederschmetternd, aber es bestand kein Zweifel: Es roch nach Monstern. Nach vielen, vielen Monstern.
Das Innere des Fahrzeugs erinnerte an eine verwinkelte goldene Höhle, die im Schein unzähliger Kerzen erstrahlte. Schwere Vorhänge, schiefe Regale und bunte Kissen trennten Arbeits- und Wohnbereiche voneinander ab und verliehen dem Vehikel, das in den Grundzügen Ähnlichkeit mit zwei miteinander verschmolzenen Postkutschen aufwies, einen gemütlichen Charme. Bis unter die Decke stapelten sich Bücher, Waffen und Kuriositäten. Am gegenüberliegenden Ende des Fahrzeugs führte eine schmale Metalltreppe zu einem Wintergarten in Form einer Buntglaskuppel. Unzählige absonderliche Pflanzengeschöpfe fanden darin Platz. Derzeit enthielt der Wagen allerdings noch etwas anderes: Käfige. Sie türmten sich über- und untereinander, waren in allen Größen und Formen auf Regalen und Tischen festgezurrt, hingen von der Decke, stapelten sich auf dem Boden und machten jeden Gang durch den Wagen zum Spießrutenlauf. Und nicht einer der Käfige war leer. Wohin Moritz im Kerzenschein auch blickte – unheimliche Augenpaare starrten ihn an. Monster. Sie waren überall. Die Kreaturen lummerten, higgelten, klonzten und fidolenzten unablässig. Ob miteinander oder mit ihm, war schwer zu sagen.
Moritz zog seinen schmerzenden Körper ins Wageninnere. Zittrig nahm er das Labyrinth aus Käfigen in Angriff. Jetzt, da sich seine Knochen anfühlten, als wären sie unter einen Ochsenkarren geraten, wurde die tägliche Zickzackroute zur Tortur.
Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. Vor fast zwei Jahren, am Vorvorabend des Weihnachtsfestes im Jahr 1811, war Moritz, Konstanze und Helene ein Boogelbie zugelaufen. Einfach so.
Diese kleinen Monster, die andere übernatürliche Kreaturen aufspüren konnten wie die Franzosen Schmuggelware, waren außerordentlich scheu. Es grenzte an ein Wunder, dass das Geschöpf freiwillig zu ihnen gekommen war und sich bereitwillig hatte einfangen lassen. Und es blieb nicht bei dem einen Boogelbie. Am Neujahrsmorgen saßen zwei weitere auf den Stufen des Dampfwagens und glotzten ihn kuhäugig an.
Was Konstanze für eine erfreuliche Abwechslung gehalten hatte – sie machte sich einen Spaß daraus, den Wesen Namen zu geben und ihnen Kunststücke beizubringen –, entwickelte sich schnell zu einem Albtraum. Denn ab diesem Zeitpunkt saß jede Woche ein neues Geschöpf auf ihrer Türschwelle und starrte Moritz an, als ob es auf irgendetwas warten würde. Und es waren nicht nur Boogelbies. Leuchtwarten, Brummzargen, Wolpertinger und Schattengecken gesellten sich ebenfalls dazu. Einige der Wesen hatte Moritz noch nie gesehen und selbst Helene fand in den Untiefen des Dampfwagens kein Buch oder Schriftstück, das ihre Gattung oder Herkunft verraten hätte. Was sie hier wollten? Warum sie ihnen folgten? Moritz kannte die Antwort nicht. Er wusste nur, dass jeden Tag neue Monster hinzukamen.
Nach drei Monaten platzten die Käfige aus allen Nähten. Nach einem halben Jahr war kaum ein Fleck im Dampfwagen vor den ungebetenen Besuchern sicher. Sie versteckten sich unter Kissen, Decken, Mänteln, quetschten sich zwischen Regale und Bücher, machten es sich in Tassen und Krügen gemütlich; ein Gluhschwanz hatte sogar den Ofen in Beschlag genommen. Der Wagen glich einer Monster-Herberge.
Einen festen Schlafplatz hatten die Kinder schon lange nicht mehr. Sie konnten sich nur dorthin quetschen, wo gerade eine Lücke frei geworden war, immer auf der Hut, nicht dabei von einem Schnattermolch in den Po gebissen zu werden.
Naturgemäß hatten die Boogelbies große Schwierigkeiten mit den fremden Gästen. Sie schlugen Daueralarm. Zuerst zergelten sie stoßweise, dann verwandelten sich ihre Laute in Pleurren und Schränzen. Ein nervtötendes Konzert, von dem Moritz schon fürchtete, es würde nie mehr enden.
Doch nach einer Woche Boogelbie-Rabatz hörten die Alarmrufe auf. Nicht weil sich die Kreaturen nun doch endlich an die neue Gesellschaft gewöhnt hätten, vielmehr war die eine Hälfte vor Erschöpfung in Ohnmacht gefallen und die andere hatte sich derart heiser geschränzt, dass sie keinen Ton mehr herausbekam.
Nur zwei Boogelbies waren davon unbeeindruckt geblieben: Brummi, von dem Konstanze behauptete, dass er der Großvater aller Boogelbies wäre, und Fips, ein zartes Geschöpf mit warmen, fast goldenen Schuppen und schillernden Langohren.
Mit großen, erwartungsvollen Augen starrte der kleine Fips ihn jetzt aus dem Käfig heraus an und bobbelte freudig auf und ab, in der Hoffnung, seinen besten Freund auf Moritz’ Rücken zu entdecken. Doch Brummi fehlte. Er würde nie wiederkommen.
Das Bobbeln erstarb. Der Ausdruck des kleinen Schuppenmonsters veränderte sich. Eine ganze Welt der Traurigkeit spülte durch die riesigen hellblauen Augen, dann wandte er sich ab und begann leise zu zittern.
Moritz schluckte. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend dachte er an Edgar. Der Geist seines Freundes war überall spürbar. In den Kuriositäten, die in den Regalen standen, in den Büchern, die er angehäuft hatte, den Aufzeichnungen und Illustrationen, die er selbst angefertigt hatte. Sogar die silbergraue Weste, die Moritz am Leib trug, und der Teleskopstab, den er immer mit sich führte, waren Edgars ureigene Erfindungen gewesen. Die Weste hebelte die Schwerkraft aus, mit ihr lief man schneller, hüpfte weiter und sprang höher als jedes andere Lebewesen. Das Kleidungsstück war aus dem Fell eines La-Kas gefertigt, einem Monster, dessen Haar die Fähigkeit besaß, seinen Träger federleicht zu machen.
Und die Teleskopstäbe waren Edgars ganzer Stolz gewesen. Sie bestanden aus Messing und verfügten über einen versteckten Mechanismus: Man konnte sie auf ein Maß von über zwei Metern verlängern oder sie in eine scharfe Klinge verwandeln, mit nur einem Knopfdruck. Eine praktische Waffe, die nach getaner Arbeit zu einem Zylinder zusammenschrumpfte und sich so in jeder Tasche verstauen ließ.
Moritz seufzte. All das war hier. Nur Edgar nicht. Sein Gehrock in changierendem Weinrot und Violett lag einsam an seinem verwaisten Arbeitsplatz, genau wie sein seidenes Haarband und sein runder Kneifer. Fein säuberlich zusammengelegt, als ob er jeden Moment zur Tür hereinkommen würde – begeistert, eine neue Monstergattung entdeckt zu haben.
Doch Edgar kam nie wieder. Da half es erst recht nicht, dass Konstanze und Helene die Elster nach ihm benannt hatten. Es versetzte Moritz jedes Mal einen Stich, Edgars Namen zu hören.
Sein Leben hatte sich schon einmal schlagartig verändert: Im tiefsten Winter des Jahres 1810 waren seine Eltern Lutz und Luise Brenner an Influenza gestorben. Nach dem schweren Verlust hatten er und seine Schwester in einem Waisenhaus gelebt, bis zu jener Nacht im November 1811, als Konstanze von einem fliegenden Monster verschleppt worden war. Als weitere Mädchen geraubt wurden, hatte sich Moritz an die Fersen des Untiers geheftet und war so auf Edgar van Lichtholm und dessen Schwester Helene getroffen.
Edgar, seines Zeichens Monster- und Dämonenjäger, hatte ihn in verschiedenen Kampftechniken unterwiesen und ihm eine Welt gezeigt, die ihm vorher undenkbar erschienen war – die Welt der Monster. Gemeinsam waren sie dem Rätsel der verschwundenen Mädchen auf die Spur gekommen.
Auf einem schwarzen Schiff begegneten sie der unheimlichen, kindlichen Komtesse Emilia Flavée und der schwarzen Glasmaske, die die Lebensfunken der vermissten Kinder in sich aufgesaugt hatte. Moritz gelang es zwar, die Maske zu zerschlagen und die darin gefangenen Mädchen zu befreien, doch der Sieg hatte einen hohen Preis gefordert: Edgar war gestorben und hatte Helene allein zurückgelassen. Seit jenem Tage zog Moritz mit Konstanze und Edgars Schwester gemeinsam durch die Lande, auf der Suche nach dem Mock – auf der Suche nach Heilung für Helene. Bloß je intensiver sie nach ihm suchten, desto weiter schien er sich von ihnen zu entfernen.
Bad Greifenstein war ihre letzte Hoffnung. Kaum eine andere Stadt hatte einen derartigen Ruf.
Moritz hatte genug vom Krieg. Von größeren Städten hielten sie sich fern. Ihr Wagen wäre nur entdeckt und im schlimmsten Falle beschlagnahmt worden. Die wenigen Male, in denen sie gezwungen gewesen waren, eine Stadt zu betreten, hatten sie den Dampfwagen etwas abseits der Kontrollpunkte in einem Wäldchen stehen gelassen. Dann hatten sie die bewachten Tore meist ungehindert passieren können. Schließlich waren sie nur Kinder. Von ihnen ging keine Gefahr aus und Konstanze konnte bestechend unschuldig gucken. Man musste schon ein Herz aus Stein haben, um ihrem Engelsgesicht einen Wunsch abzuschlagen. Dass dieser Engel gerne mit Feuerwaffen spielte und einen Zitterwarg mit bloßen Händen fangen konnte, sah man ihm nicht an.
Auf der Straße ertönten Stimmen. Er sah über die Schulter und erkannte Helene, Konstanze und Dr. Mehltau. Während sich seine Schwester und der Doktor ebenfalls Tücher auf Mund und Nase pressten, ging Helene ungeschützt neben ihnen her. Sie nahm den Gestank nicht wahr.
Immerzu hatte Moritz über ihr Schicksal nachgegrübelt. Immer wieder hatte er sich darüber gewundert, dass sie weder Schmerzen noch tiefere Gefühlsregungen empfinden konnte. Sie war abgeschnitten von der Welt, was jedoch nicht bedeutete, dass sie nicht daran teilnahm. Sie war es gewesen, die Schleier und Tücher über einige der Käfige im Wagen gehängt hatte, in der Hoffnung, die Wesen würden dadurch zur Ruhe kommen. Dem war nicht so. Die eine Fraktion wurde in der Dunkelheit nur lauter und aktiver, die andere fraß die Tücher und würgte anschließend die Goldfäden hoch. Offenbar war Gold etwas, das nicht zu einer ausgewogenen Monster-Ernährung gehörte.
Die Verdauung der Wesen entwickelte sich ohnehin zu einem Problem. Wieder war es Helene, die überall im Wagen Schälchen platziert hatte. Zu ihrem Glück ließen die Wesen selten etwas fallen. Stattdessen pupsten sie. Ununterbrochen. In den ersten Wochen hatte Moritz festgestellt, dass es nicht mehr ausreichte, Räucherstäbchen oder Duftöle zu verwenden. Wie gerne hätte er die Bullaugenfenster und Luken, die überall in die Außenhülle des Dampfwagens eingelassen waren, geöffnet, um den Gestank abziehen zu lassen, doch die Gefahr, dass sich neue Monster Zutritt verschafften, war zu groß. Es herrschte eine Atmosphäre, in der Kopfschmerzen wie Unkraut gediehen.
Kraftlos ließ sich Moritz auf ein Kissen fallen – direkt zwischen einem Bücherstapel und einem Weidenkorb, der vor Schriftrollen und Waffenzubehör überquoll. Sein ganzer Körper protestierte und er tastete seinen Hals ab. Der Verband, den der Doktor ihm angelegt hatte, war viel zu eng geschnürt und mutete wie eine altertümliche Halskrause an. Wenigstens stank das Mittel nicht, mit dem der Stoff durchtränkt war.
Moritz rutschte auf den Kissen herum, um eine bequemere Haltung zu finden. Doch etwas stach ihn in die Leistengegend. Mühsam durchforstete er seine Hosentasche und fand ein in ein Tuch eingewickeltes schwarzes Stück Glas. Der Splitter der Glasmaske. Den Teil, den Helene vom Schiff der Komtesse mitgenommen hatte. Er trug ihn stets bei sich, um sich an den Ort zu erinnern, an dem so viel Schmerz und Dunkelheit geherrscht hatte. Und an Edgar, der dort sein Leben verloren hatte. Es gab keinen Trost.
Er nahm eine Bewegung auf seiner Schulter wahr. »Verschwinde!«, schnaufte er, als er einen neuerlichen Schattengecken entdeckte. Oder war es derselbe, den Konstanze zuvor in ein Glas sperren wollte?
Moritz zupfte den Gecken von seiner schmerzenden Schulter und ließ ihn in eine Zinkwanne mit Feuerspeiern fallen. Der Geck wurde sofort von den schreckhaften Speiern begutachtet und zu ihrem neuen Herrscher ernannt. Manchmal reichte ein Auge mehr, um als überlegene Spezies zu gelten.
Moritz wandte sich wieder dem schwarzen Splitter zu. Er schimmerte matt auf seiner bandagierten Handfläche. Welches Geheimnis verbarg das dunkle Glas? Wieso hatte es Mädchen in sich aufgenommen? Warum hatte es ihnen ihre Gesichter gestohlen? Was wollte es?
Das Fragment der Maske hüllte sich in Schweigen.
Moritz fuhr sanft mit den Fingern über das edle Schwarz. Samtig und glatt fühlte es sich an. Doch etwas war seltsam. War der Splitter größer geworden in den letzten Monaten? War er schon immer so spitz gewesen? So scharf? Moritz schüttelte den Kopf. Das bildete er sich vermutlich nur ein. Daran war sicher der Wagen schuld. All die Monster machten ihn verrückt.
Er wickelte den Splitter wieder ein und steckte ihn zurück in die Hosentasche, als Helene mit der Elster auf dem Arm den Wagen betrat und die Tür hinter sich schloss. Selbst der Vogel trug einen Mundschutz – den Fetzen eines Taschentuches.
»Ist der Doktor weg?«, erkundigte sich Moritz.
»Nein«, antwortete Helene. »Er hofft, dass du dir die Sache mit dem Aderlass noch mal überlegst.«
»Auf keinen Fall.« Moritz zog sich auf die Beine. Sie zitterten wie Zweige im Wind. Er versuchte tief ein- und auszuatmen, trotz des Gestanks.
»Du willst wirklich auf die Burg?«, fragte Helene.
»Hast du eine bessere Idee?«
Sie blieb ihm eine Antwort schuldig.
»Dann ist es beschlossene Sache.« Moritz umrundete Käfige, die in anderen Käfigen standen. Not machte erfinderisch und gewisse Geschöpfe hatten nichts gegen Gesellschaft.
»Und was ist mit unserem Problem?«
»Was soll damit sein?«, fragte Moritz und griff nach den Gitterstäben eines Käfigs, in dem sich ein halbes Dutzend Sperlingsmäuler zu einem vieläugigen Klumpen zusammengeschlossen hatten. Eine Verteidigungstaktik.
Helene sah ihn direkt an. »Da oben erwarten uns noch mehr davon.« Sie nahm sich Zeit, um auf alle Käfige im Wagen zu deuten. Es dauerte entschieden zu lange. »Was, wenn das Problem schlimmer wird?«, fragte sie.
Moritz nickte. Ihm war bereits aufgefallen, dass die Monster, die in den letzten Monaten hinzugekommen waren, sich von den ersten unterschieden. Sie wurden angriffslustiger, unberechenbarer und vor allem größer. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein gefährliches Riesenbiest an ihre Tür klopfte. »Denkst du, dass die Mimose der Anfang war?«
Helene legte den Kopf schief – so schief, dass Moritz bereits vom Hinsehen schwindelig wurde.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie und streichelte die Elster versonnen. »Irgendetwas ist hier in Aufruhr. Und ich fürchte, es ist keine Horde Feuerspeier.«
Sie hatte den Satz kaum beendet, als Fips die Ohren aufstellte und lauthals losschränzte. Etwas krachte auf das Dach des Dampfwagens. Vor Schreck verlor die Elster den Mundschutz.