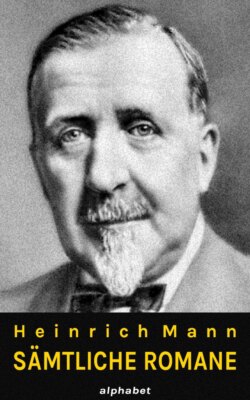Читать книгу Heinrich Mann - Sämtliche Romane - Heinrich Mann - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеAn einem Sommertage ihres fünfzehnten Jahres sprang sie einmal, noch verschlafen, ans Fenster von Pierluigis Lusthäuschen. Sie hatte im Traum ein scheußliches Kreischen gehört, wie von einem großen, häßlichen Vogel. Der Lärm entsetzte sie noch im Wachen. Da lag im See, in ihrem armen See, ein riesiges Weibsbild. Ihre Brüste schwammen auf dem Wasser als ungeheure Fettberge, sie reckte Beine wie Säulen in die Luft, peitschte Schaum mit wuchtigen Armen und schrie dazu aus weit und schwarz nach oben gerichtetem Munde. Am Ufer trieb geknicktes Schilf, die grünen Paläste, in denen die Fische wohnten, waren zertrümmert; ihre Bewohner huschten angstvoll umher, die Libellen waren entflohen. Das Weib hatte Verwüstung und Schrecken bis in die getrübte Tiefe getragen.
Violante rief mit Tränen in der Stimme:
»Wer hat Ihnen denn erlaubt, meinen See zu beschmutzen! Wie sind Sie widerwärtig!«
Am Ufer lachte jemand, sie bemerkte ihren Vater.
»Fahr’ nur fort«, sagte er, »sie versteht kein Französisch.«
»Wie sind Sie widerwärtig!«
»Italienisch und deutsch versteht die Mama auch nicht.«
»Es ist gewiß eine Wilde.«
»Sei artig und begrüße deinen Vater.«
Das junge Mädchen gehorchte.
»Die Mama wünschte zu baden«, erklärte Graf Assy, »sie ist ungemein sauberkeitsliebend, es ist eine Holländerin. Ich komme nämlich aus Holland, meine Liebe, und wenn du deinen Vater gut behandelst, nimmt er dich einmal mit dorthin.«
Sie widersetzte sich entrüstet:
»In ein Land, wo es solche … solche … Damen gibt? Niemals!«
»Bestimmt?«
Er nahm freundschaftlich ihren Arm. Die Holländerin war ans Ufer gestiegen, sie hatte sich notdürftig bekleidet und kam herbei, schnaufend, mit wogendem Busen und zärtlicher Miene.
»O das süße Kind!« rief sie. »Darf ich sie küssen?«
Violante ahnte, was jene vor hatte. Ein jäher Ekel beraubte sie des Atems; sie riß sich los, mit wahrer Kinderangst rannte sie und rannte. »Was hat die Kleine?« fragte ganz erschrocken die Fremde. »Schämt sie sich?«
Violante schämte sich nicht. Das Erscheinen eines nackten Frauenzimmers an der Seite ihres Vaters berührte gar nicht ihre Würde. Aber die Plumpheit, die unschöne Masse dieses Weibskörpers empörte ihre Mädchennerven zu einem Stolz, den zu bezwingen ein ganzes Leben sich verschwören mochte: es hätte sich umsonst verschworen.
»Wie darf sie es wagen, sich mir zu zeigen!« stöhnte sie, eingeschlossen in ihrem Zimmer. Sie verließ es erst nach Graf Assys Abreise, und den See mied sie; er war entweiht und für sie verloren. Sie versuchte in Gedanken einem Schmetterlinge zu folgen auf seinem Fluge über die leise Fläche und das Himmelsblau hinabtauchen zu sehen in die gläserne Tiefe – da plumpste etwas Grobes, Rötlich-Weißes hinein: zerpeitscht war die gespiegelte Bläue und der Falter entflattert.
· · ·
Sie grämte sich in tiefer Stille und blieb standhaft, ein halbes Jahr lang. Dann beruhigte sie sich; die lieben Plätze ihres Kinderlebens gingen nur noch durch ihre Träume. Eines Nachts stand Pierluigi von Assy mit seiner Geliebten vor ihrem Bett. Die Dame verzog schelmisch den Mund, die schwarze Fliege hüpfte in eine weiße Grube. Er bat Violante mit zierlicher Verbeugung, mit ihnen zu kommen. Sie erwachte; neben dem weißen Mondlicht lagen blaue Schatten, im Nebenzimmer stand das Bett der Gouvernante leer. Lächelnd schlief sie wieder ein.
Am nächsten Tage trat ein Herr in ihr Zimmer.
»Papa?«
Sie war fast erschrocken, sie hatte ihn erst in Monaten erwartet.
»Es ist nicht Ihr Papa, liebe Violante, es ist Ihr Onkel.«
»Und der Papa?«
»Dem Papa ist leider ein Unglück zugestoßen – o, ein leichtes.«
Sie sah nur erwartungsvoll aus, nicht ängstlich.
»Er schickt mich zu Ihnen. Er hat mich schon längst gebeten, mich Ihrer anzunehmen, falls er einmal nicht mehr dazu imstande sein sollte.«
»Nicht mehr imstande?« wiederholte sie traurig, ohne Erregung.
»Ist er …«
»Abberufen.«
»Tot.«
Sie senkte den Kopf, sie dachte an das letzte unerfreuliche Zusammentreffen. Sie bekundete keinen Schmerz.
Der Herzog küßte ihr die Hand, er sprach ihr zu und betrachtete sie dabei. Sie war schlank, feingliedrig und voll Spannkraft, mit den schweren, schwarzen Haaren des Südens, in dem ihr Geschlecht gewachsen war, und Augen blaugrau wie das nordische Meer ihres Ahnherrn. Der alte Kenner überlegte: »Sie ist eine Assy. Sie hat noch etwas von der kalten Kraft, die wir hatten, und Siziliens entnervtes Feuer, das wir auch hatten.«
Er war trotz seines hohen Alters noch ein sehr achtbarer Reiter, verbarg es aber, so oft er mit dem ungeschulten jungen Mädchen ausritt, nach Kräften. Sie jagten den Strand entlang hintereinander her, auf dem harten Sande und im Wasser. Muscheln und Fetzen von Seesternen spritzten von den Hufen.
»Ich bin ein recht ausgelassener Kamerad«, seufzte der Herzog für sich. »Aber es heißt die Hundekapriolen mitmachen. Stolzer Tritt, Passagieren oder Redopp würde die Kleine nötigen, zu mir und meiner Kunst emporzublicken. Und gegen das Emporblicken hat sie, glaube ich, von Hause aus eine Abneigung.«
Nur als einmal ihr Hut ins Meer wehte, und Violante kommandierte: »Hinein!« – Da widersetzte er sich.
»Ein Schnupfen … in meinen Jahren …«
Sie sprengte hinein, sie saß auf dem Rücken des schwimmenden Pferdes zusammengekrümmt wie ein Äffchen. Bei der Rückkehr zeigte sie ihre nasse Schleppe vor.
»Das ist alles. Warum haben denn Sie das nicht fertig gebracht?«
»Weil ich Ihnen bei weitem nicht gewachsen bin, liebe Kleine.«
Sie lachte glücklich.
Er ließ die Zeit verstreichen, bis es ihm schien, daß das Leben zu zweien ihr zur Gewohnheit geworden sei. Da sagte er:
»Wissen Sie, daß ich fünf Wochen hier bin? Ich muß einmal wieder nach meinen Freunden sehen.«
»Wo denn?«
»In Paris, in Wien, überall.«
»Ah!«
»Bedauern Sie ’s, Violante?«
»Nun …«
»Sie können ja mitkommen, wenn Sie Lust haben.«
»Habe ich Lust?« fragte sie sich.
»Wenn der See noch wäre wie früher, hätte ich gar keinen Grund, fortzugehen; aber so …«
Sie dachte an Pierluigis nächtlichen Besuch, seine einladende Verbeugung und das liebliche Lächeln der Dame.
»Muß ich euch nun ganz verlassen?« meinte sie im stillen, tiefernst geworden.
»Als meine Frau?« setzte der Herzog ruhig hinzu.
»Als Ihre … Warum denn?«
»Weil es das einfachste ist.«
»Nun, dann …«
Unvermittelt fing sie zu lachen an. Die Werbung war genehmigt.
· · ·
Den Winter des Trauerjahres verbrachten sie in Cannes, streng zurückgezogen in eine Villa, die hinter Lorbeermauern und dichten Rosenhecken hervorscheinend, in dem Vorübergehenden Ahnungen erregte von versunkenen Innigkeiten. Die Herzogin langweilte sich und schrieb Briefe an Monsieur Henry.
Sie reisten im Sommer durch Deutschland und trafen Ende September in Biarritz des Herzogs Pariser Freunde. Bei ihrer Ankunft in Paris stand Violante bereits in einem engen Verhältnis zur Fürstin Urussow und zur Gräfin Pourtalès Pauline Metternich, der sie eine kleine Schwester ward, vermittelte ihre Bekanntschaft mit Wien. Es war das Jahr 1867. Für einige aus dieser Gesellschaft ging eine gerade Lustallee von Paris nach Wien. Was links und rechts dazwischen lag, waren Dörfer, gerade gut genug, um die Pferde zu wechseln. Denn man verschmähte eine volkstümliche Beförderungsart; der Graf d’Osmond und die Herzogin von Assy mit ihrem Gemahl trafen in zwei Viererzügen aus Paris ein und fuhren ins Hotel Erzherzog Karl. Violante folgte einer Einladung der Gräfin Clam-Gallas in ihre Hofburg-Loge; sie bestieg in Paris ihren Wagen, um durch das Wiener Fernrohr der Astronomin Therese Herberstein zu sehen.
Die Leichtigkeit ihres Wesens, die Abwesenheit gemeiner Eitelkeiten in ihrem ungesuchten Hochmut erregten Begeisterung; sie entzückten vor allem den Herzog. Er war sechsundsechzig, und seit sechs Jahren betrachtete er, seiner Gesundheit zu Liebe, die Frauen nur noch als glänzende und verwickelte Dekorationsstücke. Nun sah er, näher als andere, dem schönen, freien Geschöpfe zu, dem in einem Dunstkreis von Begierden, dunklen Nachträgereien, ängstlichen Gespinsten und geheimen Lüsten alles klar und lichtvoll blieb, das nirgends Tiefen und Nöte ahnte. Es beglückte ihn eigenartig, wie sie durch das überanstrengte Gewühl der legitimierten Glücksritter und der in schwierigen Genüssen Altgewordenen mit harmlosen, sicheren Kinderschritten dahinging. Sie aufzuwecken erschien der welken Feinheit des Greises wie ein törichtes Verbrechen. Übrigens sagte er sich, daß er ein Narr wäre, sie in Freuden einzuführen, deren Fortsetzung sie notwendig bei andern suchen müßte.
Er führte sie nicht ein. Man erzählte ihr, daß die Marquise de Châtigny von ihrem Mann keine Kinder zu erwarten habe.
»Woher weiß man das?« fragte Violante.
»Von Mademoiselle Zozie.«
»Ah, der von der Oper?«
»Ja.«
Sie wollte weiterfragen, woher denn Mademoiselle Zozie das wissen könne, doch fühlte sie, daß diese Frage nicht zu denen gehöre, die man äußern dürfe.
Die schlanke Gräfin d’Aulnaie erschien eines Abends auf der österreichischen Botschaft mit einem ungeheuren Bauch; es handelte sich um einen vereinzelten Versuch, die Mode der andern Umstände, wie sie in den fünfziger Jahren bestanden hatte, wieder einzuführen. Die Herzogin belustigte sich sehr; dann folgten einige nachdenkliche Tage, nach deren Verlauf sie dem Herzog erklärte, daß sie sich Mutter glaube. Er schien heiter überrascht und ließ den Doktor Barbasson rufen. Der Arzt untersuchte sie mit der zarten Hand, die aus Klientinnen Geliebte machte. Sie blickte gespannt auf: er hatte sein Lächeln rechtzeitig unterdrückt und erklärte, daß hier nichts zu fürchten und nichts zu hoffen sei.
Sie ritt im Prater und im Bois mit immer neuen Anbetern spazieren, und ohne von den Endzwecken der Anbetung etwas zu wissen, erhielt sie, mit der Geschicklichkeit einer Nachtwandlerin, alle in Atem. Der Conte Paul Papini bekam ihretwegen eine Kugel vom Baron Leopold Tauna, und er lag noch im Sterben, als Raffael Rigaud sich vor ihrem eben vollendeten Bildnis erschoß. Das waren ihr unverständliche Dummheiten, und sie sprach es aus, mit einer Miene so ruhig und ohne Mitleid, daß abgehärteten Roués ein Schauer über den Rücken lief. Man fing an sie zu fürchten. Sie aber empfand das lebhafteste Vergnügen über eine noch nicht gekostete Art von Gefrorenem oder über den Schnee, der dichter als sie ihn je gesehen hatte, auf dem Pelzkragen ihres Kutschers liegen blieb. Und eine größere Teilnahme als allen ihren Liebhabern brachte sie dem Lord Eppom entgegen, jenem alten Herrn, der das ganze Jahr hindurch eine weiße Hose und eine rote Nelke trug. Er fuhr im schäbigsten Einspänner bei ihr vor, und es erheiterte sie bis zu Tränen, wie er den argwöhnischen Widerstand ihrer Dienerschaft zu überwinden hatte, ehe er bis zu ihr vordringen und ihr sein kostbares Cadeau zu Füßen legen konnte. Sie besuchte ihn und betrat sein Schlafzimmer: er schlief in seinem Sarge. Er überreichte ihr galant einen seiner im Voraus gedruckten Partenzettel und spielte ihr zu Ehren auf einem Leierkasten seinen selbst verfertigten Trauermarsch.
Sie begann Moden zu machen. Ein Bacchantinnenkostüm, im Januar 1870 auf dem Opernball getragen, krönte ihre Berühmtheit. Die fliegenden Tandkrämer verkauften ihre Karrikatur, die Boulevards entlang leuchtete in den Schaufenstern auf großen Photographien die Büste der Herzogin von Assy. Bei einem Feste in den Tuilerien ruhte auf ihr mit einer langen, schwer scheidenden Sehnsucht das glanzlose Auge des Kaisers.
Der Krieg mit Deutschland brachte sie zum Stillstehen inmitten eines Tanzes, dessen Musik jäh abbrach. Den von Melodien gewiegten Kopf noch wollüstig im Nacken, fühlten die Tänzerinnen von ihren Lippen das Lächeln gleiten und ein Zittern um sie her von fernem Donner.
· · ·
Der Herzog brach sofort mit ihr auf. Am Morgen nach ihrer Ankunft in Wien lag er tot im Bett. Sie reiste weiter, von der Leiche begleitet, und sie begrub sie in der Assyschen Gruft zu Zara, auf jenem feierlichen Friedhofe, dem entgegen mit düsterm Pomp der Zug der Zypressen schreitet. Dann verschloß sie sich in ihrem Palais. Die Gesellschaft der dalmatinischen Hauptstadt rückte vor ihrer Tür an, doch beobachtete die Herzogin ein strenges Trauerjahr.
Sie fühlte sich aufgerüttelt, und mehr verwundert als erschreckt durch die Ereignisse. Zum erstenmal hatte sie die beunruhigende Empfindung von etwas Unbekanntem, nicht ganz leicht zu Nehmendem, das irgendwo auf sie wartete. Sie meinte die verflossenen Jahre dort hingebracht zu haben, wo das Leben am stärksten pulste; nun war es ihr, als hätten Ballmusik und leeres Lachen alles übertönt, was des Gehörtwerdens wert war. Und in der plötzlich eingetretenen Stille begann sie zu lauschen.
»Nun bin ich allein. Was ist es nun, was gibt es zu verstehen?«
An der Piazza della Colonna in Zara gab es offenbar nichts zu verstehen. Sie begann wieder, sich zu langweilen, woran sie seit Cannes nicht mehr gewöhnt war, und sah gleich andern Frauen hinter den geschlossenen Läden auf das eingeschlafene besonnte Pflaster hinunter. Zuweilen kamen Leute vom Hof vorbei, Gesichter, die sie bei ihrem raschen Besuche mit dem Herzog gesehen zu haben meinte. Der König saß im Wagen mit Beate Schnaken; die Herzogin lachte, ganz allein in ihren leeren Sälen, über die spaßhaften Geschichten, die man in allen Residenzen weitererzählte.
Die Dalmatiner wurden durch die Eifersucht der einheimischen Geschlechter daran gehindert, einen Fürsten in ihrer Mitte zu suchen. Die Mächte, der unter der früheren Verwaltungen nie beendeten Rassen- und Bürgerkriege müde, lenkten die Wahl des dalmatischen Volkes auf Nikolaus, einen noch verfügbaren Koburger. Um ihm die Krone anzutragen, drang man bis in ein verstecktes Jagdhäuschen, wo er mit Treibern und Hunden in einer Küche lebte. Er war ein anspruchsloser Rauschebart, der mit Pelzmantel, Kappe und kurzer Pfeife durch die Wälder ging wie der Weihnachtsmann. Die Übersiedelung als Herrscher in ein fernes Reich, von dessen Lage er keine sichere Kenntnis besaß, ward dem Alten nicht leicht; doch entsann er sich seiner Fürstenpflicht. Der Bundeskanzler sollte ihm beim Abschied gesagt haben: »Reisen Sie mit Gott und sehen Sie zu, daß wir von Ihrem Lande nichts mehr hören.«
Nikolaus sah zu. Er regierte still und bescheiden. Und wenn sich im Laufe der Jahre niemals herausstellte, ob er klug, gewalttätig, verschlagen oder edelmütig sei, so wurde Eines sehr bald klar: er war ehrwürdig. Seine Völker, die sich gegenseitig Verarmung und gänzliche Ausrottung wünschten, waren darin einig, auf ihren greisen König mit gerührter Liebe zu blicken. Nikolaus war ein Muster als Familienvater. Eine tiefe, unzweifelhafte Ehrbarkeit hüllte alle, die ihm nahe standen, wie in einen Mantel ein, unter dessen Falten ihre Gebrechen verschwanden. Niemand entrüstete sich über den Thronfolger, den jungen Philipp, der, seit im Wiener Theresianum seine Erziehung beendigt war, einem hanswurstmäßigen Vergnügungstrieb lebte; und die schöne Freundin des Königs empfing überall wohlwollende Anerkennung.
Beate Schnaken war eine kleine Schauspielerin, die von Wien nach Zara verschlagen, niemand fand, der gern ihre Schulden bezahlt hätte. In ihrer Not schlich sie früh um fünf aus dem Hause, um in der Jesuitenkirche zu beten. Sobald Nikolaus von Koburg die Führung eines katholischen Volkes übernommen hatte, war er voll Frömmigkeit mit seinem ganzen Hause in die römische Kirche zurückgekehrt. Auch in der Ausübung seiner religiösen Pflichten ging er allen seinen Untertanen voran; in kalter Morgendämmerung verrichtete im Tempel der Jesuiteuväter der greise Herr seine Andacht. Beaten war dieser Umstand bekannt. Sie faltete die Hände und verhielt sich ganz ruhig. Der König sah im Winkel etwas Schwarzes und achtete nicht weiter darauf. Am Morgen danach bemerkte er, daß aus dem schwarzen Schleier, der über einem Betstuhl lag, ein bleiches Profil in den Weihrauch hineinstarrte. Als ihm am dritten, vierten und fünften Tage immer dasselbe Bild auffiel, konnte der Alte sich einer herzlichen Rührung nicht enthalten, und Beate Schnakens Glück war gemacht.
Außer ihrer Gage empfing sie eine anständige Apanage. Nikolaus besuchte sie jeden Abend. Geheime Agenten lauschten an den Türen, doch selten fiel ein politisches und niemals ein unpassendes Wort. Im Wagen saß Beate immer an der Seite des königlichen Freundes, weiß und rosig, das sich entwickelnde Doppelkinn in den schwarzen Spitzenkragen gedrückt. Graf Bittermann, Nikolaus’ Jugendfreund, hatte sie kniefällig gebeten, sich ihm antrauen zu lassen; mit der Gräfin Bittermann dürfe der König verkehren. Beate aber wies den treuen Diener der Dynastie Koburg ab; sie glaubte, der von ihm gewünschten Ehrenrettung gar nicht zu benötigen. In der Tat verlangte sie niemand von ihr. Die Königin sogar hatte Beate ins Herz geschlossen; man erzählte in dieser Beziehung rührende Züge.
Beate fand sich in ihre zarte Stellung mit der größten Gewandtheit, ohne jeden Rückfall in frühere Lebensphasen. Hier und da nahm sie kurzen Urlaub zu einem Stelldichein in Nizza mit einem Wiener Pferdejuden, oder um jenseits der Schwarzen Berge einen Kollegen von der Hofbühne zu treffen. Dann kam sie zurück, vernünftig, schlicht, mit stiller Würde; innerhalb der Landesgrenzen geschah nie das Geringste.
Die Herzogin unterrichtete sich manchmal sogar aus den Zeitungen über die Taten und Gebärden dieser Herrschaften. Wer ihr in Paris, vor fünf Monaten gesagt hätte, daß sie, um ihre Stunden hinzubringen, zu solchen Mitteln greifen werde!
Prinz Phili ritt eines Tages über den Platz. Sie stand leicht und lässig auf dem monumentalen Balkon ihres ersten Stockwerks und sah an den langen Säulen hinab, an deren Fuß zwei Greifen das Portal bewachten. Links saß ein eleganter Kavalier, rechts ein Hüne in Uniform, in der Mitte aber ein Männchen von schlechter Haltung, das fahrige Blicke umherwarf und unablässig mit kleinen bleichen Händen in den dünnen schwarzen Haaren grub, die auf seinen Wangen keimten. Die Herzogin wollte sich zurückziehen; Phili hatte sie schon erblickt. Er schleuderte die Arme in die Luft, in seinem Gesicht leuchtete es rosig auf. Er wollte anhalten. Sein eleganter Begleiter blieb gefällig stehen, doch der riesige Krieger riß rauh am Zügel des Prinzen. Phili zog den Kopf tief zwischen die Schultern zurück und folgte ohne Klage. Seine bemitleidenswerte Rückenlinie verschwand um die Ecke.
· · ·
Es war im Dezember. Sie setzte einmal über die Hafenbucht. Die helle, feine Stadt, geformt mit der Anmut Italiens, blieb zurück; gegenüber lag unter dem schweren Sturmhimmel nichts als eine graue Steinwüste mit zerbröckelnden Hütten. Der Anblick, der sie kränkte, stachelte etwas in ihr auf, ein Bedürfnis zu wagen, zu handeln und die Kräfte zu messen: sie ließ sich die Ruder reichen, sie tauchte sie tapfer in die lärmenden Wellen, die das Boot herumrissen. Sie sah sich machtlos und kämpfte aus Trotz. Da bemerkte sie am Strande einige Männer mit aufgesperrten Mündern und wild umhergeworfenen Armen. Sie schienen zornig; ein Alter mit gesträubtem weißen Bart drohte ihr mit den Fäusten und sprang dabei von einem Bein auf das andere.
»Was haben die Leute?« fragte sie ihren Gondolier.
Der Mann schwieg. Der Jäger erklärte zögernd:
»Es ist ihnen nicht recht, daß die Frau Herzogin rudern will.«
»Ah!«
Was konnte ihnen das machen? Es mußte eine kleine Eigenheit des Volkes sein, diese seltsame Eifersucht. Sie erinnerte sich jener unverständlichen Menschen, von denen sie als Kind für eine Hexe gehalten wurde. Das Volk besaß lauter Marotten. Es sang in sogenannten Volksliedern von Türkenkriegen, die niemals stattgefunden hatten.
Sie hatte die Ruder weggelegt, das Boot war ans Land geschleudert. Sie stieg aus. Der Alte kreischte noch einmal auf und schlich scheu davon. Sie besah sich durchs Lorgnon die jungen Burschen, die ungeschickt stehen blieben.
»Haßt ihr mich denn sehr?« forschte sie wißbegierig.
»Prosper, warum antworten die Leute nicht?«
Der Jäger wiederholte ihnen die Frage in ihrer Sprache. Schließlich sagte eine Stimme, die noch heiser vom Fluchen war.
»Wir lieben dich, Mütterchen. Gieb uns Geld für Schnaps.«
»Prosper, frage sie, wer der Alte ist.«
»Unser Vater.«
»Trinkt ihr viel Schnaps?«
»Selten. Wenn wir Geld haben.«
»Ich gebe euch welches. Aber die Hälfte gebt ihr eurem Vater.«
»Ja, Mütterchen. Alles was du befiehlst.«
»Prosper, geben Sie ihnen …«
Sie wollte sagen: zwanzig Franken, überlegte aber, daß das Volk sich tot trinken könnte.
»Fünf Franken.«
»Die Hälfte dem Vater«, wiederholte sie und stieg schnell ins Boot.
»Wenn ich zusehe, werden sie es ihm natürlich geben«, dachte sie. »Wie aber, wenn sie unbeobachtet sind?«
Sie war gespannt, obwohl sie sich sagte, daß es gleichgültig sei, wie eine schmutzige Familie sich um fünf Franken vertrage.
Tags darauf wollte sie den Jäger hinschicken, doch meldete Prosper ihr, der Alte sei gekommen. Sie ließ ihn vor; er küßte ihren Rocksaum.
»Dein Knecht küßt deinen Saum, Mütterchen, du hast ihm einen Franken geschenkt«, sagte er und sah sie lauernd an. Sie lächelte. Ah, er traute den Burschen nicht, und hatte recht. Er hätte ja zwei und einen halben Franken bekommen sollen. Aber daß sie ihm doch etwas gegeben hatten!
»Erwartete ich das?«
Sie war belustigt und sagte:
»Es ist gut, Alter, ich komme morgen wieder an euer Ufer.«
· · ·
Der folgende Tag war blau. Sie stand zum Ausgehen bereit, als draußen sich Stimmen erhoben. Prinz Phili stolperte an fünf Lakaien vorbei, über die Schwelle.
»Einem Freunde Ihres Gemahls, des seligen Herzogs«, so rief er aufgeregt, »Frau Herzogin werden doch einem lieben Freund des Herzogs nicht die Tür weisen. Küß die Hand, Frau Herzogin.«
»Königliche Hoheit, ich empfange niemand.«
»Aber einen lieben Freund. Wir hatten uns ja so lieb. Und dann, wie geht es der lieben Fürstin Pauline. Ach ja, Paris. Und die gute Lady Olympia, a so a herzigs Weiberl.«
Die Herzogin lachte. Lady Olympia Ragg war gerade noch einmal so groß und breit wie Prinz Phili.
»Ist sie noch in Paris, die Olympia? Ist gewiß schon wieder in Arabien oder am Nordpol. Eine wirklich liebe, überaus leicht zugängliche Frau. Es hat mich gar keine Mühe gekostet«, sagte er schäkernd. »Aber gar keine. Schauen Sie, jetzt werden Sie schon munterer.«
»Königliche Hoheit, es ist schwer, Ihnen zu widerstehen.«
»Trauern ist schon recht, aber nicht gar so arg. Ich trauere ja auch. Da schaun’s.«
Er berührte seinen umflorten Ärmel.
»Der Herzog war doch mein Busenfreund. Das letzte Mal als ich ihn sah, wissen Sie in Paris, ermahnte er mich so rührend zur Vernunft, aber so rührend, sage ich Ihnen. Phili, sagte er, Mäßigkeit im Genuß von Wein und Weibern. Er hatte nur zu recht, aber kann ich ihm folgen?«
»Königliche Hoheit können sicher, wenn Sie wollen.«
»Das gehört zu Ihren Vorurteilen. Mit achtzehn Jahren bekam ich von einem Hofmeister Portwein; er stahl ihn mir eigenhändig von der Hoftafel. Heute bin ich zweiundzwanzig und trinke schon nur noch Kognak. Erschrecken bitte nicht, Frau Herzogin, ich verdünne ihn mit Sekt. Ein Wasserglas voll, halb Sekt, halb Kognak. Meinen Sie, daß es schadet?«
»Ich weiß wirklich nicht.«
»Mein Arzt sagt mir, es schadet gar nichts.«
»Dann können Sie’s ja tun.«
»Das denken Sie doch auch wirklich?«
»Aber warum trinken Sie? Es gibt für einen Thronfolger doch so viele andere Beschäftigungen.«
»Das gehört zu Ihren Vorurteilen. Ich bin unbefriedigt wie alle Thronfolger. Erinnern Sie sich an Don Carlos. Ich möchte nützlich sein, und man verurteilt mich zur Untätigkeit, ich bin ehrgeizig, und jeder Lorbeer wird mir vor der Nase weggeschnitten.«
Er sprang auf und trollte gebeugt durchs Zimmer. Seine Arme waren immer erhoben wie Flügel, die Hände wippten in der Höhe der Brust, an den Gelenken auf und ab.
»Sie Ärmster«, sagte die Herzogin und blickte auf die Uhr.
»Die Schranzen verdächtigen mich bei dem Könige meinem Vater, als könne ich die Zeit meiner Thronbesteigung nicht erwarten.«
»Aber Sie können es doch?«
»Mein Gott, ich wünsche dem König langes Leben. Aber ich möchte auch leben, und man will es nicht.«
Er schlich auf den Fußspitzen nahe zu ihr hin und flüsterte mit Anstrengung dicht an ihrem Gesicht:
»Wollen Sie wissen, wer es nicht will?«
Sie hustete; ein scharfer Alkoholduft wehte sie an.
»Nun?«
»Die Je-su-iten!«
»Ah!«
»Ich bin ihnen zu aufgeklärt, darum verderben sie mich. Wer ist denn heute fromm? Die Klugen geben vor es zu sein: ich bin zu stolz dazu. Glauben Sie, Frau Herzogin, etwa an die Auferstehung, oder an die unbefleckte Empfängnis, oder überhaupt an das ganze Himmelreich? Ich persönlich bin über das alles hinaus.«
»Ich habe mich nie dafür interessiert.«
»Vorurteile habe ich keine mehr, sage ich Ihnen. Die Kirche fürchtet mich, darum verdirbt sie mich.«
»Bitte, wie macht sie das?«
»Sie fördert meine Laster. Sie besticht meine Umgebung, daß man mir zu trinken gibt. Wenn ich irgendwo einem schönen Weibe begegne, so haben die Schwarzen mir’s in den Weg gestellt. Ich bin nicht einmal sicher, Frau Herzogin, ob nicht Sie … Sie selbst … Sie sind vielleicht doch fromm?«
Er schielte sie von der Seite an. Sie begriff nicht.
»Warum standen Sie neulich auf dem Balkon, gerade als ich vorbeiritt?«
»Ach, Sie glauben?«
Er zögerte, dann stimmte er in ihr Lachen ein. Er rückte auf seinem Sessel zutraulich näher.
»Ich fürchtete nur, weil Sie gar so schön sind. Phili, hab’ ich zu mir gesagt, da ist eine Falle. Schau daß du weiter kommst. Aber Sie sehen, ich bin nicht weitergekommen: da sitze ich.«
Er kam noch näher, seine wippenden Händchen streiften schon die Spitzen vor ihrer Brust. Sie erhob sich.
»Gelt, ich darf da sitzen bleiben?« lallte er, erregt und unsicher.
»Aber mir erlauben königliche Hoheit, daß ich ausgehe?«
»Aber wozu denn! Gehn’s, Frau Herzogin, sein’s gemütlich.«
Er trollte ihr nach, von einem Stuhl zum andern, demütig und ausdauernd.
»Aber das alte Empire-Gerümpel müssen Sie hinaustun und was Molliges da hereingeben, daß man lieb plauschen kann und sich auswärmen. Dann komm’ ich alle Tage zu Ihnen. Sie glauben nicht, wie ich zu Hause kalt hab’ bei meiner Frau. Muß man mir auch eine Frau aus Schweden holen, die zu predigen anfängt, sobald sie meiner gewahr wird. Quelle scie, Madame! Ein Sägefisch aus Schweden: das ist ein selbsterfundenes Wortspiel. Und ein französisches auch noch! Ach Paris!«
Er redete langsamer, ängstlich horchend. Der Vorhang öffnete sich, der elegante Begleiter des Prinzen erschien auf der Schwelle. Er verneigte sich tief vor der Herzogin und vor Phili, und sprach:
»Königliche Hoheit erlaube mir zu erinnern, daß Seine Majestät Euere königliche Hoheit um elf Uhr zum Frühstück erwarten.«
Er verneigte sich abermals. Phili murmelte: »Gleich, mein lieber Percossini.« Die Tür ging zu.
Der Prinz wurde plötzlich beweglich.
»Haben Sie ihn wohl gesehen, den Schuft. Das war der Baron Percossini, so ein Italiener. Der Schuft, er wird ja gezahlt von den Je-su-iten. Er hat gewartet, bis ich hier bei Ihnen recht warm geworden bin. Jetzt holt er mich fort, gerade im schönsten Moment, wo ich anfange zu hoffen. Ich soll närrisch werden, die Jesuiten zahlen’s. Sagen Sie, liebste Herzogin, darf ich morgen wiederkommen?«
»Unmöglich, königliche Hoheit.«
»Bitte, bitte.«
Er flehte, tränenerstickt.
»Sie sind zu schön, ich kann doch nicht anders.«
Dann plauderte er wieder.
»Der Major von Hinnerich, mein Adjutant, ah, das ist ganz was anderes. So ein braver Mann! Ein wirklich braver Mann, er hindert mich an jedem Vergnügen. Aber an jedem, sag’ ich Ihnen. Haben Sie neulich gesehen, wie er an meinem Zügel zog? Ein so treuer Diener meines Hauses. Seien Sie lieb, Frau Herzogin, besuchen Sie meine Frau, kommen Sie zu unserm cercle intime. Ich muß Sie doch wiedersehen, ich kann doch nicht anders. Gelt, Sie kommen? Der Prinzessin machen Sie solche Freude, sie spricht immerfort von Ihnen. Gelt, Sie kommen?«
Sie machte ungeduldig ein paar Schritte auf die Tür zu.
»Ich komme.«
Der Vorhang rauschte von neuem. Phili legte unvermutet eine gnädige Anmut an den Tag.
»Mein lieber Percossini, ich gehöre Ihnen. Küß die Hand, Frau Herzogin, und auf Wiedersehen beim cercle intime.«
· · ·
Die Herzogin begab sich zu Fuß nach dem Hafen. Ein reiner Nordwind strich über das violette Meer. Beim Landen fand sie drüben am Strande einen bunten Volkshaufen, der auf sie zu warten schien. Allen voran leuchtete unter dem kraßblauen Himmel der kupferrote, schöne Bart eines feingekleideten, stattlichen Herrn. Der graue Schlapphut war von seinem Anzuge das einzige nicht der Mode entnommene Stück. Er verneigte sich: im selben Augenblick schrien und plärrten Männer, Frauen und Kinder im Chor, wie etwas Eingelerntes:
»Das ist Pavic, unser Retter, unser Väterchen, unser Brot und unsere Hoffnung!«
Die Herzogin ließ sich sagen, was es bedeute. Dann betrachtete sie den Herrn; sie hatte von ihm gehört. Er stellte sich vor:
»Doktor Pavic.«
»Ich bin gekommen, Hoheit, um Ihnen zu danken. Ihnen ist gedankt, denn Sie wissen: ›Was ihr den Ärmsten meiner Brüder tut, das tut ihr mir‹.«
Sie verstand ihn nicht, sie dachte: »Mir? Wem denn? Ich habe ja überhaupt niemandem etwas tun wollen.« Da sie nichts erwiderte, setzte er hinzu: »Ich spreche, Hoheit, zu Ihnen im Namen dieses unmündigen Volkes, dessen Menschwerdung ich mein ganzes Leben geweiht habe. Mein ganzes Leben«, wiederholte er mit Hingebung.
Sie erkundigte sich:
»Was ist es mit diesen Leuten? Ich möchte etwas über sie wissen.«
»Dies arme Volk, es liebt mich sehr. Sie bemerken, Hoheit, wie dicht es mich umdrängt.«
Sie hatte es bemerkt: das Volk roch übel.
»Ah! Um mich spinnt sich ein gutes Stück Romantik!«
Er breitete die Arme aus, den Kopf im Nacken, daß der schöne, breite Bart keilförmig in die Luft stand. Sie erklärte sich seine Gebärde nicht ganz.
»Wenn Sie wüßten, Hoheit, wie das süß ist: vom Hasse einer Welt umtobt, sich auf einen Wall von Liebe zu stützen.«
Sie erinnerte ihn:
»Und das Volk, das Volk?«
»Es ist arm und unmündig, darum liebe ich es, darum schenke ich ihm meine Tage und meine Nächte Die Umarmungen eines Volkes, Sie mögen mir glauben, Hoheit, sind heißer, sind weicher und beglückender als die einer Geliebten. Ich entreiße mich ihnen manchmal, zu langen, einsamen Fußwanderungen durch mein trauriges Land.«
So schloß er, stiller und getragener.
Er war entschieden von der Darlegung der eigenen Persönlichkeit nicht abzulenken. Sie hatte die Lippen zu einem spöttischen Wort geöffnet, aber sein Organ, dies erstaunliche Organ, das dem Könige und seiner Regierung Furcht einflößte, bezwang ihren Widerspruch. In seiner Stimme schmolz Liebe, die Liebe zu seinem Volk, wie eine köstliche Dragée Ein Duft, fade und berauschend, entströmte seinen leersten Worten, ein ihr peinlicher Duft; aber er wirkte auf sie.
Einige Schritte landeinwärts äußerte sie:
»Sie sind ein Tribun? Man fürchtet Sie sogar?«
»Man fürchtet mich. O ja, ich glaube wohl, daß jene vornehmen Herren mich fürchten, die damals, als ich die schamlosen, verworfenen Sitten des Thronfolgers nach Verdienst öffentlich gebrandmarkt hatte, in mein Haus gedrungen sind.«
»Ach, wie ist das abgelaufen?« fragte sie, begierig auf Geschichten.
Er blieb stehen.
»Sie mußten sich in der nächsten Apotheke die Köpfe verbinden lassen. Die Polizei vermied es ängstlich sich einzumischen«, sagte er kalt und ging weiter.
Er gab ihr zehn Sekunden zum nachdenken; dann hielt er wieder an.
»Aber niemand, der ein gutes Gewissen besitzt, braucht mich zu fürchten. Man weiß ja gar nicht, wie weich ich bin, wie viel von meinem Zorn aus einer zu zärtlichen Seele kommt, und wie dankbar und treu ich dem Mächtigen, Frau Herzogin, wäre, der für meine Sache seine Hand erhöbe.«
»Und Ihre Sache?«
»Ist mein Volk«, sagte Pavic und setzte seinen Weg fort.
Sie wanderten über spitze Kiesel. In einem armseligen Acker standen gebückte Gestalten, sie warfen unablässig, mit immer gleichen Bewegungen, Steine auf die Straße hinaus. Der Weg lag voll, und das Feld ward nicht leer. Ein Bauer sagte:
»So werfen wir das ganze Jahr. Gott weiß, wo der Teufel all’ die Steine hernimmt.«
»Das ist auch mein Los«, versetzte Pavic sofort. »Jahr ein Jahr aus schleudere ich Ungerechtigkeit und Frevel an meinem Volk aus dem Acker meines Vaterlandes – aber Gott weiß, woher der Teufel immer neue Steine nimmt.«
Die Öffnung einer Lehmhöhle klaffte. Die Herzogin trat, um dem immer nachdrängenden Volke auszuweichen, auf die Schwelle. Ungeheure irdene Krüge ragten in den Ecken, auf dem Boden von hartgestampfter gelber Erde. Durch den schwarzen Raum zog der Geruch von gebratenem Öl. Vor dem schwelenden Feuer eines feuchten Reisigbündels froren drei Männer in braunen Mänteln. Einer sprang auf und kam mit einem tönernen Gefäß auf die Gäste zu. Die Herzogin wich hastig zurück, aber der Tribun ergriff den Weinkelch.
»Das ist der Saft meines Mutterbodens«, sagte er zärtlich, und trank.
»Das ist Blut von meinem Blut.«
Er verlangte ein Stück Maisbrot, zerbrach es und teilte mit den Umstehenden. Die Herzogin sah einem großen Seevogel zu, der kreischend durch die Nacht der Höhle flatterte. Eine kleine Natter ringelte auf dem Tisch.
»Wahrscheinlich ist mir jetzt alles vorgeführt«, sagte die Herzogin. Sie wandte sich wieder dem Ufer zu.
»Sie wollen zur Stadt, Herr Doktor, und haben kein eigenes Boot? Steigen Sie bitte in meines.«
Er nahm einen Knaben mit hinein, ein kränkliches Wesen mit schwachen Augen, weißen Ringellöckchen und von käsiger Farbe.
»Sie haben einen Knaben bei sich?«
»Es ist mein Kind. Ich habe es sehr lieb.«
Sie dachte: »Das brauchte nicht gesagt zu werden. Und mitzunehmen brauchte er es auch nicht.«
Nach einer Pause fragte sie:
»Sie werden doch Pavese genannt?«
»Ich habe mich so nennen müssen. Ohne die Sitten und sogar die Namen unserer Feinde anzunehmen, können wir in unserm eigenen Lande nicht gedeihen.«
»Wer, wir?«
»Wir …«
Er errötete. Sie bemerkte, daß er eine eigentümlich zarte Haut und rosige Nüstern hatte.
»Wir Morlaken«, ergänzte er rasch.
»Morlaken?« dachte sie. So nannte man also jene Bunten, Schmutzigen dort drüben. Das war also ein Volk. Sie hatte es für eine namenlose Herde gehalten. Sie vergewisserte sich:
»Und die Leute am Strande, das waren wohl auch …«
»Morlaken, Hoheit.«
»Warum verstehen sie nicht italienisch?«
»Weil es nicht ihre Sprache ist.«
»Ihre Sprache?«
»Das Morlakische, Hoheit.«
Also besaßen sie auch eine Sprache. Sie hatte, so oft jene die Münder öffneten, ein ungeregeltes Grunzen zu hören gemeint, aus dem Eingeweihte möglichenfalls allerlei traumdunkle Absichten herausahnten, wie aus den Lebensäußerungen der Tiere. Pavic versetzte:
»Wie ich sehe, ist Ihnen, Frau Herzogin, dieses Volk noch unbekannt.«
»Ich habe unter meiner Dienerschaft nie welche gehabt. Ich erinnere mich, mein Vater nannte sie …«
Sie besann sich und schwieg. Er schluckte hinunter. Plötzlich gerade aufgerichtet und eine Hand in der Nähe des Herzens, mit der ganzen Spannung eines vielleicht einzigen Augenblickes begann er zu reden.
»Wir Morlaken sehen zu, wie zwei fremde Räuber sich um unser Land vertragen. Wir sind der Kettenhund, den zwei Wölfe anfallen; und der Bauer schläft.«
»Die beiden Wölfe?«
»Sind die Italiener, unsere alten Bedrücker, und der König Nikolaus mit seinen fremden Schergen. O, Hoheit, mißverstehen Sie mich nicht. Es hat der Dynastie Koburg niemals ein treueres Herz geschlagen als hier in dieser slavischen Brust. Als die Mächte den Prinzen Nikolaus von Koburg auf Dalmatiens Thron setzten, da ging ein Aufatmen durch die slavische Welt. Die vielhundertjährige Schmach wird nun doch gesühnt werden, so hieß es von Archangel bis Cattaro: denn von Cattaro bis Archangel und vom Eismeer bis zu der öligen Flut des Südens schlagen die slavischen Herzen im gleichen Takt. Die lateinischen Räuber, die ein heiliges Slavenvolk schänden, man wird ihnen endlich den Stein um den Hals binden und sie im Meer versenken. So jauchzten wir! So jauchzten wir voreilig. Denn, Frau Herzogin, wie es war, so ist es geblieben: die Fremden herrschen.«
»Welche Fremden?«
»Die Italiener.«
»Die nennen Sie fremd? Hier ist doch alles italienisch. In eine Wildnis, an ein ödes Meer haben die Italiener schöne Städte gebaut …«
»Und nun sitzen – Sie sehen, Hoheit, wie wund Ihre Worte mein Herz trafen, daß ich Sie, Frau Herzogin, zu unterbrechen wage – und nun sitzen sie in diesen schönen Städten als Spinnen und trinken das arme Blut des slavischen Landes. In den Städten am Meer wird auf italienisch geschrien, genossen und Theater gespielt. Man führt den Neugierigen, die vorbeifahren, die Komödie einer Wohlhabenheit, einer Gesittung und Zufriedenheit vor, die dieses Land nicht kennt. Dahinter aber, in den langgestreckten, traurigen Gefilden, geht es ernst und stille zu. Dort wird auf slavisch geschwiegen, gehungert und gelitten. Das Reich, Frau Herzogin, ist nicht derer die genießen, es ist der Leidenden.«
Sie fragte sich: »Hält er leiden für ein Verdienst?«
Der Tribun fuhr fort:
»Die Barbarei und das Elend in ein Land tragen, wo nur Genügsamkeit und Unschuld waren; in den Leibern der Armen nach Gold graben und um Gold ihre unsterblichen Seelen verkaufen – das nannten unsere einstigen Herren, die Venetianer: kolonisieren. Zum Ersatz für alles was sie uns nahmen, sandten sie uns ihre Künstler, die bauten uns einige nichtsnutzige Monumente; daran durften die Hungernden sich satt sehen.«
Er sprang auf. Die gespreizte Rechte ausgestreckt nach der weißen Stadt, die vor ihnen sich aus dem Wasser erhob, rief er in den Wind hinein:
»Wie ich sie verabscheue, diese ruchlose Schönheit!«
Die Herzogin wendete, leicht angewidert, den Kopf weg. Pavic vermochte sich in dem heftig schwankenden Boot nicht lange auf den Beinen zu halten; er taumelte und saß hart nieder. Dann legten sie an. Pavic seufzte tief:
»Der König Nikolaus weiß von alledem nichts. Ich achte ihn, er ist fromm, und auch ich war als einfaches Slavenherz immer ein gläubiger Sohn der Kirche. Aber er steckt im Lügengarn der Italiener. Hätte er sonst einen treuen Untertanen wie mich, verfolgt und eingekerkert?«
Ihr Wagen war vorgefahren, sie stand schon am geöffneten Schlage; plötzlich sah sie sich nochmals nach ihm um.
»Sie haben im Kerker gesessen?«
»Hoheit, zwei Jahre lang.«
Die Herzogin erhob das Lorgnon: sie hatte noch niemals einen Staatsverbrecher gesehen. Pavic stand barhäuptig im Schmuck seiner kurzen, braunroten Locken, das Licht flimmerte in seinem rotblonden Bart, er blickte ihr freimütig in die Augen.
»Sie müssen unversöhnlich sein«, versetzte sie endlich. »Ich wäre es.«
»Gott verhüte es. Aber immer fromm und immer loyal gewesen, und bloß weil ich mein Volk liebe, verfolgt und eingekerkert – Hoheit, das schmerzt«, sagte er innig.
»Schmerzt? Sie müssen doch wütend sein!«
»Hoheit, ich vergebe ihnen …«
Er hielt die Rechte mit nach außen gekehrter Handfläche ein Stück seitwärts von der Hüfte weg. Er blickte gen Himmel.
»Denn sie wissen nicht, was sie tun.«
»Erzählen Sie mir gelegentlich mehr, Herr Doktor.«
Sie grüßte ihn aus dem Wagen.
Es war Mittag, in den windgeschützten Straßen brannte die Sonne. Die Herzogin fühlte sich aufgeweicht und eingeschläfert von lauter auf sie herniedergegangenen Worten, einfangenden, umstrickenden, entkräftenden Worten. Noch in ihren kühlen Sälen umspann sie ein ungesunder Zauber. Alle Gegenstände, die sie anfaßte, waren zu weich, das Schweigen im Hause zu schmeichelnd und zu träumerisch. Ein kleiner Vogel, der sich an ihrem Fenster den Kopf einstieß, hätte ihr fast leid getan, als er schon tot war. Sie brauchte eine Nacht, um wieder gelassen und vernünftig zu werden.
· · ·
Acht Tage später kam ein verzweifelter Brief vom Prinzen Phili. Von Hinnerich sei zu treu, er lasse ihn keinen Schritt mehr allein gehen. Wenn sie ihm ein Wiedersehen beim cercle intime versage, so verliere er den letzten moralischen Halt. Das werde sie nicht wollen, nur die Jesuiten könnten das wünschen.
Sie gab bei der Prinzessin ihre Karte ab. Darauf erschien bei ihr ein Hofjäger mit einer schriftlichen Einladung zu Ihrer königlichen Hoheit.
Als der Lakai vor ihr die Flügeltür aufriß, warf Phili einen Handarbeitstisch um. Zwei Teetassen gingen in Scherben. Die in dem weiten, kalten Gemach einsam frierenden Personen erhoben sich eifrig, erlöst aus trüber Langeweile. Die Prinzessin zog liebenswürdig einen zweiten Sessel neben den ihrigen, in dessen warmen Tiefen sie mit frostigem Beben ganz verschwand. Sie war lang, beängstigend schmal und mager, und weißlich von Haaren, Haut, Augen und Wesen. Ellenbogen und Knie stachen wie Lanzen durch den Stoff des schlichten, geschlossenen Kleides, die Handgelenke wollten abbrechen in den Spitzenmanschetten.
»Sie haben uns aber lange warten lassen«, äußerte sie.
Sie sprach langsam, leise klagend. Man wußte beim ersten Wort, ihr sei auf keine Weise beizukommen.
»Mit Bedauern, königliche Hoheit«, entgegnete die Herzogin.
»Dennoch hätte ich meine Zurückgezogenheit noch lange nicht aufgegeben, nur der Wunsch Euerer königlichen Hoheit konnte mich dazu bewegen.«
»Sie tun es mir zu Liebe, Hoheit? Gott lohne es Ihnen. Wie habe ich mich danach gesehnt, mit einem Menschen der großen Welt, mit Ihnen, liebe Herzogin, von da draußen reden zu dürfen – von Paris …«
Dies Wort erregte ein Stöhnen, es pflanzte sich fort durch den Raum. Phili wiederholte dumpf: »Paris«. »Paris«, lispelten zwei reich geputzte Damen, deren kunstvolle Locken, von großen Rosen gekrönt, über porzellanweiße Nacken fielen. Hinter ihnen warfen ihre Männer die blaßbraunen Köpfe zurück, daß die gewichsten Stacheln ihrer dicken schwarzen Schnurrbärte zur Decke starrten: »Paris«. »Paris«, murmelte Percossini mit angenehmem, sehnsuchtstiefen Baryton. Aus einem wenig erhellten Winkel, von Seidenkissen erstickt, drang der matte Seufzer einer dicken, schönen Frau: »Paris«. Und nur von Hinnerich blieb ohne eine Miene zu verziehen, aufmerksam und pflichtgetreu, neben dem Stuhl stehen, auf dem des Thronfolgers kümmerliche Glieder zappelten.
Die Prinzessin sagte:
»Hoheit erlauben, daß ich Sie mit unsern Freunden bekannt mache.«
»Mes dames Paliojoulai und Tintinovitsch.«
Die beiden Damen beschrieben in ihren hinten centaurenmäßig entwickelten Roben weite Komplimente. Ein anmutiges Lächeln wollte die milchige Fettschicht auf ihren Gesichtern in Fluß bringen. Die Herzogin bemerkte, daß Madame Tintinovitsch schön sei mit ihrer feinen Adlernase und den schwarzen Brauen unter den blondgefärbten Locken.
»Prinzessin Fatme«, sagte Friederike von Schweden, »meine liebe Fatme, die Gemahlin Ismael Iben Paschas, des Gesandten Seiner Majestät des Sultans bei unserm Könige.«
»Eine Gemahlin«, so verbesserte Phili. »Drücke dich stets genau aus, meine Liebe: eine von seinen vier Gemahlinnen.«
Die Herzogin ging freundlich der schönen, dicken Frau entgegen; sie wickelte sich aus ihren Kissen heraus. Ihre knappe, blaue Atlastunika über gelben Spitzen war nicht weit vom Boulevard entstanden: aber das mondvolle, schimmernde Antlitz mit den gemalten Bogen hoch über den kohleumränderten, schmalen Augen, und das köstlich gesalbte Haar im bleichen Tau der Perlengehänge, entschlüpfte sichtlich einer aus Versehen offen gebliebenen Tür des Harems. Starker Patchouligeruch entströmte ihren Gliedern; im Hauch ihres Mundes indessen vermischte sich eine Erinnerung an süßen Tabak mit ganz, ganz leisem Knoblauchduft.
»Herr Tintinovitsch, Herr Paliojoulai«, sagte Philis Gemahlin.
Der eine war vom andern nicht zu unterscheiden. Die Schnurrbarte, die kalten, müden Augen, die blendende Wäsche und die Brillanten, überall angebracht, wo es irgend ging, gehörten ihnen gemeinsam. Sie verneigten sich gleichzeitig. Sie schienen einer Art von Männern anzugehören, die durch vornehme Gewandtheit jeden Salon zieren, und denen man zutraut, daß sie in kritischer Stunde, nach einem Spielverlust, den Frauen die Ohrläppchen abreißen, an denen Juwelen hängen. Die Diamanten, die auf ihren geschmeidigen Körpern blitzten, vielleicht hatten sie sie eigenhändig aus den Schächten Indiens geholt. Ein Blick in ihre harten, eleganten, mit haarscharfen Fältchen übersäeten Gesichter ließ eine Menge fremdartiger Geschichten ahnen. Wenn es mit der Dynastie Koburg je bergab ging, so vertauschten die Herren Paliojoulai und Tintinovitsch das dalmatinische Königsschloß möglichenfalls mit den Spielsälen Monacos, immer gleich sicher, als Höflinge und als Croupiers.
Die künftige Königin sagte:
»Baron Percossini, Major von Hinnerich.«
Die schlanke, elegante Gestalt des Kammerherrn klappte zusammen. Sein verehrendes Lächeln war weich wie sein gekräuseltes Bärtchen; aber sein Blick schätzte und stahl. Er bot sich mit weißen Zähnen und sanften Händen als stiller Freund an, als belangloser Verehrer und feiner Vermittler in allen Heimlichkeiten. Er hielt alles für möglich und zweifelte an allem, außer am Wert des Geldes.
Von Hinnerich zweifelte an gar nichts, und möglich war für ihn nur das Bestehende. Er war baumgroß und hatte ein rotblondes, ungelenkes Gesicht, nicht ganz frisch rasiert. Er verbeugte sich rasselnd.
»Ja, Frau Herzogin, das ist der Hinnerich, so ein treuer Mensch!« schrie unvermittelt Prinz Phili und sprang von seinem Sitze. Er schlang einen Arm um die Hüfte seines Adjutanten und grinste gebückt und ganz verklärt zu ihm hinauf, wie ein Äffchen am Fuß der deutschen Eiche. Plötzlich besann er sich auf etwas anderes.
»Sie sind ja gesehen worden, Frau Herzogin. Wissen’s, das ist aber gar nicht schön von Ihnen, daß Sie mit andern Leuten spazieren gehen und nicht mit uns.«
»Königliche Hoheit meinen?« fragte die Herzogin. Friederike erläuterte:
»Sogar mit jemand, der solche Ehre vielleicht nicht ganz verdient.«
»Mit einem Staatsverbrecher, Hoheit«, fügte Percossini liebenswürdig hinzu. Prinzessin Fatme meinte mit sehr hoher Flötenstimme:
»Einem gefährlichen Kerl, Frau Herzogin.«
Die Damen Paliojoulai und Tintinovitsch kreischten leise. Ihre Gatten bestätigten mit Überzeugung:
»Einem höchst gefährlichen Kerl, Hoheit.«
Sie war aufrichtig erstaunt.
»Doktor Pavic? Es war eine zufällige Begegnung. Er scheint ein gutmütiger, ziemlich eitler Mensch zu sein.«
»Ach nein!«
»Riesig naiv für sein Alter«, so ergänzte sie. »Was man eine gläubige Natur nennt, meine ich.«
»Das ist ja …«
Phili lachte kindisch. Der Rest der Gesellschaft sah sich ernst an.
»Frau Herzogin verzeihen, das ist ja gottvoll.«
»Mein Lieber, das ist nicht gottvoll«, berichtigte seine Gemahlin. Sie saß lang und weißlich da.
»Dieser Pavic, Hoheit, ist unser gefährlichster Revolutionär. Er verhetzt unser gutes Volk, er will uns vertreiben. Wir sollen im Exil enden oder auf der – der Guillotine.«
Sie sprach säuerlich und jeden Widerspruch ausschließend.
»Wenn Euere königliche Hoheit davon überzeugt ist …« sagte die Herzogin.
»Das ist so.«
»Dann müßte man einmal mit ihm reden. Übrigens hat er schon im Kerker gesessen, das fand ich famos. Sie könnten ihn ja wieder hineinsetzen.«
»Wenn das heute noch ginge.«
»Auch ist es sicher nicht nötig. Er begeht keine Gewalttaten, er ist fromm.«
»Weil er die Geistlichkeit braucht.«
»So ein Heuchler!« rief Phili. »Er hält’s mit die Je-su-iten.«
»Königliche Hoheit erlauben«, äußerte Percossini mit zärtlicher Stimme. »Es fragt sich, für wie wichtig man den Herrn hält. Mit etwas Geld wäre er natürlich leicht zu beschwichtigen.«
»Ich bezweifle es«, sagte die Herzogin.
»Geld!« schrie entrüstet Tintinovitsch. »Prügel!«
»Prügel, wollen Sie sagen, Baron«, schrie Paliojoulai.
Ihre Gattinnen fragten in süßen Tönen:
»Ihr habt ihn doch schon einmal durchgehauen. Wenn königliche Hoheit der Meinung ist, so tut ihr’s eben nochmals. Nicht wahr, Eugène? Nicht war, Maxime?«
»Ah! Sie haben damals die Exekution übernommen«, versetzte die Herzogin. »Sagen Sie bitte, meine Herren, befindet sich bei Doktor Pavic’ Wohnung nicht eine Apotheke, wo man Verbandzeug bekommt? Ich frage nur beiläufig.«
Die beiden bewegten fassungslos ihre weißen Augäpfel, sie rissen die Münder auf und zeigten ihre vollständigen Gebisse wie zwei große, braune Nußknacker. Die Herzogin überlegte ungeduldig: »Wie komme ich dazu, mich wegen des Pavic aufzuregen? Aber die Dummheit all dieser Leute zwingt mich ja, Partei zu ergreifen.« Nach einer verlegenen Pause begann die Prinzessin schleppend zu sprechen.
»Nein, ich halte es nicht für möglich, alle Klagen vermittelst Prügel zu beseitigen. Aber beseitigt müssen sie werden. Ich werde sogar schon in allernächster Zeit eine Suppenküche eröffnen lassen. Baron Percossini hat von meinen diesbezüglichen Weisungen Notiz genommen.«
Der Kammerherr verneigte sich.
»Am nächsten Mittwoch beginnen wieder unsere Strickabende bei den Dames du Sacré Cœur. Samstag ist dann an den jungen Mädchen die Reihe. Bitte, sich daran zu erinnern, meine Damen. Das Volk soll Suppen und wollene Westen erhalten, das ist mein fester Wille. Ferner das Geistige. Wir sind jetzt ja allerdings katholisch …«
»Allerdings«, bestätigte schnarrend von Hinnerich.
»Trotzdem, meine ich, könnten wir einen Bibelverein gründen. Sie gehen doch fleißig mit den Sammellisten für die Friederiken-Versöhnungskirche umher, meine Herren Paliojoulai und Tintinovitsch? Vergessen Sie nicht den Baron Rustschuk; diese Juden können geben.«
Die künftigen Croupiers rollten weiße Blicke gen Himmel.
»Und die Feste?« äußerte Prinzessin Fatme, die unvermutet im Lichtkreise der Kerzen erschien.
»Wo bleiben die Wohltätigkeitsfeste, liebste Friederike? Ein Bazar, eine Weihnachtskrippe, nicht wahr, so nennt ihr das? Beate Schnaken verkauft Puppen; die Schnaken kleidet reizend Puppen an. Ich habe eine türkische Konfiserie. Mesdames Paliojoulai und Tintinovitsch …«
»Und ein Ball!« bat Frau Tintinovitsch.
Fatme war schmerzlich berührt.
»O nein, kein Ball!«
Sie watschelte mit kurzen Beinen unbehilflich auf Friederike von Schweden los und fiel ihr plump um den Hals.
»Bitte, du Süße, kein Ball!«
Die Prinzessin tröstete sie.
»Liebste, auch ich halte nichts vom Tanzen. Dagegen werde ich den Polizeidirektor veranlassen, daß er die Wirtshäuser um neun Uhr schließt. Ferner denke ich auf die Frauen einzuwirken, daß sie nicht mehr aufs Rad steigen, sondern Compote einmachen, was ich für sittlicher halte. Überhaupt muß die Unsittlichkeit aufhören. Das wäre, denke ich, alles. Oder sollte ich noch etwas vergessen haben?«
Niemand hatte Ergänzungen zu machen.
»Es ist ganz gut, liebe Herzogin, daß Sie mich heute abend auf die Sache gebracht haben. Einmal muß die soziale Frage doch aus der Welt kommen.«
So schloß die Prinzessin, merklich gereizt.
Die Gattin des türkischen Gesandten schlug sich klatschend vor die üppige Brust, sie machte ein unsäglich verwundertes Gesicht.
»Ich begreife gar nicht, was ihr euch für unnütze Mühe gebt, ihr seid doch zu unerfahren. Hört einmal, wie mein Mann es gemacht hat, als er in Kleinasien Pascha war. Die Christen kamen von den Feldern, es waren auch Gläubige dabei, und alle hatten nichts zu essen und waren schrecklich aufgebracht. Mein Mann ließ ihnen sagen, er habe Mehl die Menge, sie sollten nur in den Hof des Kastells kommen. Sie kamen; und kaum waren alle zwischen den hohen Mauern eingepfercht, da ließ mein Mann die Tore schließen, und von oben herab …«
Fatme lachte zwischen den Worten. Ihre Erzählung war ein kindliches Gezwitscher.
»… von den Mauern herab wurden sie alle massakriert. Haha! Massakriert.«
»Oh! Oh!« machten die Damen Paliojoulai und Tintinovitsch, und in ihren Seufzern mischten sich Grauen und Verlangen.
»Sie drängten sich und schrien wie Schweine auf einem zu engen Fleischerwagen, wenn eines nach dem andern vom Fleischer herabgeholt wird.«
Die Prinzessin lächelte nachsichtig.
»Nein, du Gute, das würde bei uns doch zu viel Anstoß erregen.«
Von Hinnerich trat geräuschvoll von einem Fuß auf den andern.
»Leider!« schrie er plötzlich, dunkelrot im Gesicht. Der preußische Major war begeistert von der Anekdote der Haremsdame.
»Es bleibt bei den Suppen und den wollenen Westen«, so entschied Friederike von Schweden.
»Nicht wahr, meine liebe Herzogin von Assy, Sie übernehmen bei einem meiner guten Werke den Ehrenvorsitz. Sie interessieren sich doch auch für die Lösung der sozialen Frage.«
»Königliche Hoheit, ich habe noch nicht daran gedacht. Möglichenfalls fällt es mir einmal ein …«
Man erstaunte auf allen Seiten.
»Aber warum geben Hoheit sich alsdann mit dem Pavic ab?«
»Warum waren Sie drüben bei den Morlaken?«
»Zweimal schon?«
»Weil ich mich langweilte«, erklärte die Herzogin. »Da dachte ich an das Volk. Denn das Sonderbarste, was ich im Leben kennen gelernt habe, ist das Volk. So oft ich ihm begegnet bin, ist es mir ein Rätsel gewesen. Es gerät nämlich in Wut über Dinge, die ihm vollständig gleichgültig sein könnten, und glaubt an Dinge, die eigentlich nur ein Verrückter für wahr halten kann. Wenn man ihm einen Knochen hinwirft, wie einem Hunde – und wo ist denn der Unterschied? – so frißt es ihn zwar, wedelt aber nicht mit dem Schweife. Ah! Das hat mich immer am meisten neugierig gemacht. So glaube ich auch nicht, daß mit Suppen und wollenen Westen alles erledigt wäre …«
»Da irren Hoheit«, sagte überlegen die Prinzessin. »Da irren Sie ganz entschieden.«
Die Herzogin sprach weiter:
»Der Kaiser Napoleon war um sein Volk sehr besorgt. Paris blühte und ward immer fetter. Ich glaube kaum, daß es dort viele Leute ohne Suppe und wollene Weste gab.«
Jemand stöhnte:
»Ah! Paris!«
»Dennoch tobte das Volk unter Krämpfen in diesen überflüssigen und unvernünftigen Krieg hinein. Auf unsern Reisen ist mir manches aufgefallen, doch nichts so sehr wie jener schwarze Tumult, und daraus hervorschreiend im gelben Licht der Gasflammen die bleichen, schwitzenden Gesichter: ›Nach Berlin!‹«
»Ah! Paris!«
»Und Hoheit, Sie, die alles bis zuletzt miterlebt haben, können uns aufklären: wo ist Adelaide Troubetzkoi geblieben?«
»Und d’Osmond?«
»Und die Komtesse d’Aulnaie?«
»Und die Zozie?«
Die Herzogin zuckte die Achseln.
»Die kleine Zozie soll einen Kommunard lieben. Sie steht in den Straßen auf umgeworfenen Schränken und Omnibussen und lädt Flinten.«
»Quelle horreur! Auf den Marquis de Châtigny folgt ein Kommunard!«
Madame Paliojoulai sagte bitter:
»Die Vorfälle in Paris sind einfach eine Niedertracht. Sehen Sie doch, mit was für Handschuhen ich gehen muß. Aus Paris bekomme ich schlechterdings keine Handschuhe mehr. Ist es zu glauben?«
»Aber die Friederike hat noch gerade einen Hut erwischt. Sie, Frau Herzogin, den müssen’s sehen!« rief erregt Prinz Phili.
Plötzlich schrien alle durcheinander. Die Damen wiesen mit hastigen Griffen ihre Fächer, ihre Spitzen, ihre Armbänder vor. Percossini versuchte, eifrig plaudernd, gemeinsame Erinnerungen an festliche Tage in der Herzogin wachzurufen. Der Prinzessin farbloser Kopf bekam einen rosa Hauch. Paliojoulai und Tintinovitsch mahnten einander mit männlich zurückgedrängter Wehmut an gewisse Spiellokale, die sie beide kannten, und an die ihnen beiden vertrauten Alkoven gewisser Damen. Der Name Paris elektrisierte ihre in der schweren Luft einer weit entlegenen Provinz ermatteten Herzen. Die Lichtstadt ließ hierher an ein fernes Meer ihren Nimbus leuchten als ein Märchen, als eine Fabelsehnsucht. Sie ward unter diesen östlichen Menschen genannt, und es war, als wenn die Kinder des Westens Geschichten lauschten von Tausend und einer Nacht. Und kaum von einer Pariser Reise heimgekehrt, dachten zur Bezahlung der nächsten diese Damen an ersparte Mittagsessen und nicht erneuerte Unterkleidung, diese Kavaliere an Totalisator und Baccarattische, diese Fürsten an das Volk.
Prinzessin Fatme hob mit der Anstrengung eines Athleten ihr schweres Bein auf einen Stuhl und lud jedermann ein, sich zu überzeugen, daß ihr weicher Lederschuh sich bis dicht unters Knie um die Wade schmiege. »Das ist Paris«, sagte sie andächtig. Um wieder den Boden zu erreichen, hing sie sich voll und lastend um die Schulter des Thronfolgers, der neugierig über sie gebeugt stand. Er entwand sich, halb erstickt, der schönen Frau. Er führte das Taschentuch an die Stirn und murmelte unsicher, mit einem schiefen Blick auf von Hinnerich:
»I mag ka Weib.«
Noch stark angegriffen, schrie er mit gewaltsamer Munterkeit:
»Frau Herzogin, was sagen Sie denn zu unserer Fatme? Ist sie nicht ein lieber Schneck?«
Sie reichte der Türkin die Hand.
»Gnädige Frau, von allen Meinungen, die vorhin geäußert sind, hat mir Ihre am besten gefallen. Sie war echt.«
»Hoheit ist zu freundlich«, erwiderte Fatme mit süßem Kinderlächeln. Phili flüsterte.
»Na, die andern haben schon strohdumm dahergeredet. Hoheit wissen ja: wenn ich könnte … Man erlaubt zur leider nichts, aber mit den andern bin ich nicht im verwechseln, da muß ich schon bitten. Die Friederike schwätzt, was Platz hat …«
Fatme fiel ein.
»Nichts gegen Ihre Gemahlin, königliche Hoheit. Sie ist meine liebe Freundin.«
»Weil ihr beide so liebe Männer habt. Drum hockt ihr immer beisammen und erzählt euch, wie’s euch so wohl ist.«
»Ich möchte den Pascha kennen lernen«, sagte die Herzogin.
»Ich bring’ ihn zu Ihnen, Hoheit. O, er ist stark und energisch«, erklärte Fatme mit Ehrfurcht.
»Ganz den Eindruck hat er mir auch in Ihrer Erzählung gemacht.«
Fatme seufzte.
»Leider ist er mir untreu – gerade wie der da meiner armen Friederike.«
»Da schaut’s die an!« rief Phili. »Habt’s denn ihr euch gegen die bestehende Ordnung der Dinge zu empören? Der Pascha hat seinen Harem, das ist ja recht, und ich hab’ auch meinen Harem.«
»Sie auch, königliche Hoheit?«
»Kann ich denn nicht alle miteinander haben? Die Paliojoulai, die Tintinovitsch, was meinen’s denn? Die Schnaken will mi a! ’s scheniert mich ordentlich, wenn sie’s vor der ganzen Gesellschaft durchblicken lassen. Der Percossini ist auch ein Lump. Immer hat er Mädeln, die er mir anbietet. Ah was …«
Er wandte sich halb ab und sah, das blasse Händchen im dünnen Backenbart, schmollend zu Boden.
»I mag ka Weib.«
Fatme seufzte wieder, in Gedanken verloren.
»Wenn ich ihm nur auch einmal untreu sein könnte.«
»Dem Pascha?« fragte die Herzogin. »Sie lieben doch Ihren Gemahl, gnädige Frau?«
»Eben darum. Er soll’s einmal merken, wie das tut. Aber das ist ja das Unglück, es geht nicht. Was ich hier anstelle, unter den Christen, in Pariser Toiletten, das ist dem Manne ganz gleich.«
»Wirklich?«
»Nur im Harem, da leidet er’s nicht, da darf nichts vorkommen.«
»Ach nein«, meinte Phili, aufs neue angeregt.
»Drum möcht’ ich so gern einen Mann in den Harem bringen.«
»So gern«, wiederholte sie mit gefalteten Händen.
»Ach gehn’s, nehmen’s mi mit«, bat der Prinz.
»Der Pascha hat wohl einen krummen Säbel?« fragte lächelnd die Herzogin.
»Das ist es ja«, bestätigte Fatme, mit weit geöffneten Augen.
Der Thronfolger wollte etwas sagen, schloß aber eilig den Mund. Seine Gemahlin war aus den Tiefen ihres Sessels aufgetaucht, sie glitt lang und lautlos auf die Plaudernden zu. Fatme zog sich mit Phili zurück. Die Prinzessin legte ihre kalte, magere Hand auf den Arm des Gastes, sie begann merklich verlegen.
»Wie befinden Sie sich, meine liebe Herzogin? Ist es hier nicht kalt? Wie mich im Süden friert! Die Zugluft aus den Kaminen! Und dieser steinerne Prunk!«
Sie warf trostlose Blicke über die vergoldete Dutzendeinrichtung für Königsschlösser, die den Raum halbleer ließ.
»Und dann die geistige Öde! Wenn wir über die höchsten Probleme debattieren – Sie dürfen nicht meinen, liebe Herzogin, daß ich mich mit den hohlen Phrasen begnüge, die hier in der Luft schwirren. Verwechseln Sie mich nicht mit meiner Umgebung …«
»Wie könnte ich! Euere königliche Hoheit haben so viel nachgedacht …«
Aber die Prinzessin schien noch nicht erleichtert.
»Wenn das Volk wüßte – wir Großen sind auch nicht immer glücklich«, versetzte sie schleppend, und dann leise, hastig, mit überstürztem Entschluß:
»Sehen Sie meinen armen Mann … Wir beide sind recht sehr zu bedauern. Jeder nutzt seine Schwäche aus, ich glaube Percossini verkauft ihm Kognak. Der Baron ist gar zu industriös veranlagt … Und die Frauen! Alle werfen sich dem Thronfolger an den Hals. In Stockholm ahnte mir nicht, daß es solche Sitten gebe … Er weint manchmal in meinem Schoß und klagt mir – aber was wollen Sie, er ist schwach. Sehr schwach …«
Sie grub ihren starren, blassen Blick in das Gesicht der anderen. Flehentlich, mit versagender Stimme wisperte sie:
»Ich weiß, er stellt Ihnen nach. Bleiben wenigstens Sie kalt und standhaft! Eine anständige Frau … Wie wollte ich Sie achten!«
Der Herzogin blieb keine Zeit zu antworten. Sie spürte noch einmal den Druck von kalten Fingern auf ihrem warmen Arm, dann hatte Friederike sich ihren horchenden Höflingen zugewendet. Phili war sogleich bei der Herzogin.
»Hat sie Ihnen über mich vorgejammert?« flüsterte er. »Natürlich! So ein Kreuz mit der Frau. Kann sie denn gar nicht gemütlich sein? Soll sich doch ein Beispiel an meiner Mama nehmen! Die hat erst neulich dem Papa das lebensgroße Porträt von der Beate geschenkt. Aber meine Mama ist auch nobel, wirklich äußerst nobel, finden Frau Herzogin nicht?«
»Ah! Die Königin hat Seiner Majestät das Porträt seiner Freundin geschenkt!«
Sie sah weg; unvermutet empfand sie es, wie weit sie getrennt war von diesen Menschen und ihrem Seelenleben.
»Sie waren heute abend still, königliche Hoheit?« fragte sie. »Hoffentlich nicht in trüber Stimmung?«
»Was denn sonst! Hier bei meiner Frau bekomme ich ja nur Tee, das ist doch zum Weinen. Wenn ich keinen Kognak habe, Frau Herzogin, dann denk’ ich gleich an meinen unbefriedigten Ehrgeiz, und was für ein verfahrener Karren ich bin. Dann möchte ich meinen weißen Kragen umlegen.«
»Ihren weißen Kragen?«
»Frau Herzogin wissen noch nicht? Meinen Infantenkragen, weiß mit Goldstickerei und Hermelinfutter. Ja, Frau Herzogin, ganz wie der Don Carlos. Ah! Den Don Carlos lieb’ ich wie meinen leiblichen Bruder. Sind wir nicht Brüder? Sein Schicksal ist doch meines. Der unbefriedigte Ehrgeiz, die Pfaffen, alles gerade so. Ich hab’ meinen Hinnerich, er seinen Roderich. Nur mit der Stiefmama hapert’s. Ich will die Beate ja gar nicht; sie will bloß mich … Aber das Infantenkostüm ist wirklich chic, finden nicht, Frau Herzogin? Wenn ich mich Ihnen mal darin zeigen könnte. Da hätt’ ich eine Bitte …«
Er hob sich auf die Fußspitzen und hauchte ihr seine zitternde Sehnsucht ins Gesicht.
»Frau Herzogin, gewähren’s dem Don Carlos den Schlüssel zu Ihrem Kabinett!«
Sie zog den Kopf aus dem Bereiche seines Atems. Sie hatte seine Werbung nicht verstanden und redete gleichgültig den Baron Percossini an, der herzutrat. Der Thronfolger versank in Sinnen.
Der Kammerherr sagte:
»Bei unserm ernsten Meinungsaustausch über die Behandlung des Volkes werden Hoheit sich allerlei gedacht haben. Nicht wahr, jedes Wort schmeckte nach seiner Provinz. Alles so wichtig und so zweifellos. Nun, man tut eben mit … aber heimlich lächelt man, wie in Paris gelächelt wird.«
Er lächelte fein.
»Hoheit werden mich mit meinen hiesigen Freunden nicht verwechseln.«
Sie erwiderte:
»Natürlich nicht. Und sagen Sie bitte auch den Herren Paliojoulai und Tintinovitsch, sowie den Damen dieser Herren, daß ich sie mit niemand verwechsele.«
Darauf verabschiedete sie sich von der Prinzessin. Phili wollte hinter ihr aus der Tür schlüpfen, doch ein schwerer Blick seines Adjutanten lähmte ihm den Fuß.
Die Herzogin war kaum draußen, als die eben verlassenen Gesichter ihr entfielen, wie zurückgetaucht in einen dicken Nebel von Langeweile und Beschränktheit. Sie erinnerte sich, müde und verstimmt, einiger unbestimmt lungernder Gestalten, zwischen denen Lakaien umherschlichen mit Teetassen und Bonbons. Während der folgenden Tage dachte sie mit Vergnügen an Pavic: seine Worte kehrten ihr ins Ohr zurück, sie klangen fast bedeutend. Sie schrieb ihm.
· · ·
Er stellte sich sogleich ein, im strenggeschnittenen Salonrock. Sein Schlapphut war draußen geblieben. Sie meinte: »Er könnte ein Staatsmann sein.«
»Sie haben schon einmal im Kerker gesessen«, sagte sie. »Das können Sie leicht wieder erleben. Man will Ihnen gar nicht wohl.«
Er beschrieb, während er sich setzte, eine wuchtige Gebärde, alles zermalmend unter einer Last von Verachtung.
»Nein, kein Staatsmann«, überlegte die Herzogin. »Aber beinahe ein Künstler.«
Pavic versetzte:
»Hoheit, in der Gefahr bin ich am stärksten. Bevor damals die Schergen Hand an mich legten, lebte ich in einem Rausch von Kraftgefühl. Ich redete täglich mindestens zweimal zum Volke, ich wies keinen der Mühseligen und Beladenen von meiner Schwelle – und dennoch hatte ich gerade damals meine todkranke Frau zu pflegen. Ich kann sagen, Hoheit, von Dolchen umzückt, habe ich mein Weib beweint.«
Er machte einige feste Schritte; es ward ihm schwer, stille zu sitzen. Sein Organ mäßigte sich in der intimen Umgebung. Draußen tönte es weit ins Land hinein, hier schmiegte es sich behutsam in Stofftapeten und verlor sich in schattigen Winkeln. Nur seine Bewegungen blieben groß, als würden sie am Meeresstrande, in weiten Ebenen vollführt und sollten von den hintersten der zehntausend Zuschauer erkannt werden:
»Ihre Frau ist gestorben?«
»Von ihrer Leiche rissen sie mich fort. Ich las in der Bibel. Denn …«
Er nahm Platz.
»Denn ich pflege in der Bibel zu lesen.«
»Warum eigentlich?«
Er sah sie an, tief erstaunt; er stotterte:
»Warum … Warum … Nun … es beglückt mich … und es hilft, Hoheit, es hilft. Wie oft habe ich in Gefahren gebetet, bei Wanderungen durch die Felsschlünde des Velebit und über seine steilen Mauern. Noch ganz kürzlich, während einer Überfahrt mit dem Baron Rustschuk. Wir fuhren in Geschäften, es war der wütende Nordwind: Hoheit erinnern sich. Unser Boot wollte umschlagen, eine übermächtige Woge rollte auf uns zu. Ich sah sie nicht an, ich sah zum Himmel auf. Die Welle überschlug sich, dicht bevor sie uns erreicht hatte. Ich wandte mich nach dem Juden um, er war fahl. Ich sagte nur: ich habe gebetet.«
Sie betrachtete ihn.
»Von Ihnen, Herr Doktor, erfahre ich lauter neue Dinge. – Und lauter Dinge, die ich Ihnen nicht zugetraut hätte.«
Er lächelte schmerzlich:
»Nicht wahr? Der Revolutionär darf kein Herz, der Tribun kaum ein Privatleben haben? Ich aber bin der fromme Sohn armer Leute, ich liebe mein Kind und spreche mit ihm das Nachtgebet. Das Gemütsleben meines Volkes, Hoheit, das ist’s, was sie niemals verstehen werden, die Fremden, die unter uns wohnen.«
»Schon wieder die Fremden. Sagen Sie, war Pierluigi von Assy, der Proveditor der Republik Venedig, in diesem Lande ein Fremder?«
Er stutzte, er erkannte seinen Fehler.
»Ich bin weder Italienerin noch Morlakin. Ihr Volk interessiert mich nicht, lieber Doktor.«
»Aber … Die Liebe eines ganzen Volkes! Hoheit, Sie wissen nicht, was das bedeutet. Sehen Sie mich an, um mich spinnt sich ein gutes Stück Romantik.«
»Das sagten Sie schon einmal … Wofür ich mich erwärmen könnte, das wäre der Gedanke, in diesem Lande die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Aufklärung, den Wohlstand einzuführen.«
Sie machte lange Pausen zwischen diesen vier Worten. Diese vier Begriffe schienen, während sie redete, in ihr zu entstehen, zum erstenmal in ihrem Leben. Sie setzte hinzu:
»Das ist meine Idee. Ihr Volk ist mir, wie gesagt, gleichgültig.«
Pavic war wortlos.
»Hier herrscht eine Clique von kleinen Leuten«, sagte die Herzogin, »Provinzadeligen, die in Paris lächerlich wären. Bei Hofe begegnen sich Halbwilde mit bürgerlichen Pendanten und überbieten sich an Roheit. Es ist ein unerquicklicher Anblick, darum möchte ich’s abschaffen.«
Sie sprach immer entschiedener. Plötzlich ordneten sich in ihrem Geiste eine Menge Einfälle, und einer zog den andern nach sich.
»Was tut der König? Man sagt mir, er gibt Almosen. Im Kreise der Prinzessin ist viel die Rede von Suppen und wollenen Westen, was ich zu billig finde. Übrigens ist ein König fast überflüssig – oder wird überflüssig werden. Ein freies Volk (sehen Sie nach Frankreich!) gehorcht sich selbst. Selbst Gesetze – ich weiß nicht, ob sie notwendig sind, aber sie sind verächtlich.«
Pavic sagte ganz erstarrt:
»Hoheit sind Anarchistin.«
»Ungefähr. Meinetwegen soll jemand da sein, der über der Freiheit wacht. Nur deswegen also ein König.«
Er atmete tief auf vor Genugtuung, denn er meinte, er habe ihre Menschlichkeit entdeckt.
»Oder eine Königin.« versetzte er bedeutsam.
Sie wiederholte, die Schultern hebend:
»Oder eine Königin.«
Dann stand sie auf.
»Kommen Sie wieder, Herr Doktor. Wir haben uns noch mehr zu sagen.«
»Hoheit, ein Befehl von Ihnen genügt zu jeder Stunde, mich herzuführen.«
»Durchaus nicht. Sie haben zu arbeiten, ich sitze untätig. Kommen Sie, sobald Sie Zeit haben.«
Er ward von einer freudigen Regung erfaßt. Das Gefühl, gewürdigt zu werden, machte ihm Mut zu einem langen, dankbaren Handkuß. Und er entfernte sich, wie auf Wolken getragen von dem Bewußtsein, er habe mit den Lippen das Fleisch der Herzogin von Assy berührt.
Sie erfuhr von Pavic, daß ihre Pläne viel Geld kosten würden, und erstaunte darüber.
»Es wird eine unerhörte Agitation nötig sein und klingende Ermunterungen nach allen Seiten.«
»Das muß eine neue Eigentümlichkeit des Volkes sein. Dafür, daß man ihm Freiheit, Gerechtigkeit, Aufklärung, Wohlstand gibt, verlangt es auch noch Trinkgeld.«
Der Tribun senkte den Kopf.
»Aber ich habe nichts dagegen«, erklärte die Herzogin.
Darauf schlug er ihr für alle finanziellen Operationen den Baron Rustschuk vor.
»Dieser Rustschuk ist bereits in sämtlichen Donaustaaten verkracht und in Wien, wo es ihm ebenso erging, auf geradezu glänzende Weise freigesprochen. Jetzt schätzt man ihn auf zehn Millionen.«
Die Herzogin machte eine Bewegung. Pavic besann sich; die Bewunderung des Advokaten für den erfolgreichen Financier wurde rasch unterdrückt durch die sittliche Mißbilligung, die er bei dem Volksmanne erregte.
»Ich lasse Sie, Hoheit, über die Moralität des Rustschuk nicht im Zweifel. Nur ungern bringe ich unsere Sache, die heilige Sache meines Volkes in Berührung mit dieser anrüchigen Persönlichkeit. Ich mache mir schwere Gewissensbisse … indessen …«
»Warum denn. Er scheint fähig zu sein.«
»Fähig und gefährlich. Zur Zeit hält er sich ruhig, aber ich, der ich geschäftlich mit ihm zu tun habe, weiß, welcher Ehrgeiz an ihm zehrt. Er will Minister werden, Minister in einem der Länder des europäischen Asiens, wo er in contumaciam verurteilt wurde: sie sollen sich vor seinem Glanze beugen. Wenn Hoheit mich ermächtigen wollen, ihm inzwischen einen Ministerposten hier in diesem Lande anzubieten … Er ist ja allerdings ein höchst verwerflicher Charakter …«
»Was macht das?« so entschied sie. »Wenn er uns nur nützen kann. Die ihn verurteilt haben, sind natürlich nicht besser als er. Wen sollte man schließlich verwenden?«
Sie ließ ihn sich vorstellen. Rustschuk war ein unendlich eleganter Herr mit stark gerötetem, aufgeblättertem Gesicht, dick bedeckt von wolligem schwarzen Haar. In seiner schön gemusterten Hose schüttelte ein weicher Bauch hin und her, und seine dünnen Arme zerteilten behende und eckig die Luft. Er begann, sobald er der Herzogin gegenüber saß, vom Jammer des armen Volkes zu reden, und von glücklichen Ländern unter weisen und schönen Königinnen, und er duftete dabei nach Moschus. Als sie nichts erwiderte, rieb er sich die Hände und ließ merken, daß sie mit Kölnischem Wasser gewaschen waren. Sodann öffnete er sein Schnupftuch; es war, als habe er einen Veilchenstrauß aus der Tasche gezogen. Er klopfte sich auf die Weste und schwenkte den Bauch wie ein Räucherfaß: es entstieg ihm eine Patchouliwolke.
»Gefährlich?« dachte sie. »Er ist ja grotesk.«
Um durch eine schnelle Laune ihr Glück zu erproben, betraute sie ihn auf der Stelle mit der obersten Aufsicht über die Verwaltung aller ihrer Besitzungen, der weiten, über ganz Dalmatien sich erstreckenden Domänen des verstorbenen Herzogs, der Inseln Busi, Lissa, Curzola mit ihren wertvollen Fischereirechten. Und an die Spitze dieses ungeheuren Vermögens getreten, gewann Rustschuk sofort an Sicherheit. Beim Fortgehen sagte er, freundlich belehrend:
»Das Geld muß also immer mehr werden und uns immer mehr Freunde machen.«
· · ·
Bevor das Jahr zu Ende ging, hörte man von einer bedeutenden Zunahme des Räuberwesens. Die Malviventi waren in größerer Anzahl als sonst von den Bergen gestiegen. Den Italienern wurden die Ernten angezündet und die Ölbäume gefällt. Wenn ihre Weinbeeren noch klein und hart waren, fanden sie eines Tages alle Reben zerschnitten. Im Winter 72 brachen zwei Regimenter Landesschützen von Zara nach Süden auf: in den Bocche, zwischen den Klippen und auf den Felseninseln kämpften die aufständischen Slaven für die Freiheit, die eine unbekannte Frau ihnen versprach, eine ferne, nie erblickte Königin, von der sie träumten, über die sie betrunken in den Wirtshäusern einander vorlogen, und an die sie ihre klagenden Gebete richteten. Auf der Straße fühlte die Herzogin, wie gespannte, ernst gewordene Blicke zu ihr in den Wagen drangen. Unter ihren Fenstern vernahm sie häufig schlürfende Tritte. Es waren die Bundschuhe von acht oder zehn mageren, braunen Kerlen, die die Hände in den Ziegenfellhosen, scheu und gebannt an ihren Säulen hinaufstarrten.
· · ·
Eines Tages verkündete Pavic mit feierlicher Miene die Ankunft des Marchese di San Bacco. Einen Augenblick klopfte ihr Herz stärker; denn wo immer in der Welt der alte Sturmvogel erschien, da drohte ein Aufstand, eine Umwälzung, ein politisches Abenteuer. Er hatte seine Begeisterung und seine Faust den Griechen geliehen, den Polen und den Unabhängigkeitskämpfern Südamerikas, der französischen Kommune, Jungrußland und der italienischen Einheit. »Freiheit« war das Stichwort, auf das er losbrach, so oft es erscholl. Er hatte es als Knabe vernommen und war der Familie entlaufen, für das junge Italien eingekerkert und über Gefängnismauern nach Amerika entkommen, zu Garibaldi, seinem Helden. Er hatte als Korsar die kaiserlich brasilianischen Schiffe geplündert und als Diktator über exotische Republiken geherrscht, er hatte von raffinierten Barbaren lächerliche Torturen erduldet, in den Lagunen von Riesenflüssen ein vogelfreies Brigantenleben geführt, Kühe geraubt und Reiche herausgefordert: alles im Namen der Freiheit. In Italien, wohin er seinem Meister folgte, bewahrte noch jeder Fußbreit Landes die Spuren des Ringenden. Um sie für den Samen der Freiheit zu pflügen, hatte er jede Scholle seiner Heimaterde mit seinem Schwerte umgewendet.
Jetzt, mit fünfzig Jahren, focht er in der Kammer zu Rom, hitzig und gebieterisch, für den Willen des roten Generals. Er war schlank und spannkräftig, mit großen türkisblauen Augen. Das rote Kinnbärtchen tanzte bei allen Grimassen der ungeduldigen Lippen, das Haar wirbelte schlohweiß über der schmalen Stirn in die Höhe.
Er lud sich bei der Herzogin zu Gaste; die Hotels paßten ihm nicht, sagte er. Er war sehr arm, denn er hatte die Freiheit des Menschengeschlechtes ebensogut mit seinem Vermögen bezahlt wie mit seiner Jugend.
Sofort begann er, Pavic auf seinen Agitationsfahrten über Land zu begleiten. Er gebrauchte größere Worte als der Tribun, schrie noch lauter, schäumte, warf die Glieder, reizte zum Aufruhr, veranlaßte Prügeleien und wanderte, nach einem Widerstande auf Tod und Leben, zwischen zwei Dorfpolizisten auf irgend einen Gendarmerieposten, wo er mit verächtlich gekrümmten Lippen seinen Namen hinwarf: Marquis von San Bacco, Oberst der italienischen Armee, Commendatore des Ordens der Krone von Italien, Abgeordneter zum Parlament in Rom. Ein Telegramm aus Zara befreite ihn. Er kehrte heim und stieß, vor der Herzogin rastlos hin und her schreitend, mit hoher gequetschter Kommandostimme zerhackte Reden aus:
»Es lebe das freie Wort! … Worte sollen locker sitzen wie Schwerter! … Feige sind stumm! … Tyrannen und verbundene Mäuler!«
Allmählich beruhigte er sich, und immer auf den Beinen, mit dem Rücken am Kamin, erzählte er friedlich und mit maßvollen Gesten die Eroberung einer großen brasilianischen Sumaca. Es verstand sich, daß er gegen die Passagiere und besonders gegen die Frauen die ritterlichste Haltung beobachtet hatte. Unglücklicherweise hatte man ihn festgehalten, als er in der Stadt den erbeuteten Kaffee verkaufen wollte. Er wurde halbnackt vor den Gouverneur geführt. »Ich spie dem Elenden ins Gesicht, und er ließ mich mit den Händen an ein schwebendes Seil binden, woran ich zwei Stunden lang hängen blieb.«
Nach drei Wochen reiste er ab, und die Herzogin verlor ihn ungern.
· · ·
Pavic unterrichtete sie im Morlakischen, er las ihr Lieder von bunten Hirschkälbern und von der goldhaarigen Sosa, von Haiduken, von Berggeistern auf umbrandeten Klippen und von Müttern, weinend unter Orangenbäumen. Diese unklare, weich schwärmende Poesie, die sie halb verstand, und in die er sie einwickelte Tag für Tag, betäubte ihre ruhige Vernunft; die slavischen Wörter, von seinem Organ zärtlich gewiegt und verführerisch dargeboten, erregten und ermatteten sie. Sie fühlte sich wie im warmen Bade, wo eine Frau unter erhitzten Locken aus müden Augen den Perlen zublinzelt, die im Wasser aufsteigen. Pavic ward immer feuriger, je stiller er sie sah. Er pries stürmisch sein Volk und starrte entzückten Blicks in das schöne Gesicht der Dame auf den Kissen neben ihm. Er küßte ihre Hand, er berührte ihr Kleid, ihr Haar sogar, und es war immer noch, als liebkoste er sein Volk.
Sie sah ihn in der Ehrlichkeit seines Herzens erröten, zittern, verstummen. Dabei gedachte sie der Geständnisse, die sie in Wien und in Paris empfangen hatte, all des Flehens und Drohens, das in ihrem Schoß erstickt und von ihrem Panzer abgeprallt war – und sie fand Pavic weniger lächerlich als die andern. »Was konnte ich jenen geben? Sie wußten es selbst nicht, die Narren. Dieser hier verlangt etwas von mir: ich soll ihm helfen seine Feinde zu besiegen.«
Anfangs brachte er seinen Knaben mit. Das kränkliche, unschöne Wesen saß, von der Herzogin niemals beachtet, in einem Winkel. Eines Tages kam Pavic ohne das Kind.
Im Vorfrühling, an einem Kirchenfeste, fuhr sie mit ihm nach Benkowatz. Vom Meere her brauste die bittere, aufstachelnde Luft über baumlose Steinfelder. Goldene Lichter warfen sich aus jagenden Wolken in das erwartungsvolle Land, jäh entzündet und gleich wieder erloschen. Im Dorfe bewegte sich ihr Gefährt mühsam über vorspringende Felskanten. Die kotigen Höfe lagen verödet zwischen ihren mit Dornen bepflanzten Mauern.
Die Bauern warteten beim Wirtshause. Pavic sprang sofort auf einen Tisch, sie drängten sich um ihn, bunt und faul glotzend.
Pavic redete. Nach der Stille seiner ersten Sätze schlug ganz vorn sich einer klatschend aufs Knie. Hinten brach ein erfreutes Feixen los. Einige Morlaken ließen den frostig zusammengerafften Mantel im Winde flattern und griffen mit den Händen durch die Luft. Kroaten mit Gemüsekarren blieben neugierig stehen. Es traten mit feindlichen Mienen zwei Sicherheitswachen herzu, rot angezogene Kerle, ganz mit Silbertalern behangen, und stellten die Gewehre hart auf den Boden. Die Herzogin blickte hinter der Gardine hervor aus dem geöffneten Wagenfenster.
Pavic redete. Ein Esel riß sich los, stieß einige Leute um und rannte gegen den Tisch des Tribunen. Pavic verglich ihn, ohne sich zu besinnen, mit allen seinen Widersachern. »Steht fest wie ich!« Er drohte und fluchte mit gesträubtem Bart und gerungenen Fingern, er segnete und verhieß mit einem Angesicht, von dem beseligendes Licht troff. Ein unsicheres Gemurmel ging durch die Hörer, die starren Augen fingen zu glänzen an. Zerlumpte Schafhirten gaben ungeformte Laute von sich. Drei Viehhändler in geblümten Turbanen rasselten mit Pistolen und Dolchen. Pavic senkte sich, mit wild ausgreifenden Armen, so tief nach vorn ins Leere, als wolle er über die Versammlung hinwegfliegen. Gleich darauf schwebte er, leicht und federnd, am jenseitigen Rande des Tisches. Sein lechzender Blick und alle seine Glieder schmiegten sich um das bezwungene Volk: jeder einzelne fühlte mit angehaltenem Atem seine Umschlingung. Wohin er sich wendete, dahin taumelten die weich gewordenen, willenlosen Leiber all dieser Geschöpfe. Sie lächelten weinerlich.
Pavic redete. Er stand in einem Qualm von Seelen. Die Sicherheitswachen hielten die Gewehre nur noch in lässigen Händen, sie hingen mit entwaffneten, dümmlichen Mienen an des Tribunen Atemzügen. Die Dynastie Koburg hatte zwei Stützen weniger. Plötzlich breitete er die Arme aus, den Kopf im Nacken. Sein breiter Bart stand rotbesonnt, keilförmig in die Luft. Die Augen sanken ein unter den gequälten Lidern und erloschen, in einem letzten Krampf zuckten die grauen Lippen. Er war Christus. Weiber schlugen das Kreuz, packten sich bei der Brust und heulten lange Klagetöne. Verwünschungen und Beschwörungen grollten tief. Die Herzogin sah ihm zu wie einem Spiel, einem Aufwallen und einem Sturz von Elementen, ohne Urteil und ohne einen Vorbehalt ihres Geistes dem Schauspiel des Mannes hingegeben. Mit ihm atmete, stöhnte, sehnte sich, röchelte, schrie und verschied die ganze Natur.
Unversehens war er am Wagenschlag. Er sprang hinein, sie fuhren im Galopp davon. Der wütende Aufschrei der Menge vergellte hinter ihnen. Sie ließen die Wagendecke herab und hielten die Gesichter dem Wind und der Sonne hin. Die Herzogin schwieg mit ernsten Augen, Pavic schnaufte. Vor und hinter ihnen rollte durch das Steinland der blendende Fluß der Landstraße. Von einer ihrer Erhöhungen sahen sie fern einen blinkenden Streifen: das Meer.
Da sprang aus einem Schutthaufen etwas heraus, etwas Zerlumptes, Tolles, wovor die Pferde scheuten. Es war ein Weib in grauen Zottellocken, sie schwenkte mit der Hand einen langen Haarschopf, daran flog im Kreise ein Totenkopf. Sie kreischte etwas Unverständliches, immer dasselbe, und klammerte sich an die Wagenräder. Pavic rief hinaus.
»Bist du schon wieder da! Ich kann dir nicht helfen, so geh’ doch und werde vernünftig!«
Die Herzogin ließ halten.
»Was schreit sie? Heißt es nicht ›Gerechtigkeit‹?« Die Alte war mit einem Satze bei ihr, sie hob ihr den Schädel dicht vors Gesicht.
»Hoheit, es ist eine Närrin!« murmelte Pavic. Das Weib zeterte:
»Gerechtigkeit! Sieh, das ist er, das ist Lazika, mein Söhnchen. Sie haben ihn ermordet und leben noch! Mütterchen, ich liebe dich, hilf mir doch zu meiner Rache!«
»Schweige endlich!« befahl Pavic. »Es ist dreißig Jahre her, und sie haben Zwangsarbeit getan.«
»Aber sie leben!« heulte die Mutter. »Dürfen sie leben, und er ist gemordet! Gerechtigkeit!«
Die Herzogin starrte den gebleichten Kopf an. Pavic bat:
»Hoheit, gestatten Sie mir, den Auftritt zu beenden.«
Er winkte, die Pferde zogen an. Das Kleid der Alten verfing sich in den Speichen, sie fiel um. Ein scheußliches Knirschen entstand: das Rad war über den Schädel gegangen. Sie waren schon weit; dahinten wälzte sich mit Wimmern im weißen Staube ein Haufen Lumpen über den Splittern vom Haupte des Sohnes. Die Herzogin lenkte erblaßt den Blick weg.
»Dreißig Jahre«, sagte Pavic, »und noch immer rachedürstend! Wir sind Christen, wir verlangen nach Gnade.«
Die Herzogin erwiderte:
»Nicht Gnade. Ich bin für Gerechtigkeit.«
Sie sprach nichts weiter. Sie versuchte darüber zu lächeln, wie heute alles so tragisch erscheinen wollte, doch beängstigte sie diese Stunde, die schwanger aussah von Fremdartigem. Sie mochte sich nicht umsehen nach dem Manne neben ihr.
Pavic dachte zurück an den armen Studenten, der zu Padua scheu und gedrückt, als Angehöriger der unterworfenen Rasse umhergegangen war. »Jetzt halte ich euch!« so frohlockte er. »Denn für mich habe ich die Herzogin von Assy.« Er dachte an den wunden Ehrgeiz des kleinen Advokaten, dem man zuweilen einige kühne Worte erlaubte. Dann zogen die Gewalten das Seil an; er hungerte, er saß im Kerker, er hörte seine Drohungen verlachen. Heute lag das Atlasfutter seines schwarzen Havelocks über einem in Wien gefertigten Salonrock. Wo er vorbeikam, ward man tiefernst, denn er lehnte im Wagen der Herzogin von Assy. Was war in diesem Augenblick noch unmöglich? Ah! Schon manche Frauen, auch schöne, auch reiche, waren, von seiner Rede im Blute aufgepeitscht, zu ihm geschlichen, bettelnd um das Almosen einer Umarmung. Es ward ihm plötzlich sehr heiß in den Augen, er meinte die Besinnung zu verlieren und sprach es sich zum ersten Male aus, er begehre die Herzogin von Assy.
Den ganzen Weg entlang ruhte Pavic im Gefühl seiner seltenen, romantischen Persönlichkeit. Er bebte und schmolz darin.
Bei ihrer Ankunft gingen sie sogleich zu Tische. Nach der geleisteten schweren Lungen- und Muskelarbeit aß und trank der Volkstribun stark. Die Herzogin sah in die Kerzen. Später, in ihrem Zimmer, kam er, satt und sanguinisch, auf den Triumph des Tages zurück. Er wiederholte ihr einzelne Glanzstellen, und die Huldigungen, die ihnen gefolgt waren, rauschten ihr wieder im Ohr. Sie sah ihn aufs neue, ragend groß in furchtbarer Stellung von jagenden Wolken abgehoben, ein Held, gegen den sie keinen Einwand wußte, ein Held, staunenswert und übermächtig. Nun jubelte und befahl er zu ihren Füßen: seine stolzen Freiheitsrufe stiegen zu ihr herauf aus seinen feuchten, roten, verlangenden Lippen.
Und endlich, zwischen zwei Liebeserklärungen an sein Volk, bemächtigte er sich ihrer. Das Sofa, auf dem es geschah, trug mitten über seiner Lehne eine große goldene Herzogskrone. In den Sekunden seiner Seligkeit hafteten Pavic’ Gedanken unverwandt an dieser Herzogskrone.
Gleich darauf packte ihn namenloses Staunen über das, was er gewagt hatte. Er stammelte:
»Dank, Hoheit, Dank, Violante!«
Und sich selbst rührend, immer inniger:
»Dank, Dank, Violante, daß du das für mich tatest! Herrliche, gütige Violante!«
Aber ihr Blick floh, von blauen Schatten umzogen, teilnahmslos an ihm vorbei. Ihr Haar war in Unordnung geraten; es hing in starren, dunkeln Wellen um das erschreckend bleiche Gesicht. Sie stützte sich mit hart gestreckten Armen auf den Polsterrand. Ihre spitzen Finger zerrissen den gewirkten Stoff. Pavic wand sich in Angst und Reue: »Was habe ich getan?« schrie er sich selbst zu. »Ich bin nur ein Vieh! Jetzt ist alles verloren!« Er verdoppelte seine Anstrengungen:
»Verzeih’ mir, Violante, verzeih’! Ich bin ja nicht schuldig, es ist das Schicksal … Jawohl, das Schicksal, das mich dir zu Füßen warf. Ich soll dir dienen … Wie will ich dir dienen! Violante! Ich will den Staub von deinem Saume küssen und sterbend den Kopf unter deine Absätze legen, Violante!«
Er rang, berauscht von den eigenen Worten, um einen ihrer Blicke. Sie strich sich, nach langen Minuten, mit zwei Fingern über die Stirn und sagte:
»Lassen Sie mich, ich möchte allein sein.«
»Du verzeihst mir nicht? O Violante, sei gnädig!«
Sie zuckte die Achseln. Er flehte mit Tränen in der Stimme:
»Nur ein Wort, daß du mich nicht verdammst! Violante! Du verdammst mich nicht?«
»Nein, nein.«
Sie wendete, unfähig den Auftritt länger auszuhalten, den Hals hin und her.
»Gehen Sie jetzt.«
Er ging endlich, mit schwerem Tritt, weichen Gliedern, aufgelöst in Gefühl und immerfort murmelnd:
»Dank … Verzeih’ … Verzeih’ … Dank.«
· · ·
Sie begab sich sogleich in ihr Schlafzimmer. Sie schickte die Kammerfrau hinaus und begann selbst sich zu entkleiden. Nach dem Erlebten war jede Berührung mit einer menschlichen Haut ihr widerlich. Aber ihre Hände waren schlaff; sie verlor sich immer wieder in Gedanken. Ihre Verwunderung war so mächtig wie seine, doch ganz unvermischt mit Genugtuung.
Also das war alles? Das war alles, was sie hatte erfahren sollen? »Ich wollte lieber, ich hätte es nicht erfahren … Übrigens ist es zum Lachen.« Sie wollte den Mund verziehen, aber in die Kehle stieg ihr eine Übelkeit. Dann fiel ihr ein, daß Pavic sie immerfort Violante genannt hatte. Wie kam er dazu? Bildete er sich auf das Geschehene etwas ein? Solch’ ein untergeordneter Vorgang, gab er denn ein Recht zu Zärtlichkeiten der Rede und zu seelischem Nahekommen?
Sie zerrte an ihren widerspenstigen Hüllen, sie warf, was ihr in den Händen blieb, auf einen Haufen von Musselin und Seidenstoffen, am Fußende ihres Bettes von flüchtigen Dienerinnen zurückgelassen. Plötzlich entstand darunter eine Bewegung. Die Herzogin ging rasch darauf zu. Es raffte sich etwas daraus hervor, eine kleine abenteuerliche Gestalt, die mit ihrem Degen in den Tüchern hängen blieb. Schließlich stand vor ihr Prinz Phili, in Tricots, Barett und blauem Atlaswams, mit dicken, goldenen Blumen auf dem weißen, hermelingefütterten Kragen. Er hatte große Furcht.
»Da bin i schon«, flüsterte er.
Ihre nervöse Überreiztheit entlud sich:
»Wie kommen Sie hierher? Trachten Sie doch gleich wieder zu verschwinden!«
»Sie nehmen es also doch übel?« fragte er. »Der Percossini hat mir ja auch gesagt, Sie würden’s übel nehmen, aber konnte ich denn anders? Warum haben’s mich nie vorgelassen. Frau Herzogin, und meine Frau haben’s auch nicht mehr besucht, Sie Schlimme.«
»Entfernen Sie sich! Ich lasse die Prinzessin benachrichtigen.«
Phili war bestürzt.
»Verzeihung, o bitte! Der Percossini hat gemeint, Sie würden nichts sagen … Das wenn ich gewußt hätt’!«
»Hinaus!«
»Erst verzeihen’s mir, Frau Herzogin. Verzeihung, o bitte!«
Sie warf den Kopf in den Nacken. Sollte dasselbe Spiel von vorne anfangen? Sie trat auf den Thronfolger zu und faßte ihn hart um beide Handgelenke.
»Ich werde Sie in meinem Wagen nach Hause fahren lassen, mit einem Billet an Ihre Frau. Hören Sie?«
Der warme Duft ihres geöffneten Corsage machte Phili schwach. Er knickte, fahl, ins Knie und hing nur noch an ihren Händen. Er bettelte:
»Sein’s doch nit so bös, liebste Herzogin, Sie wußten doch, ich wollt’ Sie schon längst besuchen als Don Carlos. Aber die Weiber haben mi nimmer ausgelassen. I war schon ganz hin und hab mir gedacht: Jetzt wenn du zu ihr gehst, fallst am End’ ab, und aus is. Neuerdings bin i wieder stramm, und da werd’ i außig’lahnt …«
Sie drängte ihn zur Tür. Kaum losgelassen, fiel er weich hin, wie eine Gliederpuppe. Er erhob die Händchen, laut weinend:
»Sehen’s denn nicht, daß ich ein armer Teufel bin! Auf den Thronen, Frau Herzogin kennen doch das, da geht’s auch nicht heiter zu. Mich haben’s die letzte Zeit so arg hergenommen – und immer hab’ ich an Sie gedacht wie an unsere liebe Frau. Wenn Sie mich nicht wollen, dann stirb ich, ich hab’ schon so trübe Ahnungen. Gewähren’s mir … das …«
Sie setzte sich auf den Bettrand. Ihre Kraft war erschöpft; sie empfand in dem, was sie erlebte, nichts Widerwärtiges mehr und kaum noch etwas Lächerliches. Aus Gier nach der tierischen Berührung mit ihrem Fleische hatten in Paris die kalten, feinen Kavaliere sich selbst und einander umgebracht. Es war natürlich, daß das dürftige Geschöpf dort am Boden daran starb. Aber lohnte es sich der Mühe, sein Gejammer länger anzuhören? Um was er bat, das war so nichtig … Vor Müdigkeit, vor Überdruß und vor unsäglicher Verachtung dachte sie beinahe daran, es ihm zu gewähren. Da erschien ihr das weißliche Antlitz Friederikens von Schweden, flehend mit versagender Stimme.
Der Prinz hatte seine Tränen abgewischt und sich erhoben. Sie fragte jetzt ganz gleichmütig:
»Werden Sie gehen, königliche Hoheit?«
»Ich geh’ schon.«
Er nickte traurig.
»Frau Herzogin wollen also wirklich nicht?«
Sie nahm die Klingelschnur in die Hand.
»Geh’ ja schon«, murmelte Phili. »Daß nur am End’ zwischen uns kein fâché draus wird.«
Und er verschwand.
In den Morgenstunden schlummerte sie. Des Thronfolgers erinnerte sie sich darauf kaum noch. Tagelang beschäftigte sie sich nicht mit Pavic. Dagegen machte sie eine Menge alter Erlebnisse noch einmal durch. Gespräche, einst in Paris oder Wien geführt, vernahm sie wieder vom ersten bis zum letzten Wort: nun hatten alle eine unerwartete Bedeutung bekommen. Die Personen standen aufs neue vor ihr. Das waren ja Liebhaber … und das auch. Und jener dort ein betrogener Gatte. Damals hatte sie lächelnd wie im Traume dies alles mit angesehen. Der Schlüssel zu jenen wertvollen Träumen war ihr erst jetzt zufällig in die Hände gefallen. Nun öffnete sie einen jeden. Sie ging höchst belustigt umher und ließ aus den Winkeln ihres Gedächtnisses einen vergessenen Scherz nach dem andern hervorsteigen und verstand sie plötzlich alle. Wie ein um Jahre verspätetes Echo hallte ihr einsames Lachen durch die Säle.