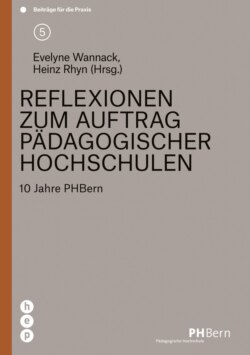Читать книгу Reflexionen zum Auftrag pädagogischer Hochschulen - Heinz Rhyn - Страница 7
2.3Frühe Reform – und Korrekturnotwendigkeiten
ОглавлениеSo schnell, wie sich dies der Motionär vorgestellt hatte, sollte die Reform aber nicht realisiert werden. Denn einerseits sollten für eine Gesamtkonzeption zunächst die notwendigen Grundlagen erarbeitet werden. Dazu fanden umfassende Abklärungen statt, unter anderem zum Tätigkeitsfeld der Lehrerinnen und Lehrer (Berufs-/Amtsauftrag), zu den notwendigen Fähigkeiten für den Lehrberuf, zur Gliederung in unter-schiedliche Lehrkategorien, zum Verhältnis von Grundausbildung, Berufseinführung und Weiterbildung, zu den notwendigen Rechtsgrundlagen oder zu Standorten und Kostenfolgen (Erziehungsdirektion 1986; Thomet 1988). Die Projektarbeiten unter der Leitung von Ulrich Thomet wurden breit abgestützt, verschiedene Anspruchsgruppen wurden in die Abklärungen einbezogen und es wurden verschiedene Tagungen, Vorstudien und Befragungen durchgeführt. Andererseits wurde das Projekt im Verlaufe der 1980er-Jahre in das umfassende Projekt der «Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung» integriert (Erziehungsdirektion, 1982). Der Grosse Rat beauftragte die Regierung 1985 in diesem Rahmen, spätestens Ende der Legislatur 1986/1990 Bericht und Antrag zur «Gesamtkonzeption Lehrerbildung» vorzulegen (Grossratsbeschluss Gesamtrevision 1985).
Im Legiferierungsprozess, der nun folgte und in dem die institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der neuen Lehrerinnen- und Lehrerbildung festgelegt wurden, können grob drei Phasen unterschieden werden: erstens die Verabschiedung der Grundsätze im Grossen Rat des Kantons Bern 1990, mit denen die wesentlichen Eckwerte der neuen Lehrerinnen- und Lehrerbildung definiert wurden; zweitens die Verabschiedung des Gesetzes über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung von 1995 als Grundlage für die Angliederung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an die Universität Bern sowie drittens das Gesetz über die Pädagogische Hochschule von 2004, mit dem eine autonome Pädagogische Hochschule geschaffen wurde.
Erste normative Festlegungen für eine neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Bern erfolgten deshalb bereits 1990, als der Grosse Rat Grundsätze zur «Gesamtkonzeption der Lehrerbildung» (Grossratsbeschluss GKL 1990) beschloss – also noch bevor auf interkantonaler Ebene die Reformdiskussionen überhaupt flächendeckend initiiert worden waren. Die Eckwerte für die Neuorganisation der Volksschullehrerausbildung präsentierten sich nach diesem Grossratsbeschluss vom 14. August 199013 wie folgt (vgl. auch Criblez & Reusser 2001; Weniger 2012, 2016/im Druck):
—Die Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer sollte im tertiären Bildungsbereich erfolgen, also einen Ausbildungsabschluss auf der Sekundarstufe II voraussetzen, wobei auch Abschlüsse der Berufsbildung als Vorbildung anerkannt werden sollten.
—Die Grundausbildung sollte unterteilt werden in einen allgemeinen, stufen- und typenübergreifenden sowie einen stufenbezogenen Teil. Damit sollte die Einheit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung betont werden.
—Erstmalig in der deutschsprachigen Schweiz war eine gemeinsame Ausbildung für Lehrkräfte des Kindergartens und der unteren Klassen der Primarschule vorgesehen.
—Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für die Sekundarstufe I sollte sich nicht mehr auf unterschiedliche Schultypen beziehen, sondern sich ausschließlich an der Schulstufe orientieren.
—Für Kindergarten und Volksschule waren drei stufenbezogene Ausbildungsgänge vorgesehen: für den Kindergarten und die 1./2. Klasse der Primarschule, für die 1. bis 6. Klasse sowie für die 5. bis 9. Klasse. Für die 1. und 2. sowie für die 5. und 6. Klasse sollten also je zwei Lehrkategorien unterrichtsberechtigt sein (sogenannte Stufenüberlappung).
—Die Dauer der Ausbildung im tertiären Bildungsbereich sollte harmonisiert werden: zwei Jahre für Kindergarten und Primarstufe, drei bis vier Jahre für die Sekundarstufe I und sechs Jahre für die Sekundarstufe II (bei den beiden letzteren: inklusive fachwissenschaftliche Ausbildung).
—Die Grundausbildung sollte zugunsten des lebenslangen Lernens bzw. der Weiterbildung verkürzt werden.
—Die bestehenden Infrastrukturen sollten für die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung genutzt werden.
Im Folgenden wird sich zeigen, dass einige dieser Grundsätze für die Realisierung tatsächlich auch wegweisend blieben, andere aber aufgegeben werden mussten, und einzelne auch wesentlich zu den Folgeproblemen der beginnenden 2000er-Jahre beitrugen.
Diese Grundsätze zur «Gesamtkonzeption der Lehrerbildung» legten nicht nur die Eckwerte für die Berner Reform fest, sondern hatten Wirkungen über den Kanton Bern hinaus: Vergleicht man die Situation der Ausbildung von Primarlehrerinnen und Primarlehrern in den Kantonen der deutschsprachigen Schweiz, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Badertscher et al. 1993; Criblez 2010): In der Region Zürich/Nordwestschweiz (Kantone AG, BL, BS, SH, ZH) hatte sich ein tertiäres, maturitätsgebundenes Lehrerbildungskonzept durchgesetzt. In Solothurn hatten – ähnlich wie im Kanton Bern – Diskussionen über eine Gesamtkonzeption Lehrerinnen- und Lehrerbildung begonnen, hier allerdings vor allem durch die unbefriedigende Situation der Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen ausgelöst, ein Thema, das auch in der Berner Reform bearbeitet werden musste. In der Zentralschweiz war die Zukunft der von Kongregationen getragenen Lehrerinnen- und Lehrerbildung bereits seit einiger Zeit aus finanziellen und Nachwuchsgründen ungeklärt (vgl. Huber 2016/im Druck); grundlegende Reformen drängten sich deshalb immer dringlicher auf. Verschiedene Kantone, neben Bern insbesondere Luzern und St. Gallen als quantitativ gewichtige Kantone mit seminaristischen Konzepten, hatten zudem spätestens seit den 1950er- und 1960er-Jahren Erfahrungen mit tertiären Ausbildungskonzepten (Lehrerbildungskurse für Maturi und Maturae einerseits, für Berufsleute andererseits) gesammelt. Eine Alternative zur seminaristischen Konzeption war damit zumindest denkbar geworden. Vor diesem Hintergrund kann der Berner Entscheid für eine grundsätzlich tertiäre Lehrerinnen- und Lehrerbildung als dynamisierender Faktor für die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der ganzen deutschsprachigen Schweiz interpretiert werden. Mit ihm kippten die Mehrheitsverhältnisse quantitativ vom seminaristischen zum tertiären Ausbildungskonzept – noch bevor die bildungspolitischen Diskussionen über die Schaffung der Pädagogischen Hochschulen begonnen hatten.
Am 9. Juni 1993 wurde die Vernehmlassung zum neuen Gesetz über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung eröffnet. Damit wurde auch die beabsichtigte Organisationsform publik: Geplant war die Angliederung von dezentralen Lehrerbildungsinstituten an die Universität Bern. Die Vertreter der bisherigen universitären Studiengänge sprachen sich allerdings in der Vernehmlassung klar gegen die Angliederungslösung aus. Zeitlich ungefähr parallel zum Vernehmlassungsprozess im Kanton Bern publizierte die EDK ihre «Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen» (EDK 1993a) und legte mit der «Interkantonale[n] Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen» vom 18. Februar 1993 (EDK 1993b) die Grundlage für die gegenseitige Anerkennung der Lehrdiplome zwischen den Kantonen. Der Bund hatte zudem von Mai bis September 1993 die Vernehmlassung zum «Bundesgesetz über die Fachhochschulen» durchgeführt (Botschaft FHSG 1994, S. 10 f.). Die Merkmale von Fachhochschulen14 und Pädagogischen Hochschulen waren also gesamtschweizerisch noch nicht festgelegt, als der Kanton Bern die Eckwerte für seine künftige Lehrerinnen- und Lehrerbildung definierte. Die «Empfehlungen zur Lehrerbildung und zu den Pädagogischen Hochschulen» wurden von der EDK erst am 26. Oktober 1995 beschlossen (EDK 1995), fast ein halbes Jahr nachdem der Grosse Rat des Kantons Bern am 9. Mai 1995 das «Gesetz über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung» verabschiedet hatte.
Im Wesentlichen übernahm dieses Gesetz die Eckwerte, wie sie in den «Grundsätzen» definiert worden waren (vgl. oben). Einzig die Stufenüberlappung und die gemeinsame allgemeine Grundausbildung für alle Lehrkategorien wurden fallen gelassen. Forschung und Entwicklung gehörten nun zum Grundauftrag der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Das Personal wurde der kantonalen Personalgesetzgebung unterstellt, hinsichtlich Entlöhnung und Lehrpensen war es also nicht universitären Regelungen unterworfen. Die neuen Lehrerbildungsteams sollten aus dem Personal der bisherigen Lehrerbildungsinstitutionen zusammengesetzt werden (Grundsatz der Personalüberführung). Die Studiengänge für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule sollten mindestens zwei Jahre dauern – obwohl sich in der Diplomanerkennungsdiskussion bereits gezeigt hatte, dass die europäische Anerkennung von Lehrdiplomen einen Abschluss auf dem Niveau «bac + 3» (Mittelschulabschluss + dreijährige Hochschulausbildung) verlangte (Plotke 1991). Die hauptsächlichen Argumente für die Angliederung dezentraler Institute an die Universität Bern waren Kostenneutralität, Praxisnähe sowie die Forschungserfahrung der Universität. Der Status der Angliederung wurde im Gesetz jedoch nicht geklärt. Auf eine vollständige Integration in die Universität wurde verzichtet, weil sich die Erziehungsdirektion als Monopolarbeitgeberin die entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten erhalten und gleichzeitig die Lehrerinnen- und Lehrerbildung vor inneruniversitären Verteilkämpfen und Dynamiken schützen wollte (Criblez & Reusser 2001).
Das Gesetz wurde im Grossen Rat mit 143 zu 26 Stimmen angenommen (Tagblatt des Grossen Rates 1995, S. 540). Eine öffentliche Diskussion hatte kaum stattgefunden und das von Vertretern des seminaristischen Ausbildungskonzeptes in Erwägung gezogene Referendum wurde nicht ergriffen. Für den Implementationsprozess war eine zeitliche Phasierung der Reform vorgesehen: Zuerst sollten die Unterseminare in Gymnasien umgewandelt und daran anschließend sollte die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung realisiert werden. Das Gesetz behielt aber dem Grossen Rat einige zentrale Ausführungsentscheide vor, u. a. die Frage der Dauer des Studiums, die er 1998 mit einem entsprechenden Dekret entschied: Weil sich inzwischen abzeichnete, dass eine zweijährige Ausbildung für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule von Seiten der EDK nicht anerkannt werden würde, beschloss der Grosse Rat eine Mindestdauer von drei Jahren im Anschluss an einen Abschluss der Sekundarstufe II (Tagblatt des Grossen Rates 1998, S. 751). Der Beschluss über die Ausbildungsdauer zeigt, dass die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sich auch im Kanton Bern nun an gesamtschweizerischen Vorgaben für die Diplomanerkennung auszurichten begann.15 Gleichzeitig war die Auflage der Kostenneutralität durch die Verlängerung der Ausbildung eigentlich nicht mehr einzuhalten.
Regierungsrat und Erziehungsdirektion hatten nach der Verabschiedung des Gesetzes zunächst an einer breiten Mitwirkung der Betroffenen, wie sie seit den 1980er-Jahren gepflegt worden war, festgehalten. So waren etwa Planungsgruppen mit der Erarbeitung von Studienplänen und der Abklärung des Personalbedarfs beauftragt worden. Das Personal wurde nach seinem präferierten Aufgabenfeld in den neuen Maturitätsschulen bzw. in der neuen Lehrerinnen- und Lehrerbildung befragt. Diese Befragung sollte als Grundlage für die Überführung des Personals dienen.
Während die Schaffung der neuen Gymnasien plangemäß umgesetzt werden konnte, geriet die Planung für die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung gegen Ende der 1990er-Jahre allerdings zunächst in Verzug und dann in Kritik. Um die Koordination sicher zu stellen, wurde aus Sicht der Erziehungsdirektion eine zentralere Projektsteuerung notwendig. Bei der Personalüberführung zeichnete sich ab, dass ein Teil des Personals nicht übernommen werden konnte; die Qualifikationsanforderungen wurden deshalb entsprechend erhöht. Die Erziehungsdirektion änderte in einem iterativen Steuerungsprozess mehrmals die Planungsvorgaben, und die Verordnung, die viele der offenen Fragen hätte klären sollen, wurde statt wie angekündigt 1999 erst 2001 in eine Konsultation geschickt. In den Lehrerbildungsinstitutionen und beim Personal war die Unsicherheit gestiegen, auch wegen der langen Dauer des Prozesses und der Unsicherheit über die zukünftige Anstellung und Aufgabenzuteilung in der neuen Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Die Kritik an der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung kumulierte im Frühling 2000 in verschiedenen parlamentarischen Vorstößen im Grossen Rat des Kantons Bern. Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates ließ daraufhin die Entwicklung und die Situation des Reformprojekts durch eine externe Expertise evaluieren (Criblez & Reusser 2001). Diese Expertise erkannte Probleme im Projekt und seinen Rahmenbedingungen vor allem in den folgenden Bereichen:
—mangelnder Autonomiestatus der an die Universität Bern angegliederten Lehrerinnen- und Lehrerbildung bei gleichzeitig mangelnder Klärung des Verhältnisses der Universität zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung – und vice versa;
—dezentrale Standorte bei gleichzeitig universitärem Status und zentraler Steuerung;
—Auflage der Kostenneutralität bei Verlängerung der Ausbildung für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarstufe um 50 Prozent;
—zu geringe Projektressourcen (Spardruck des Kantons);
—große Unsicherheit im Planungsprozess für die Betroffenen (Personal);
—komplexe und schwerfällige Projektorganisation sowie Probleme in der Projektsteuerung (u. a. mangelnde Konsistenz der Umsetzung, Veränderung der Planungsvorgaben im laufenden Prozess; unklarer Status bzw. Veränderung des Einbezugs der Betroffenen [Planungsgremien], Probleme bei Information und Kommunikation; Fehlen von mit klaren Entscheidungskompetenzen versehenen Koordinationsgremien usw.) (vgl. Criblez & Reusser 2001).
Die externe Expertise kam zum Schluss, dass für die neue Lehrerinnen- und Lehrerbildung vor allem die notwendigen Klärungen auf allen Ebenen herbeigeführt werden sollten. Insbesondere schlug sie vor, die nicht geklärten Strukturfragen anzugehen. Mögliche Lösungen sah sie in einer Vollintegration der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in die Universität, in der Schaffung einer Pädagogischen Hochschule oder in der Verbesserung des Angliederungsmodells (Criblez & Reusser 2001, S. 65).
Die «Verordnung über die deutschsprachige Lehrerinnen- und Lehrerbildung» trat am 16. August 2001 in Kraft, die Ausbildung in den neuen Studiengängen begann im Oktober 2001. Am dezentralen Standort Langenthal konnte allerdings der Betrieb mangels Anmeldungen nicht aufgenommen werden. 2002 wurden die dezentralen Institute in Langenthal und Biel definitiv geschlossen, 2003 dasjenige in Spiez.
Der Grosse Rat des Kantons Bern überwies nach Kenntnisnahme der externen Expertise und entsprechenden Diskussionen eine Motion der Geschäftsprüfungskommission, die verlangte, die gesetzlichen Grundlagen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, aber insbesondere ihren institutionellen Status noch einmal zu überprüfen (Tagblatt des Grossen Rates 2001, S. 583–595). Bevor dieser Auftrag aber ernsthaft erledigt wurde, überwies er im Januar 2002 auch eine Motion von Grossrat Peter Santschi, mit der die Regierung beauftragt wurde, eine Pädagogische Hochschule zu planen (Tagblatt des Grossen Rates 2002, S. 92–101). Zwar hatte die Erziehungsdirektion für eine Vollintegration in die Universität plädiert, aber die Angst vor einer «verakademisierten» Lehrerinnen- und Lehrerbildung und die Hoffnung auf eine autonome Hochschule, die den spezifischen Anforderungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gerecht wird, ließen das Parlament diesen Entscheid, der in einem gewissen Widerspruch zum vorigen Entscheid stand, fällen. Der Kanton Bern gliederte sich damit in den «Mainstream» der meisten Lehrerbildungsreformprojekte ein. Die Planung der Pädagogischen Hochschule Bern wurde rasch in Angriff genommen und schon 2004 das entsprechende Gesetz verabschiedet. Die Pädagogische Hochschule Bern nahm ihren Betrieb in der weitgehend heute noch existierenden Organisationsform am 1. September 2005 auf.