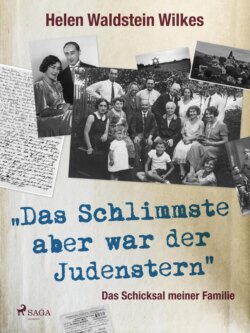Читать книгу Das Schlimmste aber war der Judenstern - Das Schicksal meiner Familie - Helen Waldstein Wilkes - Страница 6
2. Kapitel Die Heimat verlassen
ОглавлениеWie schwer muss diese Verantwortung auf den Schultern meines Vaters gelastet haben! Ich musste so oft an ihn denken, als ich die Briefe weiter durchlas. Ich konnte immer nur kleine Abschnitte lesen. Manchmal brauchte es nur einen einzigen Satz und schon flossen meine Tränen. Manchmal konnte ich einen ganzen Absatz lesen, ohne den inneren Drang zu verspüren, im Zimmer auf und ab zu gehen. Meine Gedanken waren in Aufruhr, und so oft ich auch auf den schönen Waldwegen in der Nähe meiner Hütte Spaziergänge machte, ich kam nicht zur Ruhe.
Fragen über Fragen verfolgten mich. Erinnerungen aus meiner Kindheit kamen an die Oberfläche. Sie vermischten sich mit Geschichten, die ich fünfzig Jahre früher gehört hatte.
Warum hatten sich meine Großeltern nicht sofort eingeschifft, wie sie es meiner Mutter versprochen hatten? Warum sind sie uns nicht gleich nach Kanada gefolgt? Was ist mit Emil passiert und was mit all den anderen Geschwistern und deren Familien? Es klafften in meiner Familiengeschichte riesige Lücken, die ich nicht schließen konnte. Das Lesen der Briefe hatte mir meine Seelenruhe genommen, und ich fühlte mich in Teile zerlegt wie ein aufgelöstes Puzzle.
Abends spazierte ich oft die Landstraße entlang und suchte vergeblich nach innerer Ruhe, die ein paar Stunden Schlaf versprochen hätte. Sehnsüchtig starrte ich in den Himmel, an dem ich gerne mehr Sternbilder als nur den Großen Wagen gekannt hätte. Sterne haben mich immer fasziniert. Die Vorstellung eines Lichtjahres überfordert mich. Trotz seiner unbegreiflichen Geschwindigkeit hat das Licht unzählige Jahre gebraucht, bis es mein Auge erreicht. Es ist sogar möglich, dass jener Stern am Himmel selbst schon lange tot ist, und doch sehe ich ihn in der Finsternis leuchten.
So schien es mir mit denjenigen, die die Briefe geschrieben hatten. Ihre Worte waren für mich so lebendig wie das Licht vom fernsten Stern. Lebten diese Menschen noch? War noch ein Einziger am Leben? Wie war es möglich, dass ich früher nicht gesehen habe, was ich heute sah? Jeder einzelne Mensch existierte jetzt durch seine Briefe, existierte so gewiss wie die Sterne am nachtschwarzen Himmel.
Zahlen haben für mich keine Bedeutung. Das ist ein Grund, warum ich ein Astronomiestudium nie ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Ich bin hoffnungslos humanistisch veranlagt, und der Daseinskampf eines einzelnen Menschen macht auf mich einen größeren Eindruck als die exaktesten statistischen Angaben. Die Seelenqual von Eltern, die ihr Kind verloren haben, trifft mich tief. Ich erstarre innerlich, wenn man Kinder und Eltern zu Tausenden, Zehntausenden oder Hunderttausenden zusammenzählt. Oder gar zu Millionen. Besonders schwierig war für mich die Zahl sechs Millionen. Das ist die Anzahl der Juden, die nach einem systematischen, staatlich sanktionierten Plan in Europa vernichtet wurden. Darunter sollten auch meine Familie und ich sein. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht zu den Millionen Ermordeten gehöre. Dass ich heute noch am Leben bin, ist ein Zufall, genauso wie es ein Zufall ist, dass sechs Millionen andere Juden dem Tod nicht entronnen sind.
Als Kind habe ich gelernt, Fragen zu vermeiden, die meine Eltern womöglich beunruhigt hätten. Obgleich ich als Erwachsene viele soziale und politische Normen hinterfragt habe, habe ich keine Fragen über den Krieg gestellt. Erst als ich die Briefe gelesen hatte, wurde mir das Ausmaß meiner Unwissenheit bewusst.
Die ersten Zeilen von Martha, der jüngeren Schwester meines Vaters, rüttelten mich auf. Der Brief, in dem sie stehen, stammte vom 2. April 1939. Die Handschrift war gut zu lesen und die deutschen Worte waren leicht zu verstehen:
Heute Sonntag fällt es uns besonders schwer, Euch zu vermissen, wir sind immer und immer in Gedanken bei Euch. Als Ihr uns Samstag verlassen habt, war eine solche Traurigkeit in uns, dass wir uns ernstlich zusammennehmen mussten, um vor allem die l. [lieben] Eltern zu trösten.
Ich hatte nie über das genaue Datum unserer Abreise aus Europa nachgedacht. Meine Eltern haben nur mit Unbestimmtheit davon gesprochen. Ich erinnere mich lediglich, dass sie sagten: »Es war vor Hitler.« Marthas Zeilen gaben mir zum ersten Mal ein Datum. Schnell habe ich zurückgezählt, zuerst mit meinen Fingern und dann auf dem Papier. Wenn der März 31 Tage hat und der 2. April ein Sonntag war, so war der Samstag davor der 25. März. Das muss der Tag gewesen sein, an dem wir den Zug von Prag nach Antwerpen genommen haben.
Warum hat mir dieses Datum keine Ruhe gelassen? Etwas hatte mich beunruhigt, und ich brauchte Zeit, um diese neue Information zu verarbeiten. Ich eilte in die Bibliothek. In der historischen Abteilung gab es ein ganzes Regal mit Büchern über den Krieg. Ich suchte nach Daten. Am 15. März 1939 marschierten Hitler und seine Armee in Prag ein. Das waren ganze zehn Tage, bevor wir abreisten.
Aber warum waren meine Eltern überhaupt in Prag, in der Hauptstadt der Tschechoslowakei? Prag war viele Kilometer von unserem Zuhause in Strobnitz entfernt. Unser Heimatort lag fast an der österreichischen Grenze. Meine Mutter hatte oft bedauert, Prag nie gesehen zu haben. Immer wenn Freunde von Prag sprachen, seufzte sie: »Alle sagen, es sei eine wunderschöne Stadt. Schade, dass ich Prag nie gesehen habe.«
Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte noch nie die einzelnen Bausteine zusammengefügt. Für mich hatte der Krieg immer im September 1939 begonnen. Ich hatte nie an Ereignisse vor dem September gedacht. Verschwommen erinnerte ich mich an den Namen Neville Chamberlain, Premierminister von England, der versucht hatte, »Frieden in unserer Zeit« auf Kosten der Tschechoslowakei zu erkaufen. Nun suchte ich nach genaueren Angaben.
Die Tschechoslowakei war nach dem Ersten Weltkrieg zusammengestückelt worden, indem man mit künstlichen Grenzen grundverschiedene ethnische Gruppen miteinander verband, zu denen Tschechen, Slowaken, Ruthenen, Polen, Ungarn und Deutsche gehörten. Die Deutschen lebten zumeist in der Nähe der Grenze zu Deutschland und Österreich, in einem Gebiet, das Sudetenland hieß. Sobald Hitler 1933 an die Macht kam, strebte er danach, das Sudetenland dem Deutschen Reich einzuverleiben.
Wie haben die Juden gewusst, was Hitler vorhatte und dass es Zeit war, das Sudetenland zu verlassen? Vor der Bibliothek, von einer öffentlichen Telefonzelle aus, rief ich Mimi, die Freundin meiner Mutter, an. 1938 war sie 26 Jahre alt gewesen. Sie erzählte mir von den Koffern, die fertig gepackt für die Abreise im Flur standen, während sie mit ihrer Familie am Radio saß. In den frühen Morgenstunden des 30. September teilten die europäischen Großmächte der Welt das Ergebnis ihrer Verhandlungen mit. Ohne die Tschechoslowakei an den Beratungen zu beteiligen, unterzeichneten England, Frankreich, Deutschland und Italien in München das Abkommen, das Deutschland erlaubte, das Sudetenland zu besetzen.
Kaum war Neville Chamberlain in London aus seinem Flugzeug gestiegen, stolz darauf, die Gefahr eines Krieges durch diplomatische Verhandlungen mit Herrn Hitler abgewendet zu haben, setzte sich die deutsche Wehrmacht in Bewegung. Chamberlains Name blieb für alle Zeiten mit dem Begriff Appeasement verbunden. Im Sudetenland wusste man, was in Deutschland mit den Juden geschehen war, dass man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und sie öffentlich diffamiert hatte. So flohen bereits in den frühen Morgenstunden Juden aus dem Sudetenland mit dem Zug nach Prag. Am selben Nachmittag überschritt die deutsche Wehrmacht die Grenze.
Es muss an diesem Morgen, dem 1. Oktober 1938, gewesen sein, dass meine Eltern in Prag Zuflucht fanden. Sechs Monate später, am 15. März 1939, waren sie immer noch dort, als Hitler vom Balkon des Hradschin den Gruß »Sieg Heil« entgegennahm und der Welt verkündete, dass die Tschechoslowakei als souveräner Staat nicht mehr existierte.
Warum waren meine Eltern so lange in Prag geblieben? Hatten sie sich versteckt gehalten, weil ihnen der stark bewachte Bahnhof zu unsicher war? War es zu gefährlich, auf der Straße mit einem Koffer in der Hand gesehen zu werden? Sind sie geblieben, weil sie kein Ausreisevisum hatten und nicht wussten, wohin sie fliehen sollten? Bekam mein Vater tatsächlich erst am 15. März 1939 den Stempel für die Ausreise?
Diese Geschichte hat mir mein Vater nur ein einziges Mal erzählt, auf einem unserer Sonntagsspaziergänge, aber sie hinterließ einen tiefen Eindruck:
»Ich ging an diesem Tag sehr früh auf die Bank. Noch bevor sie öffneten. Eine innere Stimme drängte mich, als Allererster anzustehen. In dem Augenblick, als sie aufmachten, lief ich sofort zum nächsten Schalter und schob meine Papiere unter der Schalteröffnung durch. Der Kassierer seufzte, als er meine Papiere in seine linke Hand nahm. Mit der Rechten griff er nach dem Stempel. Als er den Stempel auf dem Farbkissen hin und her bewegte, sagte ein anderer Bankbeamter etwas zu ihm. Automatisch drückte der Kassierer den feuchten Stempel auf meine Papiere und drehte den Kopf zu dem Bankbeamten.
Kassierer: ›Was hast du gesagt?‹
Bankbeamter: ›Ich habe gesagt, keine Stempel mehr. Keine Ausreisestempel. Wir machen zu. Befehl von oben.‹
Schnell zog der Kassierer das Gitter herunter, aber noch schneller hielt ich meine Papiere in der Hand!«
Jetzt hatte ich verstanden, warum mich das Datum im Brief von Martha so aus der Fassung gebracht hatte. In weniger als einem Jahr sind meine Eltern mit mir nicht nur zweimal geflohen, sondern mein Vater hatte außerdem den allerletzten Vorkriegsausreisestempel erhalten.
Was empfand man in den Jahren 1938 und 1939, wenn man Jude war? Über diese Tage, Wochen und Monate sprachen meine Eltern nie. Heute glaube ich, dass meine Mutter diese Zeit völlig aus ihrem Gedächtnis gelöscht hatte.
Ich habe weitere Hinweise dafür gefunden, dass wir tatsächlich monatelang in Prag lebten. Der stärkste Anhaltspunkt war eine Postkarte, die an uns in Prag adressiert war. Der Inhalt bezieht sich darauf, dass wir im September 1938 aus dem Sudetenland geflüchtet sind. Wie der Poststempel zeigt, saßen wir sechs Monate später immer noch in Prag fest und warteten darauf, uns aus der Schlinge befreien zu können.
Als ich von meiner einsamen Hütte zurückgekehrt war, fragte ich meine Mutter nach Prag. Wieder stritt sie ab, jemals in Prag gewesen zu sein. Ich versuchte, weiter in sie zu dringen, aber sie konnte sich an nichts erinnern. Ihr einziges Zugeständnis war – und das schützte sie vor dem, was sie in diesen Monaten der Ungewissheit erlebt hatte: »Es ist möglich, dass wir in Prag waren, aber nur ein paar Stunden. Nur am Bahnhof, auf dem Weg nach Antwerpen.«
Wieder überprüfte ich die Daten. Wenn wir erst am 25. März 1939 Prag verließen, dann waren wir noch dort, als Hitler in die Stadt einmarschierte. Welche Erfahrungen bewogen meine Mutter dazu, den Vorhang über diesem Teil ihres Lebens zuzuziehen?
Ich kann mir ihre furchtbare Angst nicht vorstellen. Saß sie vor Angst zitternd zusammen mit meinem Vater am Radio und hörte Hitlers heiserer Stimme zu? Haben sie über jedes einzelne Wort, das er sagte, nachgedacht oder konnten sie vor Angst nicht mehr denken? Wer war dabei? Waren wir allein, meine Eltern und ich? War es zu gefährlich, sich auf die Straße zu wagen? War selbst die kurze Entfernung zwischen zwei Häusern zu weit? War der Jubel bei Hitlers Ankunft in Prag und die wild gewordene Masse eine Warnung, dass sie zu Hause hinter zugezogener Gardine bleiben sollten?
Sicherlich fühlte sich jeder Jude in Prag in die Enge getrieben. Die sogenannte Kristallnacht, die Nacht der zerbrochenen Fensterscheiben, hatte bereits als staatlich organisierter Angriff gegen Juden überall in Deutschland, Österreich und im Sudetenland stattgefunden: Am 9. und 10. November 1938 wurden Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Häuser geplündert und Juden auf der Straße geschlagen, während die Passanten Hurra riefen und vor ihnen ausspuckten.
Fehlten meinen Eltern noch die nötigen Papiere? War das der Grund, warum wir immer noch in Prag waren? Ohne Papiere mussten sie um ihr Leben fürchten.
Ängstliche Gedanken müssen meinen Vater aufgewühlt und ihm die Kraft genommen haben. Meine Mutter hat oft erzählt, dass er auf der Bahnfahrt nach Antwerpen an der Ruhr erkrankt war und oft länger auf der Toilette blieb. Wie viel davon war Krankheit und wie viel war pure Angst?
»Niemand ist zu dieser Zeit mit der Bahn gefahren«, versicherte mir Mimi, als ich sie zum zehnten Mal anrief. »Die Flugzeuge waren klapperig, aber die Leute sind trotzdem geflogen. Den Zug zu nehmen war zu gefährlich. Da hätte man durch ganz Nazi-Deutschland fahren müssen.«
Die Briefe bestätigen, was meine Mutter erzählt hat. Wir fuhren tatsächlich mit der Bahn von Prag nach Antwerpen. Der einzige Weg, den es gab, führte quer durch Nazi-Deutschland.
Ich versuche, mir meine Eltern im Zug vorzustellen: wie sie den Blick senkten, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Irgendwie war es ihnen gelungen, meine kindliche Neugierde zu dämpfen und mich zum Schweigen zu bringen. Obwohl ich keine konkreten Erinnerungen an die Bahnfahrt habe, lebt ein Gefühl der Angst noch heute in mir.
In dem Hollywood-Film Julia spielt Jane Fonda eine Amerikanerin, die kurz vor Kriegsbeginn mit dem Zug durch Deutschland fährt. Dieses Video habe ich sehr oft ausgeliehen. Immer wieder sehe ich mit Herzklopfen, wie die Nazis in den Zug steigen. Ich warte auf die Szene, in der der Kontrolleur nach ihrem Pass fragt und einen kurzen Moment zögert. Wie hypnotisiert sehe ich meinen Vater in der gleichen Situation vor mir, wie er den Atem anhält, während seine Papiere geprüft werden.
Zwischen den Briefen in der Schachtel liegt eine ganz schlichte Postkarte, die an uns in Antwerpen adressiert ist. Auf der Karte ist kein Bild. Adresse und Mitteilung sind mit der Schreibmaschine getippt. Das einzig Persönliche ist die Unterschrift: Emil. Bewog schon die Unterschrift seines Schwagers meinen Vater dazu, diese unauffällige Karte aufzubewahren und mit nach Kanada zu nehmen?
Die Adresse sieht ganz nach vorübergehender Zufluchtsstätte aus. Das Wort Monsieur ist falsch abgekürzt als Mons. Dann folgt der eindeutig deutsche Name meines Vaters: Edmund Waldstein. Die Adresse: Hotel Maison Max und die Straße Rue de la Station 40-42-44 weisen darauf hin, dass meine Eltern ein Hotel gewählt hatten, in dessen Nähe eine Bahntrasse verlief – die Lebensader aller Menschen auf der Flucht. Und dann fällt die französische Fassade ganz ab und die Angabe von Stadt und Land ist in deutscher Sprache: Antwerpen, Belgien.
Emil bestätigt auf der Postkarte den Empfang eines Telegramms und dreier Briefe, was darauf hinweist, dass wir längere Zeit in Antwerpen geblieben sind. Was hat meine Eltern davon abgehalten, das nächste Schiff nach Kanada zu nehmen?
Genauestens prüfe ich jedes Wort von Emil:
Ich war heute bei der Canadian Pacific Gesellschaft und Steiner sagte mir, dass man keinen Vorzeigebetrag brauche, aber die Schiffskarte von drüben und ich soll in einigen Tagen nachfragen kommen, was für Bestimmungen herauskommen. Heute sagte Steiner nichts von einem Permit und ich muss Euch alles selbst überlassen, sich in Canada sofort zu erkundigen, ob ich auf Grund der früheren Anforderung ohne Kapital einreisen kann oder Permit und Schiffskarte von drüben brauche.
Das muss wohl der Grund gewesen sein, warum wir so lange in Antwerpen geblieben sind. Wir warteten darauf, dass Anny und Ludwig uns nicht nur die Einreisebewilligung für Kanada, sondern auch die Schiffskarten schickten. Außerdem verlangte die kanadische Regierung, dass für jeden Immigranten 1000 kanadische Dollar als Sicherheit hinterlegt wurden. Mimi erzählte mir, dass man aus Europa kein Geld ausführen durfte, und dass wir in Kanada mit dem Gegenwert von einem Dollar in der Tasche ankamen.