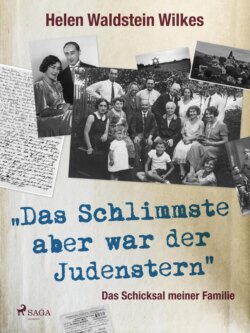Читать книгу Das Schlimmste aber war der Judenstern - Das Schicksal meiner Familie - Helen Waldstein Wilkes - Страница 7
3. Kapitel Briefe nach Antwerpen
ОглавлениеDer Anfang ist wohl bitter. Manches wird Euch schwer fallen und schmerzlich berühren, aber der gute Wille und das harte Muss wird alle Schwierigkeiten überbrücken.
Diese Worte von Arnold, dem älteren Bruder meines Vaters, blieben mir im Gedächtnis. Ihre Symbolik erstaunt mich – wie so vieles im ersten Brief vom 2. April 1939. Mein Vater hatte dafür einen Ausdruck: vernünftig.
Diese Wortwahl passte gut zu meiner Vorstellung von einem großen Bruder, wie ich ihn mir wünschte, einem Bruder, der mir den Weg ebnen würde, und ebenso passte sie zu meinem Bild von Menschen, die sich zum Ingenieurberuf hingezogen fühlen. Jetzt entdecke ich diesen Arnold, dessen unerschütterlicher Optimismus das Ergebnis einer tiefen Familienbindung ist, und nehme ihn aus der Nähe wahr.
Heute sind es 8 Tage seit wir uns von einander verabschiedeten und noch immer habe ich dieses schreckliche traurige Gefühl in mir, das mich diesmal zum ersten Male so tief ergriffen hat. Ihr könnt Euch denken, wie glücklich wir waren, als wir von Eurer guten Ankunft in Antwerpen erfuhren und wie uns allen viel leichter wurde. Wir begleiten Euch in all den Tagen mit unseren Gedanken auf Eurer großen Reise und sprechen stets von Euch. Und ich schreibe Euch auch gleich am ersten freien Tag, damit Ihr gleich nach der Ankunft meine Zeilen erhaltet und Euch ein Gruß von der Heimat etwas Trost bringen soll, in Eurer neuen und so ungewohnten Umgebung.
Hoffentlich gelingt es Euch bald, Euch einzuleben, dem neuen Milieu anzupassen und das neue Ungewohnte nicht zu sehr zu empfinden. Eure l. Angehörigen werden es gewiss an nichts fehlen lassen, um Euch den Übergang erträglich zu gestalten, die Gegensätze mildern, und Euch manche von den Unannehmlichkeiten ersparen, die sie selbst mitzumachen gezwungen waren.
Für uns ist es ein sehr beruhigendes Bewusstsein und unsere stärkste seelische Stütze, Euch und den l. Otto in gesicherter Existenz zu wissen, denn wir bauen ja auch unsere Zukunft auf Euch.
Ich bitte Dich in diesem Sinne sofort an die l. Bella zu schreiben und die Sache so weit es nur geht, zu beschleunigen. Es wäre mir doch eine gewisse Beruhigung, wenn ich und die l. Vera schon diese Aussicht oder Sicherheit hätten.
Gestern nachm. waren wir bei Elsa. Wir waren die einzigen Gäste und so war es recht ruhig im Gegensatz zu voriger Woche. Wir sprachen viel von Euch und Emil berichtete von Euren Briefen. Für Deine Bemühung mit der Tovona habe vielen Dank l. Edi. Leider kam schon inzwischen ablehnende Antwort, da die dortigen Vorschriften es nicht zulassen.
Eine andere Handschrift – die von Arnolds Frau Vera – folgt. Als Ärztin hat Vera einen fotografisch präzisen Blick und hält so den Moment unserer Abreise fest:
Ich sehe Euch noch so vor mir, wie Ihr aus dem Coupéfenster saht, vor Euch das blonde Lockenköpferl der kleinen Helli, die so lustig und herzig war und lachte, als ob es keinen Abschied auf der Welt gäbe. Hoffentlich hat das Kind mit seinem unbewussten Optimismus recht.
Dort, wo Arnold und Vera zu schreiben aufhören, füllt die geschliffene Sprache von Else, der Schwester meines Vaters, die Seiten.
Meine Lieben, nun sind es schon acht Tage seit wir Euch Lebewohl sagten und Ihr habt Euch inzwischen ein großes Stück von uns entfernt. Wir denken jede Stunde an Euch und verfolgen im Geiste jedes Stück Eurer Reise. Es ist gerade Sonntag nachmittag, der erste ohne Euch. Ich glaube jeden Moment, dass die Türe aufgeht und Ihr hereinkommt und höre Helli sagen, Tante Else, ich will ein Fettenbrot.
Aunty Elsa, Tante Else. Ich versuchte es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, ließ die Worte auf mich wirken, aber sie riefen keine bekannten Gefühle hervor. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass ich einmal regelmäßig durch die Tür gestürmt bin und den Namen meiner geliebten Tante gerufen habe.
Weniger erstaunt mich, dass mein unersättlicher Appetit noch weiter zurück in die Vergangenheit zu gehen scheint, als ich gedacht habe. Meine Mutter hat mir oft von unserer Überfahrt erzählt. Während sie und mein Vater unter Deck in den überfüllten Kabinen kaum Luft bekamen, lief ich auf dem Schiff herum und erzählte völlig fremden Leuten, dass ich hungrig sei. Noch heute bereitet es mir Schwierigkeiten, nicht gleich, wenn ich nach Hause komme, in die Küche zu marschieren. Auch wenn mein Appetit sich nicht verändert hat, sind die Lebensmittel wenigstens andere. Ausgelassenes Gänsefett gehört heute nicht mehr zu meinen Leibspeisen. In der Welt meiner Mutter waren die bevorzugten Leckerbissen Gänsefett, Entenfett und Hühnerfett – und zwar genau in dieser Reihenfolge. Meine Mutter liebte es, mit der Hand die dicke, cremige Schicht Fett unter der Geflügelhaut herauszuziehen. Dann ließ sie es langsam in der Bratpfanne aus und gab noch etwas Zwiebel dazu, um den Geschmack zu verfeinern. Erst wenn es ausgekühlt und wieder hart war, durfte ich es auf eine dicke Scheibe Roggenbrot streichen.
Es ist mir noch immer nicht ganz ins Bewusstsein gedrungen, dass Ihr schon wirklich fort seid, und doch müssen wir alle von Glück reden, dass es so rasch und günstig gegangen ist, denn jetzt würde es bestimmt viel schwieriger oder vielleicht sogar unmöglich sein, da keine Ausreisebewilligungen zu haben sind. Unsere Marianne hat jetzt auf einmal große Lust bekommen, nach England zu gehen. Doch wird es sehr schwer möglich sein, dass sie hinkommt, da der Andrang sehr groß ist. Der l. Emil hat sich diese Woche mit ihr einige Stunden lang anstellen müssen, dass sie nur eine Nummer bekommt und in zwei Wochen soll sie erst eine nähere Information bekommen. Ich kann mich mit dem Gedanken noch nicht vertraut machen, dass sie schon in die Fremde gehen soll, aber je früher es der Fall wäre, desto besser für sie. Es ist ja leider jetzt das Los so vieler Eltern. Ich hoffe halt immer, dass wir doch noch einige Jahre werden alle beisammen bleiben können. Das Schicksal scheint es anders zu bestimmen.
Auch wenn sie es verstecken wollte, die Aussicht, Marianne nach England schicken zu müssen, lastete schwer auf Else. Ich erinnere mich daran, wie es mit meinen eigenen Töchtern war, die mit etwa zehn Jahren zwar schon sehr selbstständig waren, aber dennoch vielerlei Unterstützung brauchten, um erwachsen zu werden. Wie sehr hätte es mir widerstrebt, sie in dieser entscheidenden Phase ihres Lebens jemand anderem anzuvertrauen.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich den Mut einer Löwin besäße, wenn ich meine Kinder verteidigen müsste. Zugleich habe ich mich gefragt, wie schlimm die Situation sein muss, damit ich meine Kinder ins Ausland schicke, um sie von Fremden aufziehen zu lassen. Ich war nicht imstande, mir das vorzustellen. Andere Schrecknisse kann ich mir leicht vorstellen, und die sind auch nicht weit weg von mir. Die Angst vor Verfolgung ist immer gegenwärtig.
Bei der Geburt jedes Kindes kaufte ich goldene Münzen in der Absicht, sie in den Saum ihrer Bekleidung einzunähen, sollten wir jemals fliehen müssen. Für den Fall, dass meine Kinder von mir getrennt werden, wollte ich, dass diejenigen, die sie finden würden, auf jeden Fall ausreichend Mittel hätten, um sie durchzubringen. Noch heute entzündet jede Weltkrise die Flammen meiner Paranoia. Alte Ängste mögen begraben sein, aber sie verschwinden nicht. Das Gold habe ich noch.
Als nächstes Familienmitglied trägt Dr. Emil Urbach, der Ehemann von Else, zum Brief vom 2. April bei. Er richtet seine Worte nur an meinen Vater, sie sind eine Mischung aus sinnvollen Empfehlungen und ungeschminkten Fakten:
Lieber Edi, ich habe mich sehr gefreut, dass es Euch unterwegs verhältnismäßig gut ergangen ist und hoffe, dass Ihr auch gutes Seewetter haben werdet. Es wäre notwendig, dass Du an Deinem jetzigen Wirkungsorte eine sehr ausgiebige Kost einnimmst, damit Du Kräfte für das Farmen sammelst.
Emil gibt keinen Hinweis, dass er nach Kanada kommen möchte, aber er trifft Vorsorge, seine Tochter nach England zu schicken, um sie dort in Sicherheit zu bringen.
Bei uns hat sich vorderhand nichts geändert. Wir beabsichtigen die l. Marianne nach England zu einer Familie zu schicken, haben sie jetzt deswegen registrieren lassen. Ob und unter welchen Bedingungen es geschehen solle, erfahren wir Freitag, den 14. d. M.
Es waren die Worte Emils, die mich an Kindertransport denken ließen, ein Wort, an das ich mich noch dunkel erinnern konnte. Jetzt begann ich mich eingehender mit dieser Rettungsaktion zu beschäftigen.
Zwischen 1938 und 1940 lockerte Großbritannien seine Einwanderungspolitik, um mindestens 7500 jüdische Kinder aus Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei ins Land zu lassen. Auch wenn der britische Altruismus ein wenig von seinem Glanz verliert, weil er an schwer erfüllbare Bedingungen geknüpft war – private Organisationen und Bürger mussten nicht nur für den Unterhalt und die Ausbildung dieser Kinder aufkommen, sondern auch für ihre etwaige Auswanderung aus Großbritannien –, so kann doch festgehalten werden, dass Großbritannien immerhin nicht untätig blieb.
Kanada und die USA dagegen entschieden sich gegen solche Hilfsmaßnahmen. 1940 informierte der kanadische Botschafter in Washington den Premierminister, dass die amerikanische Regierung gegen die Aufnahme jüdischer Kinder in Kanada sei, aus Angst, diese könnten eines Tages doch versuchen, in die USA einzuwandern. Aber auch wenn es die Türen für jüdische Kinder verschloss, gab Kanada Kindern, die in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien oder in Skandinavien geboren waren, vorübergehendes bzw. immerwährendes Aufenthaltsrecht.1 Es war ein großer Schock für mich, erkennen zu müssen, dass der Antisemitismus auch in Kanada und den USA so tief verwurzelt war.
Mit den Zeilen Emil Urbachs noch frisch in meinem Gedächtnis schaute ich mir den Dokumentarfilm The Power of Good über Nicholas Winton an, der im Rahmen einer Zeitzeugenreihe auf CBC-TV gesendet wurde. Der Film stellt Winton in den Mittelpunkt, einen bescheiden auftretenden Engländer, der über 600 tschechische Kinder – darunter auch Joseph Schlesinger, der den Film gedreht hat – retten konnte. In der vagen Hoffnung, dass er den Streifen vielleicht gesehen hatte, schrieb ich eine E-Mail an meinen einzigen kanadischen Verwandten, einen Großcousin meiner Mutter.
Und tatsächlich: Herbert – heute über achtzig Jahre alt – hatte den Film gesehen. Noch erstaunlicher war allerdings, dass man unter den weinenden tschechischen Kindern, die aus den Fenstern ihren Eltern Lebewohl winkten, auch ihn sah. Ich habe Herberts E-Mail aufgehoben:
Schlesinger ist großartig, und der Film ist fast wie wenn ein Märchen wahr wird. Einmal war ich wirklich zu Tränen gerührt. Und natürlich ist der Augenblick des Abschiednehmens von meinen Eltern am Bahnhof unseres kleinen Städtchens in mein Gedächtnis eingekerbt. Die ausgesprochenen und die verschluckten Dinge, die zurückgehaltenen Gedanken …
Wieder war ich durch die Schmerzen eines anderen sprachlos. Ich konnte Herbert nicht bitten, diese Abfahrt von Prag noch einmal durchzumachen. Trotzdem wollte ich mehr wissen, und so besuchte ich einen Workshop, in dem Überlebende, die damals Kinder waren, ihre Geschichte erzählten.
Besonders bewegte mich die Geschichte eines Mannes in meinem Alter. Seine Eltern hatten ihn in einen Zug nach England gesetzt, jedoch wurde dieser vom deutschen Einmarsch in die Niederlande gestoppt. Eine nette Familie nahm das Kind aus dem Zug auf. So wie mir meine Verwandten aus dem Gedächtnis geraten waren, vergaß auch er sehr schnell die Leute, die in seinen jungen Jahren einmal um ihn waren. Er fragte sich nie, warum seine Geschwister blonde Haare und blaue Augen hatten. Die Erinnerung an die andere Familie schwand. Kurz nach dem Krieg klopfte jemand an die Türe. Vor dem Jungen stand eine verstörte, fremde, ausgemergelte Frau, die behauptete, seine Mutter zu sein. Jahrzehnte später waren die Wunden des Mannes immer noch frisch.
***
Auf die Zeilen von Emil Urbach folgt die Handschrift von Martha, der Schwester meines Vaters. In ihren zum Teil schon oben wiedergegebenen Worten ist deutlich die Angst zu spüren, dass der Abschied vielleicht ein endgültiger war.
Als Ihr uns Samstag verlassen habt, war eine solche Traurigkeit in uns, dass wir uns ernstlich zusammen nehmen mussten, um vor allem die l. Eltern zu trösten.
Und doch seid Ihr die »Auserwählten«, denn überglücklich sind heute die, die in die Ferne ziehen können. Gebe nur der l. Gott, dass Ihr gesund und wohlbehalten an Eurem Ziel ankommt. Beim Betreten der neuen Erde wünschen wir Euch alles nur erdenkliche Gute. Die Luft in Eurer neuen Heimat soll Euch Kraft geben, um wieder festen Fuss zu fassen und in friedlicher Arbeit sollt Ihr Euer Brot verdienen.
Man begegnet in Marthas Worten einer unerwarteten Poesie und Erhabenheit. Wo hat dieses Mädchen vom Land mit einer nur minimalen Schulbildung diese Sprache erworben?
Wie zum Ausgleich umgibt sich Martha mit Liebe, welche die ganze Familie zusammenhält. Sie spricht uns spielerisch mit Worten der Zärtlichkeit an. Meine Mutter nennt sie »Greterl« und meinen Vater »Ederle«. Ich bin das »Helli-Kind«. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass ich auch einen Namen für meine Tante Martha hatte.
Ich glaube am Besten wird es das liebe Helli Kindi haben. Sie wird sich überall gleich wohl und glücklich fühlen. Denkt sie noch an die »Matie«? Ich schicke ihr viele tausend Bussi.
Ich hänge dem Wort »Matie« nach. Dieser kindliche Kosename sagt mir, dass Tante Martha offenbar jemand war, den ich liebte und der eine feste Größe in meinem Leben war. Wie kann es sein, dass ich überhaupt keine Erinnerung an sie habe? Ich bin bestürzt herauszufinden, dass ich bereits sprechen konnte, bevor wir Europa verließen. Nie hatte ich mir vorgestellt, wie ich damals mit meiner Tante redete, auf sie zulief und sie umarmte, ihr Parfüm roch und ihre Arme um mich spürte. Durch ihren Brief wandelt sich Martha für mich von einem bedeutungslosen Schatten zu einer fassbaren Wirklichkeit.
Matie. Das Wort berührt mich sehr tief. Obwohl ich mich an Marthas Anwesenheit nicht erinnern kann, bin ich erstaunt, wie ihre Abwesenheit auf mich wirkt.
Leider werden die Tage immer ernster, man zerbricht sich Tag und Nacht den Kopf, man möchte am liebsten morgen schon fort. Wird man dieser neuen Nervenprobe standhalten, es erwartet uns viel. Wenn es nötig sein wird, muss man, das heißt, wenn man kann. Und nach Erez gehen? Aber was wird mit den Kindern? Die Lage kennt Ihr ja zur Genüge. Sie wird nur täglich trauriger. Die blauen Karten sind momentan gar nicht zu haben.
Liebes Ederle, ich brauche Dir unsere übergroße Bitte nicht wiederholen. Jedoch, sollte die Sache ganz aussichtslos sein, dann schreibe uns bald möglichst, was uns sehr schmerzen würde. Vielleicht gönnt uns doch das Glück noch gemeinschaftlich schöne Stunden. Wir haben ja gemeinsame Jugendstunden verbracht. Vielleicht werden sie in unserem sogenannten Alter auch sein?
Ich bin verblüfft, wie besorgt sie ist. Ihre Angst ist mit Händen zu greifen. Sie versucht erst gar nicht, meinen Vater zu beschwichtigen, dass alles in Ordnung sei; vor ihrer Offenheit kann niemand die Augen verschließen. Es gibt viel in Marthas Brief, was mich umtreibt. Zunächst die Auswanderung nach Palästina. Warum ist das keine Lösung, die auf der Hand liegt? Und warum geht sie davon aus, dass sie die Kinder zurücklassen müsste? Wieder einmal suche ich die Bibliothek auf, um die Umstände von 1939 verstehen zu können.
Ich wusste, dass Israel erst 1948 gegründet wurde. Und seine Entstehung war das Ergebnis der Anstrengungen der Nationen der Welt. Ich wusste, Israel wurde nicht ohne Kämpfe gegründet – aber die Details waren verblasst. Ich verstand nicht, warum die Fränkels nicht einfach das nächste Schiff über das Mittelmeer nach Palästina bestiegen.
Jetzt fand ich heraus, dass der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg das britische Mandat anerkannt und unterschrieben hatte, welches Großbritannien die Herrschaft über Palästina garantierte. Zwischen 1920 und 1948 setzte Großbritannien der jüdischen Einwanderung nach Palästina enge Grenzen. Je größer der Druck derer wurde, die Nazi-Deutschland entkommen wollten, desto strenger handhabten die Briten die restriktive Einwanderung.
Um dieses Nadelöhr zu umgehen, organisierten einige zionistische Gruppen illegale Transporte – vor allem mit leistungsfähigen Menschen, die imstande sein würden, das Land zu bewirtschaften und für seine Freiheit zu kämpfen. Dieses Wissen gab mir die Antwort auf ein Übersetzungsproblem, welches sich in einem späteren Abschnitt des Briefes ergab. Marthas Mann verwendet das Wort »Transport«, im Deutschen ein Fremdwort. Das einzige Mal, dass meine Eltern das Wort nach dem Krieg verwendeten, war in Bezug auf die Züge, welche die Leute in die Konzentrationslager gebracht hatten. Ich befürchtete, das Wort im Brief falsch verstanden zu haben.
Weitere Antworten fand ich in einem Buch Arthur Koestlers, der eine Parallele zog zwischen den verschlossenen Waggons, welche die Juden in den Tod brachten, und den Schiffen, die nach Palästina unterwegs waren. Er nannte sie »kleine Todesschiffe«:
»Die Geschichte Palästinas von Mai 1939 bis zum Ende des Krieges ist im Grunde die Geschichte der Juden, die versuchten, ihre Haut zu retten, und die Bemühungen der Mandatsmacht [Großbritannien], dies durch eine Einwanderungssperre zu verhindern. […]
Es ist wichtig …, im Gedächtnis zu behalten, dass diejenigen Juden in unmittelbarer Lebensgefahr waren, die in den von den Deutschen besetzten Gebieten lebten. Die Flucht eben dieser Menschen war für ›ungesetzlich‹ erklärt worden. […]
Die praktische Folge dieser Politik war […], dass in Palästina mehr als eine halbe Million Juden mit offenen Armen auf ihre gequälten Verwandten warteten. […]
Schmutzige und seeuntüchtige kleine Frachtschiffe kamen über das Mittelmeer und das Schwarze Meer und trieben auf offener See, während sie vergeblich auf die Erlaubnis warteten, ihre menschliche Fracht abzuladen. Hunger, Durst, Krankheit und unsägliche Lebensbedingungen herrschten auf diesen schwimmenden Särgen.
Im März und April 1939 erreichten drei mit Juden beladene Flüchtlingsschiffe Palästina und bekamen keine Landeerlaubnis.
Im Unterhaus fragte Noel-Baker den Kolonialsekretär Malcolm MacDonald, was mit diesen Menschen geschehe. MacDonald sagte, dass man sie dorthin zurückschicke, wo sie hergekommen seien.
Noel-Baker: ›Bedeutet das in Konzentrationslager?‹
MacDonald: ›Die Verantwortung bleibt bei denen, die die illegale Einwanderung organisiert haben.‹« 2
Ich wusste nicht, dass Dachau und andere Konzentrationslager schon vor dem Krieg eingerichtet worden waren und dass die Alliierten sehr wohl über diese Lager Bescheid wussten. Ich dachte, diese Horrorgeschichten seien erst nach der Befreiung bekannt geworden. Vielleicht war das etwas, woran zu glauben für mich notwendig war.
Als ich die Geschichtsbücher schloss und wieder zu Marthas Brief zurückkehrte, wurde mir erst so richtig bewusst, wie haarscharf mein Vater entkommen war.
Die Lage kennt Ihr ja zur Genüge. Sie wird nur täglich trauriger. Die blauen Karten sind momentan gar nicht zu haben.
Ich rief Mimi mit neuen Fragen an. Sie bestätigte meine Vermutungen. Die blauen Karten waren Ausreisevisa, welche sowohl von der Bank als auch von der Gestapo bestätigt werden mussten. Es muss eine solche blaue Karte gewesen sein, die mein Vater zusammen mit seinen anderen Dokumenten zur Bank getragen hatte. An jenem Morgen, als ihm ein verschlafener Bankbeamter das letzte Ausreisevisum gab, welches in Prag ausgestellt wurde.
Kein Wunder, dass Martha von ihrer Notlage überwältigt war. Sie flehte meinen Vater um Hilfe an und unterstrich die Worte »übergroße Bitte« zweimal. Sie wechselte zu anderen Themen, aber die Vorspiegelungen eines normalen Lebens werden schnell zerstört.
Gestern waren wir mit Onkel Fritz bei Vally. Es ist überall dasselbe Thema.
Nur wenn Martha über ihre Kinder spricht, lichten sich die Schatten. Die Kleinen bringen flüchtige Strahlen des Glücks.
Unsere liebe Dorothy ist sehr goldig, aber seit dieser Woche kniet sie sich im Wagen auf, sodass man sie sofort anschnallen musste, damit sie nicht heraus fliegt. Man wird ihr ein Betterl aufstellen müssen. Ilserl ist sehr brav.
Das »Betterl« scheint symbolisch zu sein. Wenn sie wirklich eines aufstellen, heißt das, dass sie jetzt noch nicht weggehen. Dieses Bett bringt mich zu einer anderen Frage. Wie und wo lebte diese vierköpfige Familie? Sie müssen wohl alles im von den Nazis kontrollierten Österreich gelassen und sich von Linz nach Prag aufgemacht haben. Dort wurden sie offenbar von Arnold und Vera aufgenommen. Ich gehe alles noch einmal durch, aber die ersten Briefe bringen keine Anhaltspunkte dafür.
Der kurze Satz »Ilserl ist sehr brav« beschäftigt mich. Es ist eine weitere Verbindung zwischen mir und meiner neun Jahre alten Cousine, da ich ja auch ein braves Kind genannt wurde. Aufgewachsen in einem Land, in dem Selbstbehauptung und der Aufstand gegen die Eltern die Norm zu sein scheinen, hatte ich damit zu kämpfen, so anders als meine Gleichaltrigen zu sein. Als Erwachsene habe ich gelernt, dass diese Art von »Bravsein« eine Sache für Kinder ist, deren Familie dem Tod ins Gesicht geschaut hat. Kann man sich Anne Frank als Mädchen vorstellen, das sich schlecht benimmt? Steht das Leben auf dem Spiel, lernen Kinder sehr schnell, »brav« zu sein.
Es vergingen viele Tage, bis ich wieder einen von Marthas Briefen in die Hand nahm. Mir war alles recht, um dies auf die lange Bank zu schieben. Sie hatte einen Nerv getroffen, aber ich wollte nicht zu diesem tiefen Gefühl vordringen, welches ihre Worte auslösten.
Jedoch, sollte die Sache ganz aussichtslos sein, dann schreibe uns bald möglichst, was uns sehr schmerzen würde. Vielleicht gönnt uns doch das Glück noch gemeinschaftlich schöne Stunden. Wir haben ja gemeinsame Jugendstunden verbracht. Vielleicht werden sie in unserem sogenannten Alter auch sein.
Wie schwer muss es Martha ums Herz gewesen sein, als sie diese Worte verfasste. Von meiner eigenen Kindheit habe ich behalten, dass ein solches Gefühl die Norm ist. Meine Eltern schienen immer unter einer dunklen Wolke zu wandeln und ihre Gespräche kreisten immer um Probleme. Enttäuschte Menschen. »Das Leben ist nicht leicht« war ein Satz, den meine Mutter stets auf den Lippen trug.
Aber meine Eltern versuchten, mich glücklich zu machen. Ohne dass sie dies für sich selbst getan hätten, kauften sie mir zu jedem Geburtstag ein besonderes Geschenk. Meine erste Uhr, einen Ring mit einem kleinen grünen Stein als Geburtsstein. Ich wusste, dass diese Geschenke der Ausdruck ihrer Liebe waren – so wurde von mir erwartet, sie auch glücklich zu machen.
Und das tat ich. Ich war immer ein gutes Mädchen. Es gelang mir, sie mit meinen Erfolgen stolz zu machen. Die Schule war ein gangbarer Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Ich hatte gute Noten, während ich meine sozialen Kämpfe und die Tatsache, eine totale Außenseiterin zu sein, verbarg. Für einen Teenager ohne Samstagabendverabredungen war das eine große Herausforderung – aber in den ersten Jahren waren meine Eltern leicht zu täuschen.
Ihre Kindheit in Europa war so anders gewesen als meine in Kanada. Mein Vater war Teil einer riesigen, lebendigen Familie. Meine Mutter lebte mit einer fast gleichaltrigen Schwester und einem Schwarm von Freunden in einer kleinen Stadt in Bayern. Ich wuchs als Einzelkind auf, isoliert auf einem Bauernhof in Ontario, wo ich eine einklassige Schule besuchte. Meine ersten Schuljahre waren so traumatisch, dass ich sie fast völlig aus meinem Gedächtnis gestrichen habe. Meine Schulkameraden machten mir nämlich klar, dass sie mich nie in ihre Gemeinschaft aufnehmen würden.
Meine erste Sünde war, dass ich kein Englisch sprach, in einer Schule, wo wir »Rule Britannia! Britannia rule the waves!« lernten. Meine zweite Sünde war, dass ich Deutsch sprach – die Sprache des Feindes. Meine dritte Sünde war, dass ich Jüdin war – damals noch ein hässliches Wort.
Viele Jahre lang gab ich mir selbst die Schuld, eine sozial Ausgestoßene zu sein. Nachdem wir den Bauernhof verlassen hatten, bemühte ich mich um jüdische Freunde, aber diese Beziehungen hielten nie so richtig. Die jungen Juden, die ich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre traf, waren entweder sehr materialistisch ausgerichtet oder lebten in einer Pro-Israel-Welt, von der ich nichts wusste. Ich kam überhaupt nicht mit ihnen zurecht, weder mit denjenigen, die für eine in der Ferne liegende Heimat kämpfen wollten, noch mit denen, die nichts anderes interessierte als die Frage, was sie zur nächsten Party anziehen werden.
Eine Zeit lang dachte ich, wenn mich Nicht-Juden einmal als Person kennenlernten, dann würde die Tatsache, als Jüdin geboren zu sein, nicht mehr wichtig sein. Das Leben lehrte mich aber etwas anderes. Die Mädchen in meiner High School bildeten eine Art »Studentinnen-Verbindung«, von der allein ich ausgeschlossen blieb. Die wenigen jungen Männer, die sich mit mir trafen, nahmen bald wieder Abstand, nachdem ihre Eltern »Helen wer?« fragten und meinen Nachnamen hörten.
Langsam begann ich meine Eltern ein bisschen zu verstehen und ich erkannte die tiefen Wunden, die ihnen eine unwirtliche, abweisende Welt zugefügt hatte. Ich verbrachte viel Zeit damit, mir vorzustellen, wie es wohl für sie gewesen war. Wie konnten sie jemals wieder jemandem vertrauen, nachdem sich ihre früheren Klassenkameraden und Freunde, mit denen sie Fußball oder Himmel und Hölle gespielt hatten, gegen sie gewandt hatten? Welche neue Bedeutung schrieben sie dem Wort »Nachbar« zu, als sie die Menschen aus der Nachbarschaft dabei beobachten mussten, wie sie sich hinter zugezogenen Vorhängen versteckten oder auf der Straße die Augen von ihnen abwandten? Ich für meinen Teil wollte beides: Ich hatte das Bedürfnis, jemandem zu vertrauen, und war dennoch nicht bereit, mich auf andere einzulassen, wohl wissend, dass dieser beständige Argwohn an der Seele nagt.
Wenn ich so zurückdenke, fanden meine Eltern nie wirklich Anschluss an echte Kanadier – wie sie diese nannten –, weder in den Jahren auf dem Bauernhof noch in der Stadt. Alle Besucher, die zu uns auf eine Tasse Tee oder zum Essen kamen, sprachen mit dem gleichen deutschen Akzent, der sie von den anderen unterschied, egal wie flüssig ihr Englisch war.
Ich glaube nicht, dass meine Eltern jemals das Gefühl des Fremdseins, des »Andersseins«, welches ihnen von der Welt auferlegt wurde, verloren. Sie sagten von sich selbst oft, »Ausländer« und »Greenhorn«, zu sein – und da waren deutliche Anführungszeichen zu hören, wenn sie diese Worte benutzten. Während meine Mutter die »Kunst der sauren Trauben« – nicht zu begehren, was nicht erreichbar war – ganz gut beherrschte, war mein Vater etwas komplexer veranlagt.
Nur schwer konnte ich mir vorstellen, dass mein Vater einst eine unbekümmerte Seele war, der im Kreis ihrer Familie in Europa Ukulele zupfte oder Klavier spielte. Ich erlebte ihn als einen ruhigen, nachdenklichen, sensiblen Menschen, dem die Einsamkeit zusetzte.
Obwohl er während unserer Sonntagsspaziergänge oft laut dachte – offenbar vergaß er, dass ich noch ein Kind war –, kreisten seine Sorgen um die Gegenwart. Selten sprach er über seine Jahre als Erwachsener in Europa. Nun, da ich mit dem Lesen dieser Briefe begonnen habe, versuche ich, auch die Wurzeln für diese umfassende Traurigkeit zu ergründen, was mir bis dato in keiner Weise gelungen ist.
Einen Hinweis auf diese Traurigkeit fand ich im ersten Brief von Emil Fränkel. Im Brief vom 2. April 1939 folgt seine Handschrift unmittelbar der seiner Frau Martha. Ich habe fast den Eindruck, Emils Worte in der Stille des Morgens zu hören.
Meine Lieben,
Sehnsüchtig warteten wir alle auf Eure erste Nachricht über Euere Reise und Ankunft in Antwerpen. Ich war gerade bei den l. Eltern als Donnerstag um 11 Uhr vormittags der Brief von Euch kam. Der Brief wurde von mir geöffnet und der l. Papa hat ihn uns vorgelesen.
Wir waren alle überglücklich, von Euch gute Berichte bekommen zu haben und haben alle einen Wunsch, der l. Gott möge Euch bis zu Eurem Ziel weiter begleiten. Wenn mir noch so nach Euch bange ist, so tröste ich mich damit, dass Ihr in einigen Tagen an Ort und Stelle sein werdet, wo Ihr nach langer Zeit Eure Ruhe gefunden habt.
Zu den l. Eltern komme ich zweimal täglich und besorge für sie alle Wege. Eure Möbel von der Wohnung sind bereits bei Bush und stehen neben den Sachen von der l. Anny, die gemeinsam expediert werden. Es ist ganz ausgeschlossen an die l. Anny die erwünschten Sachen zu schicken. Wie Euch die l. Martha bereits geschrieben hat, warten wir auf Euren Bericht um sich ein Bild zu machen, welche Aussichten für uns dort bestehen. Vorderhand ist gar keine Möglichkeit, eine Ausreise zu erlangen. Liebreich sollte schon diese Woche mit seiner Familie nach Erez ausreisen und ist der Transport auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Onkel Fritz meint, wir sollen uns alle für den nächsten Transport anmelden. Arnold würde sich uns anschliessen. So arbeiten meine Gedanken Tag und Nacht und ich weiss nicht wo ich früher sein soll.
Zeile für Zeile sann ich über den Brief nach, um ihn zu verstehen. Da Emil der Erste war, der die Schatten am Horizont wahrgenommen und meinen Vater ermutigt hatte, nach Kanada zu gehen, erwartete ich von ihm, dass er mehr Details als die anderen wissen würde. Obwohl viele Fragen blieben, enttäuschte mich dieser Brief dennoch nicht.
Sehnsüchtig warteten wir alle auf Eure erste Nachricht über Euere Reise und Ankunft in Antwerpen.
Sehnsüchtig! Dieses so poetisch verwendete Wort ist ziemlich fehl am Platz. Ich muss mich daran erinnern, dass diese Worte ja nicht von einem Dichter niedergeschrieben wurden, sondern von einem praktisch veranlagten, auf dem Boden der Tatsachen stehenden Geschäftsmann.
Ich gehe noch einmal Marthas Teil des Briefes durch und sehe, dass sie ein Postskriptum angefügt hat, welches sie unterstrichen hat: Emil ist sehr einsam!
Wie selten vernimmt man heutzutage einen Mann, der bekennt, einsam zu sein? Marthas Worte sind der Beweis für die große Zuneigung zwischen diesen beiden Männern und somit für die Tiefe des Verlustes für meinen Vater. Emil war nicht nur sein Schwager, sondern auch sein Vertrauter und sein bester Freund.
Ich war gerade bei den l. Eltern als Donnerstag um 11 Uhr vormittags der Brief von Euch kam.
Den Morgen verbringt Emil immer gleich: Er besucht die Eltern meiner Mutter, Max und Resl. Ich weiß, dass nur Emils Versprechen, nach ihnen zu sehen, meine Mutter letztlich doch noch dazu bewegen konnte, nach Kanada zu gehen. Für mich gibt es bis heute nicht den leisesten Zweifel daran, dass meine Mutter fest davon ausging, ihre Eltern würden nachkommen. Weder die harte Realität noch mögliche Komplikationen konnten sie davon abhalten, das zu glauben, woran sie glauben musste. Da Emil ihr versichert hatte, nach Max und Resl zu schauen und ihnen auf schnellstem Wege eine Karte für die Überfahrt nach Kanada zu besorgen, verließ meine Mutter Europa, überzeugt davon, bald wieder mit den Eltern vereint zu sein.
Zu den l. Eltern komme ich zweimal täglich und besorge für sie alle Wege.
Ich versuche mir die Szene vorzustellen, die sich Emil jeden Tag darbot. Meine Großmutter wird ruhig in ihrem Sessel gesessen und Emils Klopfen an der Tür kaum wahrgenommen haben. In dem fehlgeleiteten Versuch, ihre Klimakteriumsbeschwerden zu lindern, hatten ihre Ärzte Anfang der dreißiger Jahre ihren Geist zerstört. Da meine Mutter große Angst davor hatte, auch ihre Wechseljahre könnten mit Komplikationen verbunden sein, erzählte sie mir diese Geschichte oft. Es war erst Mittag, als meine Großmutter ihre Schürze zum letzten Mal abnahm. Völlig erschöpft vom Kochen, Aufräumen, der Erziehung zweier Kinder sowie von der täglichen Buchhaltung und der Arbeit im Geschäft meines Großvaters, das den Lebensunterhalt der Familie sicherte, sank sie in den Sessel und sprach die unheilvollen Worte: »Ich kann nicht mehr. Ich bin zu müde. Ich kann einfach nicht mehr.« Man schickte sie in ein Sanatorium, um sie mit Elektroschocks zu behandeln. Danach war ihre Arbeitsfähigkeit, die man doch erhalten wollte, kaum noch vorhanden.
Ich versuche mir meinen Großvater Max vorzustellen, wie er Emil die Tür öffnet und ihn hereinlässt. Selbst an einem Wochentag war Max wohl stets akkurat gekleidet – in einem Dreiteiler, der zu seinem Selbstbild als Paterfamilias passte. Der Empfang wird herzlich gewesen sein, aber vermutlich konnte er Emil noch nicht einmal eine Tasse Kaffee anbieten. Da seine Frau ihn nicht mehr bedienen konnte und seine Töchter im Ausland lebten, musste jemand anders diese Aufgabe übernehmen.
Jedes Detail führt mich zu einer weiteren Frage. Wenn meine Großmutter ihre Dienste nicht mehr verrichten konnte, wer kochte dann? Bestimmt nicht Emil, denn Männer seiner Generation hatten nichts mit der Küche am Hut. Hatte Martha etwas zubereitet, das Emil mitbrachte? Eher unwahrscheinlich, da der Vater meiner Mutter zu den sehr wenigen praktizierenden deutschen Juden gehörte, die auf einer streng koscheren Kost bestanden. Er hätte Essen aus Marthas Küche verweigert.
Abgesehen von diesen familiären Besonderheiten, wie sind mein Großvater und die anderen praktizierenden Juden damit zurechtgekommen, dass sie die Speisevorschriften verletzen mussten, die so sehr zum Fundament ihres Lebens gehörten? Waren solche Belange angesichts der Ereignisse rundherum kleiner geworden?
Meine Großeltern Max und Resl waren von anderen völlig abhängig. Sie blieben bis 1937 in Deutschland, bis sie Anny endlich davon überzeugen konnte, in die Tschechoslowakei zu kommen. Ihr Besitz blieb in Deutschland so wie der von Emil in Österreich. Wie kam Emil damit zurecht? In Prag war er nur mit einem Touristenvisum und konnte keiner ordentlichen Arbeit nachgehen. Er muss sich ziemlich überflüssig vorgekommen sein. Nicht einmal, sondern zweimal am Tag besuchte er Max und Resl und erledigte für sie alle Besorgungen.
Was waren das für Besorgungen, und was machte mein Großvater, während Emil sie erledigte? Max war erst Anfang fünfzig und gehörte noch nicht zum alten Eisen. Zuhause in Cham in Deutschland hatte er der örtlichen Jüdischen Gemeinde vorgestanden. Viele Jahre war er auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Cham gewesen – was doch nur ein gesunder, fitter Mann leisten kann.
Als die Nazis 1933 in Deutschland an die Macht kamen, war meine Mutter noch nicht verheiratet und lebte zu Hause. Als die neuen Regelungen in Kraft traten, klopfte es an der Tür. Es war ein Nachbar, der ihrem Vater mitteilte, dass ein Jude nicht mehr bei der Feuerwehr sein könne, auch nicht als Freiwilliger. Leise öffnete daraufhin meine Großmutter das Nähkästchen, nahm ihre beste Schere und schnitt die Blechknöpfe von der Feuerwehruniform, damit Max sie nie mehr tragen konnte.
Der Brief wurde von mir geöffnet und der l. Papa hat ihn uns vorgelesen.
Ich bemerke mit Erstaunen, dass Papa Max den Brief laut vorliest, obwohl ihn Emil geöffnet hat. Der Brief könnte für die ganze Familie bestimmt gewesen sein, Emil gibt ihn aber dem älteren Mann. Emil unterstreicht hier wieder sein Gefühl der Einsamkeit.
Wir waren alle überglücklich von Euch gute Berichte bekommen zu haben und haben alle einen Wunsch, der l. Gott möge Euch bis zu Eurem Ziel weiter begleiten. Wenn mir noch so nach Euch bange ist, so tröste ich mich damit, dass Ihr in einigen Tagen an Ort und Stelle sein werdet, wo Ihr nach langer Zeit Eure Ruhe gefunden habt.
Emils Liste von zusätzlichen Verpflichtungen war lang. Er musste sich schon um meine Großeltern kümmern, jetzt wurde ihm auch noch aufgetragen, sowohl unser Hab und Gut als auch das der Schwester meiner Mutter zu verschicken.
Eure Möbel von der Wohnung sind bereits bei Bush und stehen neben den Sachen von der l. Anny, die gemeinsam expediert werden. Es ist ganz ausgeschlossen an die l. Anny die erwünschten Sachen zu schicken.
Was dachte sich Emil, als man ihm solche Wünsche mitteilte? All seinen Besitz hatte er in Österreich zurückgelassen. Wovon lebte er? Wie traf er Entscheidungen, wo alles um ihn herum sich aufzulösen begann?
Wie Euch die l. Martha bereits geschrieben hat, warten wir auf Euren Bericht, um sich ein Bild zu machen, welche Aussichten für uns dort bestehen. Vorderhand ist gar keine Möglichkeit, eine Ausreise zu erlangen.
Für eine lange Zeit saß ich wie blind mit dem Brief auf meinem Schoß. »Vorderhand ist gar keine Möglichkeit, eine Ausreise zu erlangen.«
Diese Worte sind so unfassbar endgültig. Nur eine Woche nach unserer Abreise wurde die Situation hoffnungslos. Wie knapp waren wir entkommen!