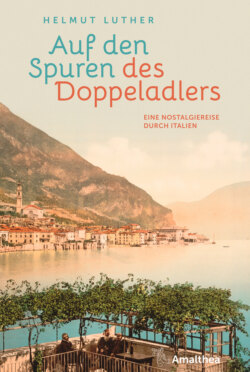Читать книгу Auf den Spuren des Doppeladlers - Helmut Luther - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die letzten Tage in Freiheit Moena, Fassatal, Trentino
ОглавлениеRichard Löwy konnte im Ersten Weltkrieg als Kommandeur der k. u. k. Bauleitung im Fassatal viel Gutes tun. Das hatten die Bewohner nicht vergessen, als Löwy während des Naziterrors mit seiner Familie als Verfolgter zurückkam. In Moena erinnern heute die Via Riccardo Löwy und eine Dauerausstellung an seine Geschichte.
Seit einigen Stunden bin ich mit Giorgio Jellici unterwegs, als der 84-Jährige, der mit seiner sportlichen Figur und kaum einem grauen Haar auf dem Kopf leicht als Anfang siebzig durchgehen könnte, seine dunkle Sonnenbrille abnimmt, mir tief in die Augen schaut und sagt: »Sie sind zwar eine Nervensäge, können aber auch ziemlich sympathisch sein.« Klar, er hat etwas gut bei mir, außerdem begann unser gemeinsamer Tag eher ungünstig. Jellici reiste aus Deutschland mit dem Zug nach Bozen. »Bis zum Brenner ging alles glatt. Kaum waren wir in Italien, hieß es, wir würden mit knapp einer Stunde Verspätung ankommen.« Im ersten Haus am Platz neben dem Bahnhof, wo er Logis genommen hatte, hieß es um halb drei am Nachmittag, sein Zimmer sei noch nicht fertig. Als wir dann losfahren wollten und ich ihm vorher ein Buch zurückgab, das er geschrieben und mir leihweise per Post zugeschickt hatte, und der alte Herr durch ein paar Stichproben feststellen musste, »Sie haben es nicht gelesen!«, war er kurz davor, den Rückwärtsgang einzulegen. In einer Zeitung hatte ich vom Wiener Juden Richard Löwy erzählt – und nicht erwähnt, dass ohne Giorgio Jellici keiner mehr vom traurigen Schicksal Löwys und seiner Familie wüsste, alle wurden in Auschwitz ermordet. Das kam nicht gut an bei Jellici. Doch nun ist er in Bozen. Ich bat ihn, mir die Originalschauplätze von Löwys Geschichte im Fassatal zu zeigen, er stimmte zu. Mit dem Auto fahren wir ins ladinische Tal hinter dem Karerpass.
Richard Löwy im Fassatal
Giorgio Jellici hat Richard Löwy persönlich gekannt. In seiner Kindheit verbrachte er die Sommer- und Winterferien bei seiner Tante, der Volksschullehrerin Valeria Jellici, in Moena, wo die Löwys Unterschlupf gefunden hatten. »In dieser Zeit sah ich Richard täglich, er nannte mich Jörgele«, erzählt Jellici. Sein eigener Weg führte ihn ins Ausland. Nach Stationen in Barcelona, Frankfurt und Brüssel ließ sich der gelernte Jurist mit seiner Familie in Erlangen nieder. 36 Jahre arbeitete Jellici, zuletzt als Direktor, für einen weltweit operierenden deutschen Elektrokonzern. »Wobei Direktor nicht viel bedeutet, auch im Vorstadtkino gibt es einen Direktor«, erklärt er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Nach dem Studium in Padua und Ferrara zog er los. »Ich wollte die Welt kennenlernen.« Als 17-Jähriger trampte Giorgio Jellici bis Kopenhagen, schlief in Parks und einmal auf der Polizeistation – weil die Uniformierten so freundlich waren, dem jungen Mann eine Pritsche für die Nacht anzubieten. Nach dem Studium brach Giorgio Jellici erneut auf, gegen den Willen des Vaters, diesmal mit der Absicht, sich im Ausland ein eigenes Leben aufzubauen. 5000 Lire, umgerechnet 2,50 Euro, hatte er in der Tasche und landete zuerst in Dachau in einem Camp der amerikanischen Truppen. »Den Blaumann mit der Aufschrift ›US Army‹ habe ich lange aufbewahrt«, erzählt Jellici.
Inzwischen sind wir in Moena angekommen, dem Hauptort des Fassatales. Die Atmosphäre, die in Bozen – auch zwischenmenschlich – noch recht gewittrig war, hat sich inzwischen aufgehellt. Wir stehen vor einem öffentlichen Garten, die Sonne scheint, Jellici lächelt. Er hat mich auf das Schild an der Straße hingewiesen, über die wir ins Dorf gelangten. Sie heißt Via Riccardo Löwy. Jetzt lenkt Giorgio Jellici meine Schritte zu einer Tafel, die in Wort und Bild erklärt, wie Richard Löwy ins Fassatal kam. Unnötig zu erwähnen, dass sowohl diese Tafel als auch eine Dauerausstellung im Kulturzentrum von Moena – sie war in mehreren Städten zu sehen, etwa ein halbes Jahr in Venedig – ein Werk Giorgio Jellicis sind. »Ich war in Rom, im Kriegsarchiv in Wien, was für ein Durcheinander! Im Staatsarchiv in Prag haben sich die Beamten einen Tag lang vor mir versteckt. Erst als die Chefin erkannte, dass ich nicht aufgeben würde, konnte ich mit der Arbeit beginnen.« Giorgio Jellici zeigt jetzt auf die verblassten Schwarzweißfotos an der Schautafel. Dort sieht man einen jungen Offizier der k. u. k. Armee mit hochgestelltem Kragen und polierten Knöpfen an der Uniformjacke. Dunkler Wuschelkopf, die Oberlippe ziert ein Bartflaum, auf der Nase steckt eine randlose Brille: Es ist Richard Löwy. Kein arroganter Pinsel, der seine Leute schindet und säbelschwingend Befehle brüllt – eher gleicht der feingliedrige Offizier einem Intellektuellen, der seine Zeit am liebsten in einem Wiener Kaffeehaus verbringt. Auf weiteren Abbildungen sieht man Männer mit Arbeitsgeräten und Frauen in Kittelschürzen, daneben hat sich Oberleutnant Löwy hingepflanzt. »Er hat das halbe Dorf gerettet«, sagt Giorgio Jellici. Während des Ersten Weltkrieges als Chef der k. u. k. Bauleitung in Moena stationiert, standen unter dem Oberleutnant viele Frauen aus dem Dorf in Lohn und Brot, den Männern nützte er auf andere Weise. Weil er zu Recht hoffte, dass man ihn hier nicht vergessen habe, kehrte Löwy nach dem »Anschluss«, als in Österreich die Jagd auf die Juden eröffnet wurde, Hilfe suchend ins Fassatal zurück.
Löwy als Gefreiter
Wie viele Juden, die im Habsburgerreich Karriere machten, kam auch Richard Löwy aus dem Osten. Als er am 7. Dezember 1886 im böhmischen Zasmuky/Sasmuk geboren wurde, gab es dort eine blühende jüdische Gemeinde. Richards Vater, Karl Joachim, stammt aus Maschau, einer kleinen Gemeinde nordöstlich von Prag, unweit des berühmten Kurorts Karlsbad. Richards Vorfahren mütterlicherseits hatten sich im ebenfalls böhmischen Kolin, 15 Kilometer östlich von Zasmuky, niedergelassen. Seit dem 15. Jahrhundert waren Juden in Böhmen ansässig. Ende des 19. Jahrhunderts umfasste die Religionsgemeinschaft dort 100 000 Mitglieder. Durch den von Hitler entfachten Vernichtungsfuror leben heute nur noch etwa 6000 Juden in Tschechien.
Die Löwys sind eine wohlhabende Familie. Anfang des 20. Jahrhunderts ziehen sie nach Wien, ihr Quartier liegt im zweiten Stock eines eleganten Mietshauses in der Sechsschimmelgasse. Die Löwys sprechen deutsch und tschechisch, den Wohnzimmerschrank zieren Bücher von Kant, Hegel und Goethe – noch in seinen verzweifelten Bettelbriefen aus dem Gefängnis wird Richard Löwy Schiller zitieren. Der Heranwachsende besucht zuerst die Realschule und dann die Wiener Handelsakademie, wo er 1903 maturiert. Ein Foto zeigt ihn mit Spazierstock, Melone und Vatermörder im Kreis seiner Kameraden. Im Jahr darauf leistet er im Artillerieregiment Nummer 2 der Hauptstadt den Militärdienst als Offiziersanwärter auf eigene Spesen ab. Offiziersanwärter dürfen damals in einem für sie reservierten Bereich der Offiziersmensa essen, im Gegensatz zu den einfachen Soldaten gelten sie als satisfaktionsfähig. 1908 schließt Richard die Ausbildung als Korporal ab. Im Dienstzeugnis wird festgehalten, dass der Aspirant bezüglich seines »Verhaltens an der Front« weiterer »Anreize« bedürfe, mit anderen Worten: Ihm fehlte die Mordlust. Nachdem sich Löwy als 23-Jähriger an der Bauingenieurschule der Technischen Universität Wien inskribiert hat, wird er 1911 als Fortifikationsfähnrich Mitglied der k. u. k. Geniedirektion in Trient. Zwei Jahre später, nach dem Abschluss des Ingenieurstudiums, ernennt man Löwy zum Fortifikationsleutnant der Reserve. Dann bricht der Krieg aus, Richard Löwy steigt zum Kommandanten der Bauleitung von Moena auf. Fieberhaft errichten die Österreicher nun befestigte Stellungen und Schützengräben am nahen Pellegrinopass, wo Österreich an Italien grenzt. Als der südliche Nachbar zum Kriegsgegner wird, erklärt Löwy viele vor der Einberufung stehende Männer als unabkömmlich. Die Frauen können in einer Schneiderei sowie einer Wäscherei, die Löwy einrichtet, etwas Geld verdienen. Löwy ist in Moena so beliebt, dass ihn die Gemeinde 1916 zum Ehrenbürger erklärt. Als der Krieg für Österreich verloren ist, kehrt Richard Löwy nach Wien zurück. 1929 heiratet er die Wienerin Johanna Liebgold, genannt Hansi, eine Pharmazeutin, wie er jüdischen Glaubens. Im März 1938 bricht für Österreichs Juden die Katastrophe herein. Was tun?
Am 16. August 1938 verlassen Richard Löwy und seine Frau die Hauptstadt. Drei Tage später treffen sie in Moena ein. Obwohl das Ehepaar völlig mittellos ist, findet es eine Unterkunft und ein Auskommen im Dorf. Da die Lage im Heimatland nicht besser, sondern immer schlimmer wird, kommen 1939 auch Richards Schwester Martha, ihr Ehemann Hermann Riesenfeld sowie Löwys an Krebs leidende Mutter Hedwig ins Fassatal. Auf die Mildtätigkeit der Dorfbevölkerung angewiesen, versuchen die Flüchtlinge, sich irgendwie nützlich zu machen: Richard kann einige Pläne zeichnen, die Frauen nähen, geben den Dorfkindern Deutschunterricht. Ein Foto zeigt die Löwys mit dem Rechen bei der Heuarbeit. Richard trägt Knickerbocker, Johanna sieht mit Kopftuch wie eine Bäuerin aus. Doch der Frieden trügt: Bereits am 14. Juli 1938 veröffentlicht die italienische Presse landesweit »Erkenntnisse« über die »italienische Rasse«: Die Italiener seien Arier. »Juden gehören nicht zur italienischen Rasse.« Es folgt eine systematische Diskriminierung, Mischehen mit Christen werden den Juden untersagt, sie dürfen nicht mehr studieren, eine ganze Reihe von Berufen wird ihnen verboten. Obwohl auch viele Juden Mitglieder der faschistischen Partei sind und der Antisemitismus in Italien weit weniger als in Deutschland und Österreich grassiert, schwenkt Mussolini auf den judenfeindlichen Kurs der Nazis ein. Am 10. Juni 1940 tritt Italien auf der Seite Deutschlands in den Krieg ein. Wenige Tage später erlässt der italienische Polizeichef den Befehl, alle ausländischen sowie »gefährliche« italienische Juden zu verhaften. Der vermeintlich sichere Zufluchtsort der Löwys erweist sich nun als Falle. Anfang Juli werden Richard und sein Schwager Hermann Riesenfeld zuerst ins Gefängnis nach Trient und dann in verschiedene Konzentrationslager in Mittelitalien verschleppt. Am Monatsende wird Johanna im Lager von Casacalenda in der Region Molise inhaftiert. In Briefen und Postkarten danken die Gefangenen für Pakete mit Brot, Butter und Kleidung, die ihnen Giorgios Tante, Valeria Jellici, schickt. »Ich denke immer an Moena und grüße dich mit unendlicher Dankbarkeit«, schreibt Ingenieur Löwy auf einer Postkarte aus dem Lager Notaresco in der Provinz Teramo. »Es sind Dinge, die nicht von uns abhängen, es ist schwierig, Geduld zu haben und auf ein Wunder zu warten«, beschwichtigt Johanna. Zwischendurch gibt es ein Aufatmen. Anfang 1942 können die Häftlinge nach Moena zurückkehren. Fotos aus jener Zeit zeigen die Verfolgten bei Ausflügen in den Bergen. Eine trügerische Idylle: Denn die Schlinge zieht sich immer enger zusammen. Um nicht aufzufallen, wechseln die Ehepaare Löwy und Riesenfeld – Mutter Hedwig ist inzwischen gestorben und auf dem katholischen Friedhof von Soraga begraben – ständig ihre Wohnung. Dabei behilflich ist ein eingeweihter Carabiniere, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. »Mich freut’s nicht mehr«, kritzelt Richard auf die Rückseite eines Fotos. Die beiden Männer verbringen ganze Tage vor dem Radio. Es sind jedoch keine guten Nachrichten, die sie hören, im Gegenteil.
Unsere Autos haben wir hinter einer Brücke geparkt, die den Avisio überspannt. Giorgio Jellici winkt mich auf einen Sprung ins Hotel Dolomiti hinein, es gehört einem Cousin, großes Hallo. Auf einem Tisch neben der Rezeption ist Jellicis Buch über Richard Löwy ausgelegt, dazu ein weiteres, das er ebenfalls geschrieben hat, über seine Tante Valeria. Als Gerber, Ladeninhaber und Hoteliers gehören die Jellici seit Generationen zu den Dorfpotentaten. Der Großvater sei früher einmal im Jahr mit den gegerbten Fellen auf einem Pferdegespann über den Karerpass nach Bozen gefahren, um die Ware dort an einen Lederwarenhändler zu verkaufen, erzählt Giorgio Jellici, als wir das Hotel wieder verlassen. Mit der Hand beschreibt er einen Halbkreis in der Luft: Der Grund rundherum habe der Familie gehört. »Hier, wo jetzt die Parkplätze sind, musste ich die Salatpflanzen meiner Tante Valeria gießen«, sagt Giorgio Jellici. Aufgewachsen ist er in Pergine, wo sein Vater eine Bank leitete. Die Ferien hat er jedoch im Haus von Tante Valeria an der Strada del Marchiò verbracht. Dort steht es beinahe unverändert. Vor dem Geschäft im Erdgeschoß wacht ein zweieinhalb Meter großer Plastikbär. Drinnen gibt es »typische« lokale Spezialitäten wie Mozartkugeln zu kaufen. Das Haus sei früher Casa D’Austria, Österreich-Haus, genannt worden, erzählt Jellici, weil hier zu Zeiten der k. u. k.-Monarchie zu Kaisers Geburtstag stets die schwarzgelbe Habsburgerfahne gehisst worden sei. Das Gebäude hätten sein Großvater und dessen Söhne mit eigenen Händen erbaut, sagt Jellici. Bis vor wenigen Jahren stand davor eine Holzbank. »Dort saßen Richard Löwy und seine Frau jeden Nachmittag und unterhielten sich mit Einheimischen. Die Leute grüßten respektvoll: ›Grüß Gott, Herr Ingenieur!‹ Man tauschte Neuigkeiten aus.« Oben im zweiten Stock habe Tante Valeria gewohnt, sagt Giorgio Jellici, legt den Kopf in den Nacken und weist hinauf auf einen verwitterten Holzbalkon. Valeria war eine ledige Schwester des Vaters. »Unverheiratet zu bleiben, war damals das Los einer Volksschullehrerin«, erklärt Jellici. Den Balkon, auf dem die Tante oft Stellung bezog, habe er Kommandobrücke genannt. Von hier aus habe Valeria nämlich auf die Straße geblickt und kontrolliert, wer von ihren Schülern spät dran war auf dem Gang zur Frühmesse. »Nicht teilzunehmen war undenkbar. Später bekamen dann einige von der Lehrerin zu hören: ›Du hast getrödelt! Du hast Dummheiten gemacht!‹ Eine außergewöhnliche Frau«, sagt Giorgio Jellici über seine Tante. Sie sprach fünf Sprachen. Englisch und Französisch hat sie als Autodidaktin gelernt. Giorgio erinnert sich an eine, wie er sagt, typische Begebenheit: Am Kriegsende, als die Amerikaner im Dorf einen Ball veranstalteten, sei auch Valeria unter den Eingeladenen gewesen. Sie schreckte aber nicht davor zurück, den Befehlshaber daraufhinzuweisen, dass die auf ein Plakat geschriebenen Worte »schlechtes Englisch« seien. »Als ich viele Jahre später mit meiner Familie in Brüssel wohnte, kam uns Valeria besuchen. Wir unterhielten uns mit einer gerade anwesenden Einheimischen auf Französisch. Als diese Bekannte einen fragenden Blick auf meine Tante richtete – wir wollten sie nicht ausschließen –, schaltete sich Valeria in der Landessprache in das Gespräch ein.« Bevor die Amerikaner im Frühjahr 1945 in seiner Heimat auftauchten, hat Giorgio Jellici den Abzug der Deutschen erlebt. »Sie fuhren in Kolonnen vorbei. Als ein Soldat von seinem Kübelwagen eine Büchse in die Menge warf, war ich der Glückliche, der sie auffing. Wir litten damals keinen Hunger. Aber in der Büchse befanden sich Würstchen, eine Köstlichkeit!« Ein paar Tage lang schmauste Giorgio Jellici lediglich Würstchen. Er kann sich nicht erinnern, ob er die Beute mit den drei Schwestern geteilt hat. Was er hingegen noch ganz genau weiß: Welchen Typ Waffe und welches Kaliber sowohl die abziehenden Deutschen als auch die amerikanischen Sieger dabeihatten. »Wir Buben stahlen von beiden Munition und bastelten daraus Raketen, die schön explodierten.«
Alte Ansicht von Moena, wo Löwy mit seiner Familie Zuflucht fand
Aber zurück zu Valeria. Kurz vor ihrem Tod 1975 habe die Tante ihn zu sich gerufen, erzählt Giorgio Jellici. »Mit den Worten: die anderen interessiere das sowieso nicht, überreichte sie mir eine Schachtel, in der sich viele handgeschriebene Briefe und gebleichte Fotos mit Zackenrand befanden.« Es handelte sich um Aufnahmen der Löwys, Fotos von daheim in Wien, vom Offizier Löwy im Ersten Weltkrieg im Fassatal und von gemeinsamen Ausflügen hier im Tal mit Valeria und anderen Getreuen. Die Briefe hatten die Löwys aus den Internierungslagern an Valeria gerichtet, ihre tapferste Helferin. Giorgio Jellici nennt sie eine Antigone: eine, die kompromisslos auf ihre innere Stimme hörte und den Verfolgten beistand. Den Nachlass ließ der beruflich voll geforderte Neffe lange Zeit unbeachtet. Als er vor zwanzig Jahren in den Ruhestand trat, öffnete er die Schachtel. »Es war, als träfe mich der Schlag.« Plötzlich seien die Erinnerungen hochgekommen. Er sah alle leibhaftig vor sich: die geliebte Tante, Richard und Johanna Löwy, das Ehepaar Riesenfeld. Giorgio Jellici glaubte, dass ihm aus der Schachtel sogar ein vertrauter Geruch entgegenströme, der Geruch des Herdfeuers, der Pilze, die er mit seiner Tante im Wald gesammelt und dann in der peinlich sauberen Wohnung am Küchentisch gereinigt hatte.
Während mir der pensionierte Jurist davon erzählt, muss er dauernd Verwandte und alte Bekannte grüßen. Er hat es im Ausland zu etwas gebracht und genießt großes Ansehen im Dorf. Seine Stimme hat Gewicht. Jellici schreibt für mehrere lokale Zeitungen, er zeigt mir einen mit rotem Kugelschreiber überarbeiteten Bericht, den er über seine Pilgerreise nach Santiago de Compostela verfasst hat. »Wenn ich mich öffentlich äußere, kritisiere ich unverblümt die hier herrschende Bauwut. Manche geben mir recht und erklären, ich hätte ausgesprochen, was ihnen am Herzen liege. Andere meinen, ich sei weggegangen und solle nun den Mund halten – aber mich gehen die Dinge im Tal immer noch etwas an.« Unterdessen marschieren wir auf der anderen Seite des Rio Costalunga zum westlichen Dorfrand hinauf. Mit steingemauerten Häusern und ausgebleichten Wellblechdächern sowie wettergebeizten, aus ganzen Baumstämmen errichteten Stadeln ist hier ein Rest der alten bäuerlichen Welt erhalten geblieben. »Von diesem Dach dort sind wir nach der Heuernte in die duftenden Haufen gesprungen«, sagt Jellici. Der alte Herr legt einen forschen Schritt vor. Er hat an einigen Marathonläufen teilgenommen. Mit sechzig kletterte er noch auf die Vajolettürme, die das Fassatal wie Rufzeichen überragen. Am Ende des Teersträßchens, das in einen Waldpfad übergeht, weist Jellici auf ein geducktes Häuschen – »Das war eine Mühle!« – sowie auf ein stattliches dreigeschoßiges Gebäude mit einer grauen, verwitterten Steinfassade: »Das schönste Haus von Moena, früher eine Schmiede.« Jellici kennt sich hier auch deshalb gut aus, weil er den rotweiß markierten Steig, der zum Karerpass führt, x-mal bergauf und bergab gegangen ist. »Mein Aufwärts-Rekord liegt bei 45 Minuten.« Bei einer Wette mit einem Freund – es ging darum, wer schneller oben sei: er zu Fuß über die Direttissima oder der Freund mit dem Motorrad außen herum über die Passstraße – habe er ein teures Schweizer Messer gesetzt, erzählt Jellici. »Ich habe knapp verloren.« Sein heutiges Ziel ist das Hotel La Romantica. Seniorchefin Mirella ist leider nicht da. »Wahrscheinlich mit dem Liebhaber unterwegs?«, fragt Jellici den Junior, einen stämmigen Kerl, von dem wir uns einen Sprizz auf der Terrasse spendieren lassen. Mit Blick über das Tal klappt Giorgio Jellici das Buch auf, das er über Richard Löwy geschrieben hat. Darin ist das Schwarzweißfoto einer jungen Frau mit kurz geschnittenen schwarzen Haaren zu sehen. Auf einem Stuhl sitzend, schmiegt sie ihr schönes, schmales Gesicht an das eines Knaben. Jellici blättert weiter bis zu einem Foto, das den feschen Richard Löwy in Offiziersuniform zeigt: »Sieht man doch, dass der Knabe auf dem Bild vorhin, er heißt Alberto und ist der Vater von Mirella, dem Ingenieur Löwy aus dem Gesicht geschnitten ist, oder?«, fragt Jellici. Der Vater der heutigen Seniorchefin des Hotels war also Richard Löwys unehelicher Sohn. Die junge Frau auf dem Bild ist Diomira Redolf. Ihr Sohn Alberto kam 1917 zur Welt – alle wussten von Löwys Vaterschaft. »Er war der Schwarm aller Mädchen, wir armen Dorfjungen hatten gegen ihn keine Chance«, berichtete später ein Zeitzeuge. Kein Wunder, dass der elegante Offizier das schönste Mädchen eroberte. Während wir über das Dorf hinunterschauen, schüttelt Jellici seinen Kopf: »Heute ist das Fassatal ein Disneyland. Ich verstehe schon, dass sich die Armen aus den Mailänder Vorstädten hier wie im Paradies fühlen. Aber das Tal ist ruiniert. Hier herrscht heute die Großmannssucht.«
Anschließend streife ich alleine durch das Dorf. Giorgio Jellici hat mir einige Adressen ins Notizbuch diktiert, Orte, wo die Löwys in den Jahren der Verfolgung ein schützendes Dach über dem Kopf fanden. Someda ist unstreitig der schönste Ortsteil von Moena, auf einem Sonnenplateau vielleicht hundert Höhenmeter über dem Avisio auf der anderen Talseite. »Nur wissen das leider viele Touristen nicht«, sagt dort die Seniorchefin der Pension Garni Sayonara, auf deren Terrasse ich einen Kaffee trinke. Rosa Tibolla, so heißt die ältere Dame, ist zum Plaudern aufgelegt. Ich zeige ihr Jellicis Buch über Löwy, darin gibt es ein Foto jenes Hauses in Someda, wo der Wiener Jude und seine Familie zuletzt gewohnt haben. Das Haus gebe es immer noch, »dort oben hinter dem Dorfbrunnen«, sagt die Wirtin. Da gerade keine anderen Gäste da sind, hängt sie einen »Komme gleich«-Zettel an die verglaste Tür ihres Lokales und begleitet mich die wenigen Schritte die Straße hinauf, vorbei an der Dorfkirche und dem steingemauerten Brunnen. Das Haus, das sie »La casa di Toni Ninzele« nennt, sieht mit der verwinkelten Außentreppe ins Obergeschoß beinahe unverändert aus wie auf dem alten Foto. »Ich selbst war nicht dabei, als an einem kalten Januarmorgen 1944 die deutschen Gendarmen die Treppe hinaufstürmten. Aber eine Nachbarin hat die Szene miterlebt«, erzählt Rosa Tibolla. Den Dorfbrunnen habe eine dicke Eisschicht bedeckt, so kalt sei es an jenem Morgen gewesen. »Als die verschreckten Juden die Treppe herunterkamen, sprang ihnen, laut bellend, Löwys Hund nach. Ein deutscher Gendarm, der die hintere Bordwand an der Ladefläche heruntergeklappt hatte, drehte sich um und schoss dem Hund mit seiner Pistole in den Kopf.«
Viehwaggons transportierten die Löwys und Riesenfelds am 26. Februar 1944 nach Auschwitz – mit demselben Transport 08 erreichte auch Primo Levi die Mordfabrik. Im Gegensatz zum Chemiker aus Turin, der seine Erlebnisse später in ergreifenden Büchern schilderte, wurden die Löwys und Riesenfelds, alt und »arbeitsuntauglich« wie sie waren, gleich nach ihrer Ankunft vergast. Ganz sicher ist ihr Ende allerdings nicht. Denn Johanna, Richard Löwys Frau, so erzählt die Wirtin, hätte Dorfbewohnern damals versichert, dass sie als gelernte Apothekerin für alle Fälle vorsorgen würde. »In einem Schmuckstück versteckt, trug sie ein tödliches Gift mit sich. Sie wird im richtigen Moment entschlossen gehandelt haben.«