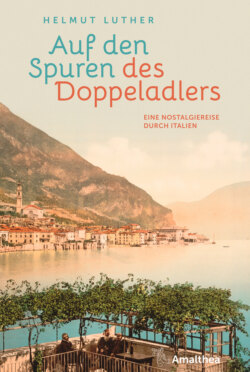Читать книгу Auf den Spuren des Doppeladlers - Helmut Luther - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Land der Träume Eine Italienreise auf den Spuren der österreichischen Geschichte Vorwort
ОглавлениеWie jedes Südtiroler Kind der 1960er-Jahre bin ich mit patriotischer, also austrophiler Milch genährt worden. Noch heute kann ich zumindest die erste Strophe des Prinz-Eugen-Liedes auswendig herunterschmettern. Ich erinnere mich noch genau an die pathetische Stimmung, als ich einmal mit meinem Vater an der Andreas-Hofer-Feier teilnahm, die jährlich an dessen Todestag, dem 20. Februar, vor dem Denkmal gegenüber dem Bahnhof von Meran stattfindet: Gänsehaut, als alle strammstanden und aus Hunderten Kehlen das Andreas-Hofer-Lied erscholl. Nervös-grimmige Mienen seitens der Carabinieri, die die Feiernden »beschützten«. Es waren die Bombenjahre, als manche Südtiroler die Rückkehr zu Österreich mit Gewalt erzwingen wollten.
Mit den Nachbarsbuben, die jeden Nachmittag mit uns auf einem brachliegenden Acker Fußball spielten, verständigten wir uns hingegen in einem Gemisch aus Südtiroler Dialekt und Standard-Italienisch. Streit gab es allenfalls über ein böses Foul, nie über ein böses Wort seitens der »Walschen« oder der »Crucchi«, wie die abwertenden Begriffe der einen über die anderen lauteten. Da waren auch Antonietta und Agnese, Mitarbeiterinnen im Geschäft meiner Mutter, Erstere aus Apulien, die Zweite aus Sardinien stammend, die mich, eben richtige italienische Mammas, als Kind mit Inbrunst verhätschelten. Meine Mutter wurde von ihren Cousins Elena gerufen, ihre Vatersprache war Italienisch. Ich merkte also früh, dass an der Schwarzweißmalerei, mit der uns patriotisch entflammte Erwachsene zu guten Südtirolern erziehen wollten, etwas nicht stimmen konnte. Hier die braven Deutschsprachigen, dort die bösen Italiener, die uns das Südtiroler-Sein austreiben wollten: So einfach war es nicht. Viele, die ich aus nächster Nähe kennenlernte, waren ausgesprochen nett, warmherziger und liebenswerter als mancher deutschsprachige Südtiroler. Als ich zu reisen und schreiben anfing, festigte sich die Erkenntnis, dass, was Politiker gerne trennen, in Wahrheit auf vielfältige Weise verbunden ist. Jahrhundertelang gehörten große Teile Italiens zum Habsburgerreich. Streift man heute durch die Toskana, Venetien oder die Lombardei, trifft man an jeder zweiten Ecke auf altösterreichische Relikte. Die Bildergalerie von Prinz Eugen ziert die Galleria Sabauda in Turin – er selbst verfügte, dass sein Herz in der Stadt am Po ruhen solle. Josef Maria Auchentaller, neben Klimt der wichtigste Künstler der Wiener Secession, verbrachte den größten Teil seines Lebens in Grado und nahm die italienische Staatsbürgerschaft an. In einem Dorf bei Viareggio werden Edelsteine aufbewahrt, ein Geschenk der späteren Kaiserin Zita, die dort geboren wurde. Apropos Kaiserin: Wirklich jeder, mit dem ich während der Recherchen zu diesem Buch in einer Bar einen »Sprizz« (ein Lehnwort aus der Habsburgerzeit) trank, setzte, sobald das Stichwort »Maria Theresia« fiel, zu einer Lobeshymne auf ihre Reformtätigkeit an. Für mich ist es stets eine Freude, wenn ich in einem Winkel Italiens auf eine Spur stoße, die nach Österreich führt – nicht, um zu vereinnahmen, sondern wegen des beglückenden Gefühls der Gemeinsamkeit. Und taugt schließlich die zur Staatsräson erhobene Weisheit der Habsburger, »Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate!«, nicht immer noch als Anleitung für ein gedeihliches Miteinander der Völker? Als Südtiroler weiß ich Bescheid: Genau genommen sind wir lebendige Brücken zwischen »Bella Italia« und dem nördlichen Nachbarland. Wir glauben, von beiden Seiten das Beste abgeschaut zu haben – ob es wahr ist, steht auf einem anderen Blatt.