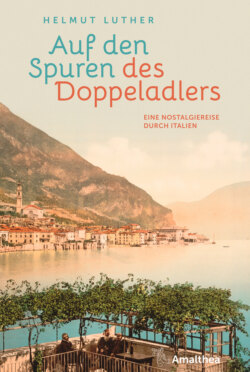Читать книгу Auf den Spuren des Doppeladlers - Helmut Luther - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der steirische Prinz und die Bürgerstochter Schenna, Südtirol
ОглавлениеFortschrittlich, inspiriert von den Ideen der Aufklärung, der Hofkamarilla ein Dorn im Auge: Erzherzog Johann war ein schwarzes Schaf in der Familie der Habsburger. Seine Liebesheirat mit der Postmeisterstochter Anna Plochl hat ihn zum Märchenprinzen gemacht.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass einen der Schlossherr persönlich durch sein Reich führt. Franz Graf Spiegelfeld, kräftige Statur, blaue Augen und eine eckige Brille, ist sich dafür nicht zu schade. Am Montag, wenn Schloss Schenna für Besucher gesperrt ist, habe er Zeit für eine Privatführung, bot mir Graf Spiegelfeld per E-Mail an. »Um halb zehn Uhr am Haupttor an der steinernen Brücke!« Da ich – wie immer – früher dran bin, drehe ich eine Runde durch das gleichnamige Dorf am Fuß von Schloss Schenna, wo sich Hotelklötze mit über die Balkone quellenden Geranien aneinanderreihen. Zurück beim Schloss, fallen mir im zugeschütteten Graben unter der steinernen Bogenbrücke knorrige Apfelbäume mit winzigen rotbackigen Äpfeln auf. Ein Mann, den ich zunächst für den Gärtner halte, sammelt die heruntergefallenen Früchte in einem runden Kunststoffeimer. »Daraus machen wir naturtrüben Apfelessig – die einzige Möglichkeit, mich zum Salatessen zu bringen«, erklärt der Mann, nachdem er mich mit Handschlag begrüßt hat. Der »Gärtner« – Pardon, Graf Spiegelfeld – trägt kurze Hosen und klobige Bergschuhe. Sein honiggelbes Polohemd ist mit tintenfarbenen Flecken übersät. Der Graf hat nicht beim Salatessen gekleckert, er steckt mitten in der Holunderbeerenernte. »Wir sind Südtirols größte Holunderbauern«, sagt Franz Graf von Spiegelfeld – und klingt dabei ziemlich stolz.
Franz Graf Spiegelfeld und seine Gattin Johanna Gräfin Meran, Urururenkelin von Erzherzog Johann
Landwirtschaftliche Experimente sowie ein unkonventionelles Auftreten haben auf Schloss Schenna Tradition. Graf Spiegelfelds Vorgänger Erzherzog Johann, genauer: der Urururgroßvater seiner Frau Johanna Gräfin Meran, hatte Schloss Schenna gekauft. Im Mausoleum unter dem Schloss wurde der »steirische Prinz« begraben. Der Erzherzog habe auf den schlosseigenen Äckern neue Getreidesorten anpflanzen lassen, sagt Graf Spiegelfeld. »Er war der Lieblingsfeind des allmächtigen Metternich.« Über eine verwinkelte Steintreppe – »Bitt’ schön, nach Ihnen!« – lotst mich der Graf in ein Turmzimmer mit Butzenscheiben und einem barocken Kachelofen. Dort sitzen wir uns an einem massiven dunklen Holztisch gegenüber, wo der gebürtige Steirer Bücher und Broschüren über Erzherzog Johann und Schloss Schenna ausgebreitet hat. Gar zu luxuriös solle ich mir das Schlossleben nicht vorstellen, sagt Graf Spiegelfeld, »schon gar nicht 1845, als Erzherzog Johann es erwarb. Im Kaufvertrag ist von sechs beheizbaren Zimmern die Rede«. Wie Erzherzog Johann und seine Familie hierherkamen? »Da muss ich etwas ausholen«, sagt mein Gastgeber und lehnt sich, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, in seinem Stuhl zurück.
Als Johann Baptist Josef Fabian Sebastian wurde das 13. Kind – und neuntgeborener Sohn – des Großherzogs der Toskana Peter Leopold und Maria Ludovicas von Spanien 1782 in Florenz getauft. Pietro Leopoldo, wie sein Vater, der »aufgeklärte Fürst«, in Italien heißt, hat die Toskana in einen modernen Musterstaat verwandelt. 122 Jahre herrschten die Habsburger über das Herzogtum. Als Kaiserin Maria Theresia 1739 mit ihrem Gatten Franz Stephan in Florenz einzog, von der Bevölkerung auf einer Triumphpforte schmeichlerisch als »Mehrer der schönen Künste und Förderer des Handels« gerühmt, war der Glanz der Medici längst verblasst. Die Toskana war zu einem Armenhaus heruntergekommen. Peter Leopold trat seine Herrschaft 1765 an. Als Nachfolger seines Bruders Joseph II. sollte er 1790 als Leopold II. den Kaiserthron in Wien besteigen. – Zuvor jedoch führte er im Großherzogtum einige grundlegende Reformen durch: Er verzichtete auf ein stehendes Heer, schaffte die Binnenzölle ab, entsumpfte die malariaverseuchte Maremma, gewährte den Gemeinden eine autonome Verwaltung und zwang die Feudalherren, lastenfrei Land in Erbpacht an verarmte Bauern abzugeben. »Ich glaube, dass der Souverän … nur der Delegierte des Volkes ist«, erklärte er 1789, im Jahr der Französischen Revolution. Wenn der Herrscher nicht zum Wohl des Volkes wirke, sei dieses nicht mehr zu Gehorsam verpflichtet. Es muss also nicht verwundern, dass Johanns Taufpaten weder ein Kardinal noch ein Fürst waren, sondern ein namenloser Kapuzinerpater und ein Handwerker aus dem Stadtviertel Santa Felicità. Sohn Johann hat den Reformgeist seines Vaters geerbt. Die ersten acht Lebensjahre verbrachte er im Palazzo Pitti, wo Französisch und Italienisch gesprochen wurde. Deutsch und Latein kamen später hinzu. »Unaufhörliches Fortschreiten … des einzelnen, jedes Staatsvereines, der Menschheit« solle das Ziel jeder Herrschaft sein, erklärte der junge Prinz in seinem »Glaubensbekenntnis«. Vergleicht man diese Ideen mit der Haltung des älteren Bruders Franz, der 1792 als Kaiser Franz II./I. den Thron bestieg und sich selbst aufforderte: »Regiere und verändere nichts!«, könnte man leicht ins Grübeln geraten. Was hätte es für die Habsburger und die Welt bedeutet, wäre der jüngere Johann und nicht der Älteste, Franz, Kaiser geworden? »Er hasste das Hofleben und ließ sich im Schönbrunner Schlosspark einen ›Tirolergarten‹ mit einem hölzernen Bauernhaus errichten. Dieses möblierte er stilecht mit Bauernschränken, rundherum pflanzte er Alpenblumen«, erzählt Graf Spiegelfeld. Der Erzherzog habe zeitlebens zwischen zwei Welten gelebt: Hier die Hocharistokratie mit ihrem Hochmut und selbstverständlichen Privilegien. Dort die Welt der Bürger, Bauern und Senner, zu der es ihn hinzog. »Im Geist von Rousseaus ›zurück zur Natur‹ idealisierte Erzherzog Johann das einfache Leben«, meint Graf Spiegelfeld. Der Erzherzog habe Tirol und die Steiermark, wo er gewissermaßen im Exil lebte, aufrichtig geliebt. Die Zuneigung sei erwidert worden. Dieser Liebe auf Augenhöhe haben Tirol und die Steiermark sehr viel zu verdanken. Dass Johann außerdem über alle Standesschranken hinweg Anna Plochl, die Tochter eines Postmeisters, geheiratet hat, ließ ihn endgültig zum Märchenprinzen werden, zum Helden des Volksliedes und später des Kinos. In Geliebter Johann – Geliebte Anna mit Tobias Moretti als Erzherzog wurde der Stoff 2009 für das ZDF verfilmt. Dass er selbst gerne einen Lodenjanker trage, wie auch der selige Kaiser Franz Joseph I. und viele Standesgenossen, führt Graf Spiegelfeld auf das Vorbild Erzherzog Johanns zurück. »Er war ungeheuer populär. Heute würde man ihn einen Star nennen, einen Liebling der Klatschpresse.«
Bevor wir uns der Liebesgeschichte mit der Bürgerstochter widmen, müssen wir uns noch mit dem Soldaten, dem Politiker, Reformer und Intellektuellen beschäftigen, der sich für die Künste und Wissenschaften interessierte. Wir sind noch immer im Turmzimmer von Schloss Schenna. Mein Gastgeber hat mich ans Fenster geführt. Im Westen sieht man auf einem Moränenhügel Schloss Tirol, im Norden schlängelt sich die Passer als smaragdfarbener Wurm durch das Passeiertal: zwei Orte, denen sich der Erzherzog verbunden fühlte, sagt Spiegelfeld. Schloss Tirol ist die Stammresidenz der Grafen von Tirol, dort habe sich damals der älteste beinahe vollständig erhaltene gotische Flügelaltar des Alpenraumes befunden. Erzherzog Johann vermachte ihn als persönliches Geschenk dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck, das auf seine Initiative hin entstand. »Und da hinten im Passeiertal lebte Andreas Hofer, der Held des Tiroler Volksaufstandes von 1809, den Erzherzog Johann mit vorbereitete. Hier auf unserem Schloss hüten wir die größte private Andreas-Hofer-Sammlung.« Andreas Hofer und Erzherzog Johann: Beide verband ein tiefer Glaube. Und beide waren Idealisten, die zwischen die Mühlen der Realpolitik gerieten. Der Sandwirt aus dem Passeiertal sollte für seine Überzeugungen mit dem Leben bezahlen. »Eine tragische G’schicht, die dem Erzherzog sehr naheging«, sagt Graf Spiegelfeld.
Schloss Schenna oberhalb von Meran
Politisch führt uns »diese G’schicht« in die Zeit Napoleons. An den Kämpfen und Niederlagen der Habsburger gegen den korsischen Emporkömmling beteiligte sich Erzherzog Johann als General der Kavallerie. Seit 1801 Generaldirektor des Genie- und Fortifikationswesens, war Johann für die Errichtung von Festungen in Tirol und im südlichen Etschtal verantwortlich. Er war es, der den Ausbau des Quadrilatero, des Festungsvierecks Verona, Peschiera, Mantua und Legnago, vorantrieb. Hier in Schloss Schenna laufen also einige Fäden zusammen: Mit dem Preßburger Friedensvertrag fiel Tirol an das mit Napoleon verbündete Bayern. Wie es weiterging, ist bekannt: Da gibt es einen Brief des Erzherzogs an den Tiroler Bauernführer Hofer, in dem er diesem versichert, dass »entscheidende Streiche geschehen« würden. »Schreibt mir, wenn Ihr wünscht, an Offizieren zu haben, damit ich Euch jene schicken kann … sonst auch, was Ihr braucht.« Es gibt die verzweifelten Hilferufe des gescheiterten Bauernführers, der sich auf der Pfandler Alm verstecken musste – beinahe in Sichtweite von Schloss Schenna. »Der arme verlassne Andre Hofer« unterzeichnete der Sandwirt seinen Bettelbrief aus dem Versteck. Dass der gefangene Hofer schließlich in Mantua hingerichtet wurde – nach höchst zögerlichen Rettungsversuchen seitens des offiziellen Wiens, habe Erzherzog Johann als persönliche Niederlage empfunden. »Er fühlte sich schuldig. Der Bauernführer aus dem Passeiertal wurde auch aus Treue zu ihm hingerichtet. Der Erzherzog verfiel damals in Depressionen und zog sich enttäuscht zurück«, erzählt Graf Spiegelfeld.
Lange dauerte der Rückzug allerdings nicht. Mit der sogenannten »Alpenbund-Affäre« 1812/13 stürzte sich der Erzherzog erneut in die große Politik: Wieder ging es um einen geplanten Aufstand der Tiroler gegen Napoleon. Erzherzog Johann unterstützte die Verschwörer, doch ein eingeschleuster Spitzel verriet die Pläne, woraufhin einige Verantwortliche zu langer Festungshaftverurteilt wurden. Erzherzog Johann wurde von seinem Bruder, Kaiser Franz II./I., verboten, Tirol je wieder zu betreten – hinter den Kulissen agierte der allmächtige Staatskanzler Metternich, der im liberalen Erzherzog den gefährlichsten Gegner seines Polizeistaates erblickte. »Das Verbot blieb zwanzig Jahre lang aufrecht – und wurde dann durch einen Gnadenakt des Kaisers aufgehoben. Es ist auch der Grund, warum der Erzherzog in der Steiermark tätig wurde«, erzählt Spiegelfeld. Alles, was er dort geleistet habe, etwa die Gründung der Steiermärkischen Sparkasse und der Grazer Wechselseitigen Versicherung, die Errichtung landwirtschaftlicher Musterbetriebe sowie die Förderung der Industrie, habe Erzherzog Johann ursprünglich in Tirol schaffen wollen. Als er das Land 1833 endlich wieder betreten durfte, begann er auch hier sofort als Erneuerer und Reformer zu wirken. »Mit der Alpenbundaffäre manövrierte sich Erzherzog Johann definitiv ins politische Abseits, wobei die Anschuldigungen, dass er sich etwa als ›Rätischer König‹ ausrufen lassen, also Verrat am Kaiserhaus begehen wollte, völlig absurd waren«, sagt Graf Spiegelfeld. Man merkt, dass ihn dieses Thema auch nach 200 Jahren nicht gleichgültig lässt, schließlich geht es um die Ehre eines Familienmitgliedes. Apropos Ehre: Ein Nachkomme des damaligen Denunzianten besichtige heute regelmäßig mit Reisegruppen Schloss Schenna. »Wenn wir uns begegnen, hält er sich immer, wie in tiefster Scham, die Hände vor das Gesicht. – Ist aber natürlich alles nur Show.« Doch zurück zum Erzherzog. Um ihn und sein Weltbild zu verstehen, müsse einem klar sein, dass seine Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus bis zur Selbstaufgabe ging, sagt Graf Spiegelfeld. Das verdeutliche Johanns Verhalten gegenüber seiner Lebensliebe Anna Plochl: Er habe sie unbedingt heiraten wollen – aber nur mit dem Segen des Kaisers. Dieser stimmte aber zunächst nur einem für beide Seiten unwürdigen Verhältnis zu – Anna Plochl musste offiziell als Hauswirtschafterin am Brandhof in der Steiermark leben. »Der Erzherzog hielt sich strikt an die Vorgaben: keine Intimitäten! Und stieß damit Anna, die dieses Verhalten natürlich nicht verstehen konnte, vor den Kopf. Sie hat wegen dieser Liebe viel mitmachen müssen!«
Der Kies knirscht unter unseren Füßen, als wir den Schlosshof überqueren. In der Mitte breitet eine stattliche Linde ihre Schatten spendenden Äste aus. Ringsum führen Treppen, feucht schimmernde Bogengänge und eisenbeschlagene Türen in das Schlossinnere. Drinnen erstreckt sich ein weiteres Labyrinth aus Treppen, Durchgängen und Sälen, deren kostbares Interieur Neid auf adelige Schlossbesitzer wecken könnte. Da ist etwa der Renaissance-Rittersaal mit einem herrlichen Fayenceofen sowie eine große historische Waffensammlung. An den Wänden hängen Gemälde und Ahnenporträts. Alltagsgegenstände wie das Tafelservice sowie ein massives Ehebett mit Nachttopf stammen aus der Zeit, als Erzherzog Johann hier Schlossherr war. Aufgehalten, gibt Graf Spiegelfeld zu, habe sich der Prinz hier allerdings kaum. »Er war ein Getriebener, ein Workaholic, würde man heute sagen, der von Projekt zu Projekt eilte und eigentlich kein Zuhause hatte.« Warum Schloss Schenna im Gegensatz zu anderen Adelssitzen in Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg nicht leer geräumt wurde, kann sich Graf Spiegelfeld nur mit dem Weitblick des Erzherzogs erklären: Er habe die Schätze, als sich die österreichische Niederlage abzeichnete, rechtzeitig nach Innsbruck geschafft. Als Südtirol dann an Italien fiel, habe in der Region ein großes Plündern eingesetzt. Mit den gestohlenen Schätzen vieler anderer Adelssitze schmückten sich heute Schlösser und Museen in Italien. »Im Castello del Buonconsiglio in Trient etwa kann man die Flügel des Dreikönigsaltars aus dem nahe von hier gelegenen Burgstall bewundern, ein Werk von Bartlmä Dill Riemenschneider, einem Sohn des großen Tilman Riemenschneider. Dass es sich um Raubkunst handelt, sagt einem keiner!«
Erzherzog Johann, hier mit Frau Anna und Sohn Franz, verfügte testamentarisch, in Tiroler Erde bestattet zu werden.
Grandios ist der Blick aus dem Rittersaal über den Meraner Talkessel. Man hat das Gefühl, auf der Kommandobrücke eines Ozeandampfers zu stehen und durch grün wogende Hügel zu manövrieren. Er könne schon verstehen, warum Erzherzog Johann Südtirol geliebt hat, sagt Graf Spiegelfeld: »Es ist ein gesegnetes Land.« Um zu beweisen, wie ernst es dem Erzherzog mit seiner Tirol-Begeisterung war, erzählt mein Gastgeber eine Anekdote: Um 1830, als er noch nicht wissen konnte, dass das kaiserliche Verbot, Tirol je wieder zu betreten, aufgehoben würde, sei der Erzherzog auf der Pasterze, dem größten Gletscher der Ostalpen, am Großglockner herumgeklettert. Eines Nachts sei der hohe Gast nach Kals in Osttirol abgestiegen. »Dabei klaubte er ein bisschen Tiroler Erde zusammen und steckte sie in einen Lederbeutel.« Den Satz aus dem Tagebuch Erzherzog Johanns zitiert Graf Spiegelfeld auswendig: »Damit auf dieser (Erde) einst mein Haupt im Grabe ruhe.« Genau so sei es dann gekommen. Im Juni 1869, zehn Jahre nach seinem Tod, wurde Johanns Leichnam vom Grazer Dom, wo er vorläufig bestattet war, in das Mausoleum nach Schenna überführt. »Seinem Wunsch gemäß mitsamt dem Beutel und der Großglockner-Erde«, erzählt Graf Spiegelfeld.
Treibende Kraft bei der Errichtung des Mausoleums war Anna, die Witwe des Erzherzogs. Das älteste Kind des Postmeisters Jakob Plochl aus Aussee im steirischen Salzkammergut war 15 Jahre alt, als sie den Erzherzog im Sommer 1819 bei einem Jagdausflug zum ersten Mal sah. Der Erzherzog, der schon als junger Mann seinem Tagebuch anvertraute, nur eine Frau heiraten zu wollen, der er »als Mensch zugetan sei, nicht als Fürst«, und das einfache Mädchen, welches nach dem frühen Tod der Mutter die zwölf kleineren Geschwister versorgte: eine verdammt kitschige Geschichte. Ungeachtet aller Widerstände, Intrigen und Rückschläge hielt das Paar an seiner Liebe fest. Dass sich der um 22 Jahre ältere Erzherzog in das Mädchen, das er seine »Nanni« nannte, unsterblich verliebte, leuchtet ein, wenn man ein Porträt betrachtet, das Anna in jungen Jahren zeigt: große, dunkle, mandelförmige Augen, ein zartes, schmales Gesicht, umrahmt von schwarzen, nach hinten gebundenen Haaren. Der Kopf sitzt, leicht geneigt, auf einem Schwanenhals. Eine Mätresse, Konkubine, mit der der Erzherzog Kinder zeugen würde, das wäre für den Kaiserhof kein Problem gewesen – teure Eskapaden wurden großzügig geduldet. Aber Heiratspläne? Ich sehe seinen Bruder, den Kaiser, vor mir, als ihm Johann seine Heiratspläne eröffnete: Der Kaiser erstarrt. An seiner Schläfe unter den früh ergrauten Haaren tritt eine geschwollene Ader hervor. Das asketische Gesicht wirkt noch griesgrämiger, als es der jüngere Bruder ohnehin schon kennt. »Die Hochzeit der Anna mit dem Erzherzog, nach endlosem Warten heimlich um Mitternacht mit zwei oder drei Gästen in einer Kapelle gefeiert, war eine traurige Angelegenheit«, sagt Graf Spiegelfeld. Er zeigt auf eine Fotografie der alten Anna Plochl, die auf Johanns Betreiben zuerst zur Freifrau von Brandhofen und später zur Gräfin von Meran geadelt wurde. Die Witwe des Erzherzogs, umhüllt von einem Berg aus Röcken und Umhängen, sieht müde und abgekämpft aus: eine verhärmte, früh gealterte Frau, der keiner mehr etwas vormachen kann. Man müsse sich vorstellen, welchen Demütigungen Anna Plochl seitens ihrer hochadeligen Verwandtschaft ausgesetzt war, sagt Graf Spiegelfeld. »Sie durfte nie zum Kaiserhof in Wien. Einmal traf man sich zufällig in Bad Aussee – wie werden die Leute da getuschelt haben, als alle der eingeheirateten Bürgerstochter die kalte Schulter zeigten!«
Vom Rittersaal schweift der Blick hinunter zum Kirchhügel. Links erhebt sich die gotische Pfarrkirche mit dem Friedhof, rechts, Richtung Meran, ragt aus rotem Sandstein mit Spitztürmchen und Rosettenfenster die neugotische Grabkapelle für den Erzherzog empor. In verzierten Marmorsarkophagen unter dem Kreuzrippengewölbe der Krypta ruhen außer dem Erzherzog auch seine Frau, die ihn um 26 Jahre überlebte, sowie der gemeinsame Sohn Franz und dessen Gattin. Zur Grabstätte ist es vom Schloss ein Katzensprung, vorbei am zugeschütteten Burggraben und der Pfarrkirche mit dem Dorfplatz. Schenna ist ein touristischer Hauptort Südtirols. Mehr als eine Million Übernachtungen werden hier jährlich gezählt. Während der fünf Gehminuten hinunter zum Mausoleum, inmitten leicht bekleideter, nach Sonnencreme duftender Gästescharen, festigt sich mein Eindruck, dass Schenna kein Urlaubsort für eingefleischte Individualisten ist – so hat sich der die Bergeinsamkeit liebende Erzherzog seine letzte Ruhestätte vermutlich nicht vorgestellt. Von Dienstag bis Freitag kann die Grabkapelle um ein paar Euro besichtigt werden. Karl, 92-jährig, mit Filzhut auf dem Kopf, steht am Eingang und kassiert. Er besuche den treuen Gehilfen stets zu Weihnachten in seinem Haus hier in Schenna, erzählte mir vorhin Graf Spiegelfeld. Auch im vergangenen Jahr habe er es so gehalten – dabei wollte er ausloten, wie es mit ihm und Karl weitergehen könne. Karl hatte sich nämlich mitten in der Saison eine Lungenentzündung zugezogen, diese aber nicht auskuriert, weil ihn ja keiner als Wärter in der Grabkapelle ersetzen könnte. »Es sah nicht gut aus um Karl. Er wirkte schmal und gebrechlich. Als ich ihn fragte, ›Karl, packen wir es im nächsten Jahr wieder?‹, sprang er auf und bejahte mit einem Strahlen«, erzählte Graf Spiegelfeld. Ich weiß also einiges, als ich am Eingang der Grabkapelle stehe und versuche, mit Karl ins Gespräch zu kommen. Aber der alte Mann erweist sich als skeptisch. Er werde mir überhaupt nichts sagen, nicht einmal seinen Nachnamen, erklärt er mit einem strengen Blick auf mein Notizbuch. Auf meine weiteren Fragen, obwohl unüberhörbar im hiesigen Dialekt gestellt, antwortet der Alte stur in einem gekünstelten Hochdeutsch. »Noch nicht verdorben, ehrlich und gescheit«, fand Erzherzog Johann die Tiroler und sprach in Bezug auf das Land und seine Menschen von einer Liebe, »welche ich in das Grab mitnehmen werde«. Der treue Karl, der sich von mir nicht wie eine Zitrone auspressen lassen will, wäre ein Mann ganz nach dem Geschmack von Erzherzog Johann.
Die Grabstätte Erzherzog Johanns und seiner Frau Anna Plochl unterhalb von Schloss Schenna
Zum Kauf von Schloss Schenna und anderer Güter in der Steiermark kam es, weil sich die heikle Finanzlage des Erzherzogs dank einer Erbschaft von 200 000 Gulden, umgerechnet rund drei Millionen Euro, schlagartig verbesserte. Johanns Onkel, Herzog Albert von Sachsen-Teschen, hatte sich nach dem Tod seiner Gattin Marie Christine, der Lieblingstochter Maria Theresias, in sein Wiener Palais zurückgezogen, um sich nur mehr seiner großartigen Kunstsammlung zu widmen – der heute weltberühmten Albertina. Es gibt eine weitere familiäre Verbindung, die deutlich macht, in welch engem Zirkel die Hocharistokratie sich bewegte: Marie-Louise, älteste Tochter von Kaiser Franz II./I., die nach dem Wiener Kongress als Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla in der oberitalienischen Poebene eingesetzt worden war, hatte dort unter Anleitung ihres aus Wien mitgebrachten Zeichenlehrers Matthäus Loder zahlreiche Aquarelle geschaffen. Im Museo Glauco Lombardo von Parma, wo einige Originale von der Hand der Herzogin hängen, konnte ich mich von ihrem Talent überzeugen. 1816 wandte sich Marie-Louise mit einer Bitte an ihren Lieblingsonkel Erzherzog Johann: Er möge den geschätzten Mallehrer, der das feuchtheiße Klima der Poebene nicht vertrug und an Malaria erkrankt war, in seine Dienste nehmen. Der Onkel geruhte. Und so begleitete ihn Loder ab 1816 als Kammermaler auf seinen Reisen und Bergtouren in der Steiermark. Er wurde zum Chronisten der Begegnung zwischen dem Erzherzog und Anna Plochl. In romantischen Bildern hat er diese Liebe gefeiert. Vor allem aber hielt Loder in Aquarellen und Zeichnungen die alpine Landschaft fest, die Arbeit der Bergbewohner, ihre Häuser, ihre Trachten und Vergnügungen. Seine Bilder von stäubenden Wasserfällen, wild zerfurchten Gletscherzungen, Ruinen, idyllischen Städten mit Brunnen, die unter Lindenbäumen plätschern, sowie spektakulären Gebirgspässen befinden sich noch heute im Besitz der Grafen von Meran. »Da war auch Glück im Spiel – unter den Nationalsozialisten gab es Pläne, die Sammlung zu beschlagnahmen und als Geschenk der Steiermark dem Führer zu überreichen«, hat mir Graf Spiegelfeld erzählt.
Inzwischen ist es Nachmittag, der Graf unterstützt wieder die Arbeiter bei der Holunderernte. Um Schloss Schenna wirtschaftlich auf eine solide Basis zu stellen, kaufte Erzherzog Johann noch den Thurnerhof mit Äckern und Wiesen dazu. Der Hof liegt etwas oberhalb des Dorfes Richtung Passeiertal. Mit dem Auto geht es weiter bergauf, vorbei an einer efeuumrankten Totenkapelle und am Hotel Erzherzog Johann. Beidseitig der Straße stehen Obstbäume Spalier, teilweise zum Schutz vor Hagel unter Nylonnetzen. Auf selbstfahrenden Hebebühnen, die sich mit einem Hebel steuern lassen, stehen die Pflücker und zupfen rot und gelb leuchtende Äpfel von den Bäumen. Auch zum Thurnerhof gehören heute Obstwiesen. Das jahrhundertealte Gemäuer mit rotweiß bemalten Fensterläden, einer holzvertäfelten Stube und rußigen Selchküche, wo es nach Wurst und Speck riecht, wird von jahrhundertealten Edelkastanien flankiert. Die Methusalem-Bäume breiten ihre mannsdicken Äste wie schützend über dem Dach des Bauernhauses aus. Vor Jahrzehnten, als er mit seiner Frau Schloss Schenna und den Thurnerhof als Verwalter übernahm, habe er von der Landwirtschaft keine Ahnung gehabt, gesteht Graf Spiegelfeld. »Ich wusste nur, dass Äpfel rund sind – dunkel schwante mir, dass ich mich auf ein arbeitsreiches Abenteuer einlasse.« Der Urururgroßvater seiner Gattin habe auf dem Thurnerhof mit damals für Tirol neuen Weinsorten, Riesling und Blauburgunder, experimentiert. »Er führte auch die moderne Anbaumethode auf Drahtrahmen ein.« Graf Spiegelfeld geht heute neue Wege. Außer ihm pflanzt weit und breit keiner Holunder an, um aus den Beeren Schnaps zu brennen. Die mit dunkelvioletten Früchten behangenen Büsche wachsen an einem leicht ansteigenden Hang ober dem Bauernhaus. Mit einer Schere werden die reifen Früchte abgeschnitten und in ein blaues Plastikfass geworfen. Darin vergärt die Maische unter einem Deckel mit Spund. »Dass dies zügig geschieht, ist das Wichtigste, die Früchte müssen ohne Stiel geerntet werden, um unerwünschte Bitterstoffe fernzuhalten«, erklärt der Graf, während er eine Biene von einem Holunderfleck auf seinem Hemd wischt. Den Holunderbrand, der ein wenig nach Gras und Moos duftet und feurig den Rachen hinunterrinnt, verkauft Graf Spiegelfeld in Apothekerfläschchen um 38 Euro das Stück. Ein stolzer Preis. Der Graf winkt jedoch ab. Nein, reich werde er hier auf Schloss Schenna bestimmt nicht. Es gehe um etwas anderes: Das Familienerbe so zu bewirtschaften, dass auch noch die nächste Generation Freude daran findet.
Auf dem Retourweg komme ich noch einmal an Schloss Schenna sowie dem Mausoleum vorbei. Letzteres, erzählte vorhin Graf Spiegelfeld, habe Anna Plochl als viel zu groß empfunden. »Sie meinte, dass darin sogar der Petersdom Platz fände.« Die Gattin des Erzherzogs drückte sich auch sonst ziemlich unverblümt aus. Während ich die von Hotelburgen gesäumte Hauptgasse entlangfahre, halte ich unter den Touristenheeren nach Einheimischen Ausschau, dabei inspiziere ich unauffällig ihre Waden. In einem Brief an ihren Sohn Franz, der als Offizier in Innsbruck stationiert war, schrieb Anna Plochl nämlich: »Bitte verzeih mir Schrift und Feder, beide sind so dick wie die Schenner Waden.«