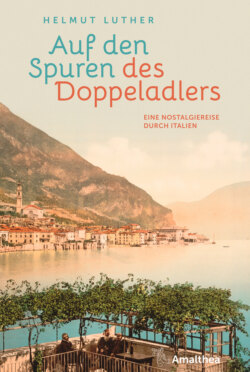Читать книгу Auf den Spuren des Doppeladlers - Helmut Luther - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tolstois Apfelbäume San Michele, Nonstal, Trentino
ОглавлениеJeder zweite in Italien verkaufte Apfel reift im Nonstal, nördlich von Trient, heran. Das liegt auch an den Verdiensten Edmund Machs, des Gründers des Agrarinstituts von San Michele.
Matteo Corazzolla wollte eigentlich Profimusiker werden. Der Endzwanziger mit dunklem Wuschelkopf studierte am Konservatorium von Trient Schlagzeug und Klavier, er spielte in mehreren Bands und erteilte Musikunterricht an Privatschüler. Bis zu jenem schrecklichen Morgen im Jahr 2007, als die Familie seinen Bruder Samuele tot im Bett auffand – ein plötzlicher Herzstillstand mitten in der Lebensblüte. Samuele, der Ältere, sollte später die von den Eltern aufgebaute Bierbrauerei und Apfelweinkellerei in Tres, einem Ortsteil von Predaia im Nonstal, übernehmen. »2007 war ein schwarzes Jahr, auch der leitende Angestellte unserer Firma verstarb damals an Krebs – ich entschloss mich, vorübergehend als Krisenhelfer einzuspringen«, erzählt Matteo, der heute die Firmengeschicke als Kellermeister lenkt. An das frühere Leben erinnern inzwischen nur mehr sein Hipster-Bart sowie eine beeindruckende, im Obergeschoß vor den Büroräumen aufgereihte Sammlung verschiedener Musikinstrumente. Der Familienbetrieb brummt, demnächst wollen die Corazzollas erweitern. In den Kellerräumen, wo der Duft von Vergorenem in der Luft schwebt, hantiert Matteo an Edelstahl-Fässern und wird dabei von einem Rabbiner aus Israel – er hat koscheren Apfelweinessig bestellt – streng beäugt. Vater Bruno erzählt im angebauten Restaurant bei Spätzle mit Apfelschnitten und Speck, wie es zum Erfolg des Unternehmens gekommen ist. Zum Aperitif reicht er Apfelwein mit Ingwernote – schmeckt interessant, muss man aber nicht alle Tage trinken. Auf die Idee, Apfelwein herzustellen, hätten ihn Kunden im Lebensmittelladen gebracht, den er damals in seinem Heimatdorf führte, sagt Bruno. »Da Apfelwein und -essig immer stärker nachgefragt wurden, fragte ich mich irgendwann: Warum nicht selbst produzieren, wenn uns ringsum Millionen Apfelbäume umgeben?« Heute beschäftigen die Corazzollas 25 Mitarbeiter, alle kommen aus ihrem Dorf oder der näheren Umgebung.
Wein aus Äpfeln und nicht aus Trauben? Im Belpaese, das ja als Land des vergorenen Rebensaftes bekannt ist, mutet die Idee ziemlich ausgefallen an. Fährt man südlich von Bozen über die Brennerautobahn, durchquert man ein grünes Rebenmeer. Hinter der Salurner Klause, wo die Rotaliana-Ebene beginnt und nicht mehr deutsch, sondern italienisch gesprochen wird, mündet der Nocefluss in die Etsch. Links hockt das Dorf San Michele auf einem Sonnenpodest, rechts an den Ufern des Noce breitet sich Mezzocorona aus. Hier liegt die Eingangspforte zum Nonstal, dem Val di Non, und hier ändert sich die Kulisse schlagartig: Über dem tief in die Felsen gegrabenen Noce erheben sich vom Eiszeitgletscher abgehobelte Hänge, noch in den steilsten Lagen wurden mit Apfelbäumen bepflanzte Terrassen gebaut. Zwischen den wie gestriegelt scheinenden Baumreihen liegen Haufendörfer, im Hintergrund leuchten die Felswände der Brentagruppe. Nicht gerade schön wirken die Gebirge aus Plastikkisten, die sich vor ausgedehnten Hallen auftürmen – vor dem Verkauf müssen die jährlich im Tal geernteten 400 000 Tonnen Äpfel zwischengelagert werden. Nirgendwo sonst in Italien wachsen auf so engem Raum so viele Äpfel.
Andrea Fedrizzi ist bei der größten Erzeugergenossenschaft für das Marketing zuständig. »Die Äpfel bilden die Basis unseres Wohlstandes, sie ernähren einige tausend Familien«, erklärt er im Hauptsitz der Genossenschaft in Segno di Predaia. In seinem Wagen fahren wir anschließend zu einem nahe gelegenen unterirdischen Steinbruch, dort hat die Genossenschaft vor einigen Jahren Kühlzellen angelegt: »Eine Weltneuheit, der Ministerpräsident war bereits hier und hat sich begeistert gezeigt«, sagt Fedrizzi mit Atemwölkchen vor dem Mund, während wir in dicken Jacken durch die bis zur Decke gefüllten Hallen stapfen. Die Temperaturen betragen hier konstant zehn Grad über null. Zur Frischhaltung des Obstes werden die Grotten noch weiter heruntergekühlt, der Sauerstoffgehalt auf ein Minimum reduziert. Das neun Millionen Euro teure Werk soll der Genossenschaft fünfzig Prozent Energie einzusparen helfen, da die Felswände als natürliche Isolatoren wirken.
Edmund Mach war 1874 Gründungsdirektor der land-wirtschaftlichen Lehranstalt St. Michael an der Etsch – er leitete das Institut bis zu seiner Berufung als Berater ins Wiener Ackerbauministerium im Jahr 1899.
Angefangen hat das Apfelwunder jedoch draußen vor dem Taleingang. In San Michele wurde 1874 Tirols älteste landwirtschaftliche Lehranstalt gegründet. Deren erster Direktor war der Chemiker Edmund Mach. Weil in San Michele also der Grundstein für die Entwicklung des modernen Obstbaues im damals südlichsten Teil Tirols gelegt wurde, will ich dort einen Lokalaugenschein machen. Die Ebene, auf Italienisch Piana Rotaliana, ist zwar ein grüner Teppich – man darf sich die Gegend allerdings nicht zu idyllisch vorstellen. Unersättlich fressen sich Neusiedlungen, Industriezonen und große Handwerksbetriebe ins Grün hinein. Das Navigationsgerät, in welches ich die Via Edmondo Mach eingegeben habe, lotst mich auf einer grauen Betonbrücke über die Etsch, die hier schlammig und träge an einer Häuserzeile vorbeirollt. Bevor die Flüsse im 19. Jahrhundert begradigt wurden, soll der Noce an dieser Stelle in die Etsch gemündet sein. Es gab einen Hafen, Holz aus dem Nonstal wurde in großen Flößen über die Etsch weiter Richtung Venedig transportiert. Sämtliche Blicke werden jedoch von drei mächtigen runden Türmen angezogen, die auf einer Schuttterrasse über dem Fluss thronen. Sie gehören zu einem Augustinerkloster aus dem 12. Jahrhundert, welches unter Napoleon säkularisiert wurde. Im aufgelassenen Stift gründete Mach das Agrarinstitut. Das Dorf San Michele zu Füßen des ehemaligen Klosters bemüht sich gar nicht erst um einen städtischen Anstrich: Vor den Häusern parken landwirtschaftliche Maschinen, an den Mauern stapelt sich Brennholz. In einem Hof steht ein Edelstahltank, durch dessen runde Öffnung ein Mann in Gummistiefeln seinen Oberkörper steckt, um die Innenwände mit einem Hochdruckreiniger abzuspritzen. An den Südfassaden der Häuser kleben hölzerne Balkone, wo heute Wäsche trocknet und früher Maiskolben hingen, die tägliche Speise armer Leute in Oberitalien. Omas in Kittelschürzen lehnen sich aus den Küchenfenstern und zupfen in Geranienkästen herum. In einem von der Stiftung Edmund Mach herausgegebenen Buch lese ich von Szenen, die sich hier im November 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, abspielten: Zurückflutende Soldaten der geschlagenen k. u. k. Armee plünderten Keller und Lagerräume. »Von Individuen, die sehr daran interessiert waren, die Soldateska von ihren Häusern und Kellern fern zu halten … und die sich selbst an der Beute mit Geschirr und Wäsche beteiligten …« wurden die Soldaten hinauf Richtung Agrarinstitut gelenkt, wo sie Geldschränke plünderten und »Hektoliter Cognac und Branntwein verschütteten«.
Das Agrarinstitut ist in einem aus dem Mittelalter stammenden Augustinerkloster untergebracht.
Das Buch hat mir Bibliotheksleiterin Alessandra Lucianer im Lesesaal des Instituts auf den Tisch gelegt. Viele der derzeit 900 Schüler stammten aus Bauernfamilien und sollten später den Betrieb übernehmen, erzählt Lucianer. »Zu Machs Zeiten standen die Alumni um 5 Uhr morgens auf. Nach der Messe, vor der sich keiner drücken konnte, gab es das Frühstück, danach bis Mittag Unterricht.« Am Nachmittag habe dann die Praxis im Vordergrund gestanden: Zum Institut gehörten unter anderem eine Käserei, ein Bauernhof sowie eine Korbflechterei. »14-Stunden-Tage waren die Regel, ohne Rückzugsmöglichkeiten in geschützte Privaträume«, sagt die Bibliothekarin. Ihr Büro und die Bibliothek befinden sich in einem modernen Zubau. Vor den Fenstern breiten sich Weinberge und weiter oben Buschwald aus. Blickt man nach Westen, erhebt sich dort das ehemalige Kloster mit den weiß gekalkten Rundtürmen sowie einer dem Erzengel Michael (San Michele) geweihten Kirche. »Um die Wahrheit zu sagen, ist es hier eher ein bisschen eng«, antwortet die Bibliothekarin auf meine Komplimente für den schönen Arbeitsplatz. Mehr Platz böten die Prunkräume; sie liegen drüben im alten Klostertrakt, wo zu Machs Zeiten die Lehrer und der Chef wohnten und heute der Direktor mit seinem Mitarbeiterstab unter Stuckdecken residiert. Mit Büchern und Broschüren im Arm, lotst mich Lucianer an einer Bronzebüste Edmund Machs vorbei. Flankiert ist die Büste von zwei wandhohen Massivholzschränken, in denen unter Glasbehältern Seidenzwirne ausgestellt sind: Hauchdünne weiße Fäden, Kette und Schuss, zu filigranen Geweben verarbeitet. Zu Edmund Machs Zeiten, erzählt Lucianer, war die Seidenindustrie im südlichen Tirol ein wichtiger Wirtschaftszweig. »Die Zöglinge lernten hier alles, von der Aufzucht der Raupen bis zur textilen Verarbeitung.«
Viel weiß man nicht über das Leben des ersten Institutsdirektors. In Band 5 des Österreichischen Biographischen Lexikons 1815–1950 ist dem »Agrikulturchemiker und Önologen« Edmund Mach eine knappe Seite gewidmet. Etwas länger ist der Nachruf, der zu seinen Ehren am 30. Mai 1901 in der einmal wöchentlich in Wien erscheinenden »Allgemeinen Wein-Zeitung« veröffentlicht wurde. »Am 24. des Monats«, heißt es da, sei der zum Hofrat ernannte Agronom »im kräftigsten Mannesalter verschieden«. Geboren wurde Edmund Mach am 16. Juni 1846 in Bergamo als Sohn eines k. u. k. Militärarztes. Vermutlich folgte die Familie den beruflichen Etappen des Vaters, die Mittelschule besuchte Edmund zuerst im nordböhmischen Leitmeritz und dann in Prag. In der böhmischen Hauptstadt begann er auch sein Studium am Polytechnikum, das er in Wien fortsetzte und bei so hervorragenden Chemikern wie Anton Schrötter von Kristelli abschloss. Nach ersten Assistentenstellen an verschiedenen Forst- und Landwirtschaftsakademien, Studienaufenthalten in Frankreich und Deutschland wurde Mach als »Adjunkt« an das noch junge Lehr- und Forschungszentrum für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg berufen. Die Begegnung mit deren Direktor, August Wilhelm Freiherr von Babo, sollte Machs Schicksal bestimmen. Nicht nur förderte ihn der Baron nach Kräften und bereitete auch den Karriereweg seines tüchtigen Assistenten vor, Edmund Mach wird auch seine Tochter Emilia Freiherrin von Babo heiraten. Die Tochter des Barons begleitete Mach 1873 nach San Michele. Dort hatte er die Aufgabe, nach dem Vorbild Klosterneuburgs eine landwirtschaftliche Lehranstalt aufzubauen, anfangs als provisorischer Leiter, ab 1875 als Direktor. Damals herrschte eine große Wirtschaftskrise, auch die Landwirtschaft lag darnieder. Seit der Jahrhundertmitte richtete der Rebmehltau große Schäden an. Hinzu kam die sich von Frankreich über Deutschland und Österreich verbreitende Reblauskatastrophe, gegen die kein Kraut gewachsen war, ganze Weinberge fielen ihr zum Opfer. Nach dem Vorbild seines Mentors von Babo leitete Mach die Bauern im Trentino dazu an, auf Unterlagen aus Nordamerika umzusatteln, die gegen die Reblaus resistent waren. »Mehltau und Peronospora konnten wirksam mit Schwefel und Kupfer bekämpft werden«, sagt Marco Dal Rì.
Ich habe den heutigen Institutschef um ein Treffen gebeten, um mehr über Edmund Mach und die Geschichte der Lehranstalt zu erfahren. Der Direttore empfängt mich in seinem holzgetäfelten Büro. An den Wänden hängen Schwarzweißbilder seiner Vorgänger, der erste in einer stattlichen Reihe ist Edmund Mach: An einem runden Holztisch sitzend, den Oberkörper nach vorn gebeugt, stützt er seine Wange in die Linke. Der Agronom hat dunkle, buschige Augenbrauen, das schon etwas lichte Haar ist ordentlich nach hinten gekämmt. Edmund Machs dunkler Anzug sitzt etwas knapp, der erste Direktor der Landwirtschaftsschule San Michele hat eine Statur, die man früher »kräftig« nannte. Sein Nachfolger Dal Rì, hager und asketisch, betont Machs Organisationstalent. Er habe erkannt, wie wichtig ein Zusammenschluss der Bauern zu Genossenschaften sei. »Die Kräfte zu bündeln, Kooperationen zu gründen, entspricht eigentlich nicht der Tradition dieses Landes – der Italiener misstraut dem Staat und öffentlichen Einrichtungen«, sagt Dal Rì. Und fügt hinzu, dass man das Genossenschaftswesen, die Verbindung von Unterricht, Forschung und landwirtschaftlicher Praxis, wie in San Michele bestens bewährt, als habsburgisches Erbe ansehen könne. »In Italien ist dieses Modell noch immer einzigartig!« Fortschrittlich sei Mach auch hinsichtlich der Unterrichtsorganisation gewesen: »Von Anfang an gab es hier zweisprachigen Unterricht – als der Nationalismus immer stärker wurde, steuerte unsere Schule gegen.« In einem Schrank hütet der Direktor zwei Trophäen aus dem Nachlass des ersten Institutsdirektors: Eine Collage mit Postkarten, wo Stationen seines beruflichen Werdeganges in Leitmeritz, Prag, Wien, Mariabrunn, Hohenheim und Klosterneuburg abgebildet und mit persönlichen Widmungen ehemaliger Schüler versehen sind. Ein Pensionist aus Riva, erklärt Direktor Dal Rì, habe das Werk vor einigen Jahren auf dem Dachboden entdeckt und dem Institut vermacht. Das wertvollste Erinnerungsstück bildet eine dicke Schwarte mit Machs Initialen auf dem Einband, eingerahmt von goldenen Schnörkeln und stilisierten Blüten: das »Goldene Buch«. Mach erhielt es 1893 als Geschenk zum 20. Dienstjubiläum. Heute pflege man beste Kontakte zur Mutterzelle, der Bundeslehranstalt Klosterneuburg, erzählt Dal Rì. Eine Frucht dieser Zusammenarbeit stellte die Entdeckung des Grabes von Edmund Mach am Wiener Zentralfriedhof dar. »Im Mai 2011, 110 Jahre nach seinem Tod, konnten wir gemeinsam eine Tafel mit Namen und Foto am Grab Edmund Machs anbringen.« Nur der Hartnäckigkeit eines Wiener Bekannten sei es zu verdanken, dass Machs letzte Ruhestätte, wenige Meter vom Haupteingang entfernt, gefunden werden konnte, sagt Dal Rì. »Die Grabstätte war längst aufgegeben und wiederverwendet worden.« Heute prangt auf schwarzem Marmor, neben den Namen anderer Verstorbener, ein weißes Täfelchen zu Ehren des Gründers der Agrarschule San Michele. Als Mach, zum Hofrat ernannt, Ende 1899 in Pension ging, erhielt er noch eine Berufung als landwirtschaftlich-technischer Berater des k. k. Ackerbauministeriums in Wien. Ein langes Wirken war ihm leider nicht vergönnt. Noch vor seinem 55. Geburtstag erlag Edmund Mach einem »kurzen, schmerzvollen Leiden« – ein »unersetzlicher Verlust« für die önologische Wissenschaft, heißt es im Nachruf.
Machs Nachfahren leben heute in Italien. Vor einigen Jahren sei im Institut eine Dame aus der Gegend von Verona erschienen und habe sich als Edmund Machs Urenkelin vorgestellt, erzählt Dal Rì. Zu den erhaltenen Spuren gehört eine Grabplatte mit dem Namen Emilias, der Witwe des Institutsgründers, die auf dem Friedhof von San Michele gefunden wurde. Offenbar ist Emilia von Babo nach dem Tod ihres Gatten nach San Michele zurückgekehrt. »Wir können den Grabstein anschauen«, schlägt der Direktor vor. Nachdem er einen Mitarbeiter gerufen hat, der uns, mit einem Schlüsselbund rasselnd, vorangeht, durchqueren wir den mit Granitsäulen geschmückten Kreuzgang. Am Ende einer knarrenden Treppe öffnet der Mitarbeiter mit einem Bartschlüssel eine dicke Holztür: Wir stehen auf der Chorempore mit Blick auf den goldgeschmückten Hauptaltar, an den Wänden verblasste Fresken. In einem staubigen Winkel lehnt eine hüfthohe Marmorplatte, eine Ecke oben rechts ist abgebrochen. »Emilia Mach, geborene Baronin Babo«, steht da in schwarzen Lettern, dazu die Lebensdaten: 23. Februar 1853 bis 17. Jänner 1939. Von Direktor Dal Rì erfahre ich noch etwas: Vor etwa zehn Jahren meldete sich ein russischer Professor bei ihm, der sich mit dem Werk Leo Tolstois beschäftigt. Er habe festgestellt, dass der Dichter von Krieg und Frieden, wie schon seine Mutter, im damals südlichen Tirol Apfelbäume für den Obstgarten in Jasnaja Poljana bestellt hatte. Als Absender käme nur das Agrarinstitut von San Michele infrage. Aktueller Anlass der Kontaktaufnahme: Der Obstgarten auf Tolstois Landgut, heute ein nationales Museum, solle wieder entstehen. »Da die Spuren zu uns und von hier ins Nonstal führten, beschloss man, erneut einige alte Sorten nach Jasnaja Poljana zu transportieren. Nun reifen wieder Nonstaler Äpfel in Russland.«
Dass Edmund Mach bei der damaligen Lieferung seine Hände im Spiel hatte, lässt sich nicht beweisen. »Unser Archiv ist im Ersten Weltkrieg zerstört worden«, sagt Dal Rì. Die Geschichte klingt jedoch plausibel, deshalb will ich noch einmal ins Nonstal fahren. Weit hinten im Tal befindet sich das Reich von Ester Facinelli und ihrem Sohn Aldo. Ein verborgenes Reich, wie schon der Name ihres Bauernhofes verrät: »Einsiedelei Sankt Blasius«, ein jahrhundertealtes, ineinander verwachsenes Ensemble aus Wohnhaus, Stall, Heustadel und Kirche, wo die Facinelli ohne Einsatz von Pestiziden Pflaumen, Kirschen und Nüsse, sogenannte »kleine Früchte« und alte Apfelsorten anbauen. Bei Sanzeno muss man aufpassen, die Abzweigung auf die SP 74 zu erwischen. Auf dieser Seitenstraße, die für Leute mit Höhenangst nicht zu empfehlen ist, manövriert man über Haarnadelkurven am Rand des Wildbaches Novella Richtung Romallo hinauf. Unterhalb des kleinen Dorfes verengt sich das Tal zu einer Schlucht, in die kaum ein Sonnenstrahl fällt, so tief und eng ist sie. Über ein paar geschotterte Serpentinen erklimmt man den wie eine Insel aufragenden Felssporn – oben thront der Bauernhof der Facinelli. Als Besucher ist man berührt von der Schönheit dieses Fleckchens Erde, wo es überall blüht und wächst und vom Straßenlärm nichts zu hören ist. Als ich die Bäuerin erblicke, die gerade in ausgelatschten Schuhen aus dem Stall kommt, in ihrer umgestülpten Kittelschürze ein Dutzend Eier, ahne ich allerdings, dass es hier vor allem eine Menge Arbeit gibt. Heuer sei »ein schwieriges Jahr«, sagt Ester Facinelli, »weil Frühlingfrost die Blüten der Walnussbäume und Aprikosen vernichtet hat«. Jetzt im Herbst machten ihr und ihrem Sohn Aldo, der als Versicherungsbeamter meist unterwegs ist, die neu auftretende Kirschessigfliege zu schaffen. Während mich die Bäuerin herumführt, folgt uns auf Schritt und Tritt eine junge Ziege, Ester hat sie mit der Flasche aufgezogen, weil die Zitzen der Mutter zu wenig Milch hergaben. »Langweilig wird mir nie«, meint die Bäuerin. Sechs Kinder hat die schmale grauhaarige Frau auf die Welt gebracht, ihr Mann starb, als die kleinste Tochter fünf Monate alt war. »Irgendwie musste es weitergehen«, sagt Ester Facinelli und lächelt dazu das Lächeln scheuer Menschen, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Inzwischen hat sie für mich die Kirchentür geöffnet. Der älteste Teil des Gotteshauses ist eine tief in den Felsgebaute Marienkapelle. Dort verharren wir andächtig vor einer holzgeschnitzten Madonnenstatue aus dem 15. Jahrhundert: der »Muttergottes des Apfels«. Auf ihrem Schoß sitzt der Weltenretter und blickt in die Ferne. Als wir wieder im Freien sind, erzählt Ester von den Restaurierungsarbeiten vor einigen Jahren: »Dabei wurden eine Menge Skelette von Pest- und Leprakranken gefunden, früher befand sich hier ein Lazarett.« Die Gebeine seien anschließend wieder der geweihten Erde übergeben worden. Sie habe vor den Toten keine Angst, sagt Ester. Gefährlicher findet sie manche der Lebenden, jene zum Beispiel, die vor Kurzem versuchten, nachts in die Kirche einzubrechen. »Wahrscheinlich hat sie unser Hund vertrieben, wir selbst bemerkten den Besuch erst am nächsten Morgen – ein Brett an der Eingangstür war beschädigt.« Seitdem versperrt Ester Facinelli die Kirchentür zusätzlich mit einer innen quer liegenden Eisenstange.
Von ganz oben in Mallosco im Nonstal wurden Ableger uralter Apfelsorten zu Tolstois Landgut Jasnaja Poljana in Russland geschickt.
Vor dem Bauernhaus stehen Apfelbäume mit breiter Krone und reichlich Platz rundherum, die Früchte leuchten rot und gelblich-weiß, beinahe goldfarben. Ein Dutzend alter Sorten, etwa Calville, Napoleon, Roter Rosmarin oder Gelber Fritz, bauen Ester und Aldo Facinelli an. »Wir machen es wie früher: Man legt einen gemischten Satz an, mit Äpfeln, die früh, und solchen, die spät reifen, so hat man auch ohne Kühlgeräte über Monate frisches Obst«, erklärt die Bäuerin. Uns zu Füßen im knöchelhohen Gras liegen einige besondere Exemplare, nicht größer als ein Hühnerei, mit brauner Schale. Sie heißen »Lederer«, erfahre ich. Ein sprechender Name, die Konsistenz von Schale und Fruchtfleisch erinnert an eine Schuhsohle, und herb säuerlich schmecken die Früchte. Ester Facinelli hat aus lokalen Medien erfahren, dass der Apfelgarten des Dichters Tolstoi möglicherweise seinen Ursprung im Nonstal hat. Darauf angesprochen, findet sie die Sache »ganz nett« – ihr Gesichtsausdruck verrät jedoch, dass es Dinge gibt, die sie für wichtiger hält. Ester Facinelli fällt jedoch ein Kollege ein, noch höher oben im Tal, er engagiere sich in besagter Angelegenheit.
So geht es ein weiteres Stück bergauf nach Malosco. Das Dorf sonnt sich auf einem Hochplateau am Fuß zweier uralter Übergänge nach Südtirol, dem Gampen- und Mendelpass, letzterer um 1900 eine beliebte Kurgegend, bequem mit der Mendelbahn von Bozen aus erreichbar. »Heute ziehen viele Junge weg«, sagt Francesco Calliari. Der junge Mann bewirtschaftet mit seinen Eltern einen Bauernhof mit vierzig Kühen, dazu wird Gemüse und Obst angebaut. Verkauft wird ab Hof, Mutter Flavia bietet Kurse an, in denen man Heupuppen basteln oder Marmeladen und Säfte herstellen lernt. Man kann sich bei den Calliari auch als Bauer für einen Tag erproben. »Komm, ich zeige dir alles!«, sagt Francesco. Nachdem er sich eine Selbstgedrehte angezündet und allerlei Werkzeug vom Beifahrersitz geräumt hat, rumpeln wir in seinem Lieferwagen über die Felder. Ich besichtige den neu angelegten Weinberg, ein gewagtes Unterfangen auf 1100 Meter Höhe. »Der erste Selbstgekelterte taugte nur als Essig«, gesteht Francesco. Danach begutachte ich die Netztunnels (wegen der Kirschessigfliege!), wo Gemüse und Beeren geerntet werden, und bewundere einige Methusalem-Apfelbäume, Francescos großer Stolz. Ableger dieser Riesen wachsen heute in Russland. Auch den Dorffriedhof mit brennenden Kerzen auf den Grabhügeln zeigt mir der Jungbauer, die Kerzen seien wichtig, erklärt Francesco, weil die Toten ja weiterhin zur Dorfgemeinschaft gehörten. Auf einer Bank vor dem Bauernladen entkorken wir schließlich eine Flasche vom zweiten Jahrgang seines Selbstgekelterten. Der goldfarbene Solaris schmeckt vorzüglich, was vielleicht auch ein bisschen am wohligen Moment liegt, hier auf der Südseite des Hauses und umfächelt von einem milden Lüftchen, während unser Blick über die wogenden Hänge zur gegenüberliegenden Talseite schweift, wo die Sonne langsam über die Gipfel der Brentagruppe hinunterrollt. Unterdessen erzählt Francesco, wie seine Apfelbaum-Stecklinge auf das Landgut des berühmten Dichters Tolstoi gelangten. Im Mai 2009 ist er mit seinem Vater Gabriele auf Einladung des heutigen Museums Jasnaja Poljana nach Russland geflogen, ein Lastwagen mit den alten Sorten nahm den Landweg. Im Beisein lokaler Prominenz wurden die Bäume aus dem Nonstal in russische Erde gepflanzt, nicht weit vom Grab Leo Tolstois. Weil das Projekt dem Vernehmen nach gut gedeiht, plant Francesco, demnächst erneut nach Russland zu fahren. Er möchte bald eine Familie gründen, bei der Reise soll ihn diesmal seine Freundin begleiten. Die Idee dahinter: Wenn die Zukünftige, die noch etwas zögert, weil ihr der Hof zu entlegen scheint, mit eigenen Augen sieht, dass die Ableger aus dem Nonstal im Garten des berühmten Dichters prächtig gedeihen, wird sie alle Zweifel fahren lassen. Sie wird nämlich erkennen, wie ideal der heimische Boden zum Wurzelschlagen ist.
Im Nonstal dreht sich alles um den Apfel – früher wurden Bittgänge zur Muttergottes des Apfels abgehalten.