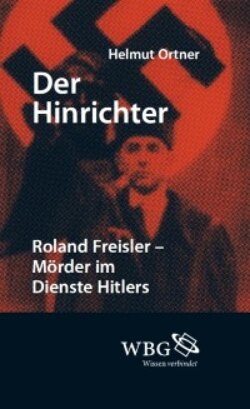Читать книгу Der Hinrichter - Helmut Ortner - Страница 12
Zweites Kapitel Der Rechtsanwalt aus Kassel
ОглавлениеDer 30. Oktober 1893 war für die Eheleute Julius und Charlotte Freisler ein glücklicher Tag. An diesem Tag wurde ihr Sohn geboren. Einen Namen hatten sie schon lange vor dem großen Ereignis gefunden: Sollte es ein Junge sein, dann würde er auf den Namen Roland getauft werden. Es war ein Junge. Besonders stolz war der Vater, der Diplomingenieur Julius Freisler. Erst vor wenigen Jahren war er aus dem mährischen Klantendorf ins Reich gezogen und hatte sich in Celle bei Hannover in die grazile, zurückhaltende Charlotte Auguste Schwerdtfeger verliebt – und sie alsbald geheiratet.
Insgeheim hatte er sich einen Sohn gewünscht. Julius Freisler war stolz und glücklich. War ihm der kleine Roland nicht wie aus dem Gesicht geschnitten? Kurze Zeit nach der Geburt zog die junge Familie nach Hameln, wo am 28, Dezember 1895 Charlotte Freisler ihr zweites Kind, wiederum einen Jungen, zur Welt brachte. Man gab ihm den Namen Oswald. Bereits einen Monat später bekam Julius Freisler eine berufliche Offerte, die er nicht ablehnen mochte: eine leitende Stelle im Duisburger Hafenbauamt. Auch wenn die Trennung schmerzlich war – er dachte an seinen beruflichen Aufstieg. Seine Frau blieb mit den beiden Kindern vorläufig im Niedersächsischen, bis sie ihrem Mann schließlich nach Aachen folgte, wohin es den umtriebigen Ingenieur gezogen hatte, als man ihm an der Königlichen Baugewerbeschule eine Professur angeboten hatte.
Der Ruf bescherte Julius Freisler nicht nur eine persönliche Statusverbesserung, sondern ihm und seiner Familie auch ein gesichertes Einkommen. Die beiden Jungen besuchten zunächst die Grundschule, ehe der zehnjährige Roland ab 1903 auf das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium wechselte. Hier galt er als lernwilliger und ehrgeiziger Schüler. Dieser Ehrgeiz zeichnete ihn auch noch als fünfzehnjährigen Pennäler in Kassel aus, wohin die Familie Freisler 1908 zog. Vier Jahre später machte der Gymnasiast, der sich an politischen Diskussionen immer besonders engagiert beteiligte, als Klassenbester das Abitur.
Danach begann er an der Universität Jena sein Jurastudium. Doch als der »große vaterländische Krieg« ausbrach, verließ er die Stadt, um im August 1914 als Fahnenjunker ins 167. Infanterieregiment in Kassel einzutreten. Wie alle jungen Männer seiner Generation hielt er es für seine patriotische Pflicht, Soldat zu werden. Hier ging es um das Reich, um Deutschland. Um den Sieg. Nach kurzer Ausbildung kam der junge Rekrut zunächst in Flandern zum Einsatz, wo er schon nach kurzer Zeit verwundet und in ein Heimatlazarett verlegt wurde. Nach seiner Genesung kam er mit seinem Regiment an die Ostfront. Dort erfüllte er seine soldatischen Pflichten so eindrucksvoll, daß seine Beförderung anstand: Als Führer eines Spähtrupps wurde er zum Leutnant ernannt. Im Feld zeichnete er sich durch besondere Tapferkeit aus, weshalb die Armeeführung dem jungen Leutnant das »Eiserne Kreuz« verlieh. Doch auch diese soldatische Auszeichnung schützte ihn und seine Kameraden nicht vor Niederlage und Gefangenschaft. Den Rest des Krieges verbrachte Roland Freisler wie Tausende andere deutsche Soldaten als Gefangener in einem Offizierslager in der Nähe von Moskau.
Nach der Oktoberrevolution und dem Frieden von Brest-Litowsk hatten die Russen die Lagerverwaltung den deutschen Gefangenen übertragen und Freisler zu einem der Lagerkommissare ernannt. Sein Auftrag: die Organisation des Lagerproviants.
Seine Funktion als Lagerkommissar sollte später unterschiedlich bewertet werden. Die einen beriefen sich auf Zeitzeugen, die bestätigt haben sollen, Freisler habe sich während dieser Zeit intensiv mit den Lehren des Marxismus beschäftigt, die russische Sprache erlernt und als »Bolschewist« rasch Karriere gemacht. Andere sahen in der Tatsache, daß Freisler innerhalb der Selbstverwaltung als Kommissar hervortrat, allenfalls einen Beleg für seine Fähigkeit, neue Situationen stets auch zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Freisler selbst bestritt später niemals, Lagerkommissar gewesen zu sein – aber er wehrte sich entschieden gegen eine angebliche »bolschewistische Vergangenheit«.
Im Juli 1920 kehrte Roland Freisler nach Deutschland zurück. Zunächst nach Kassel, später nach Jena, wo er sein Jurastudium wieder aufnahm. Zwar hatte er kurze Zeit darüber nachgedacht, ob er statt dessen eine Offizierslaufbahn einschlagen sollte, doch in diesen wirren Nachkriegszeiten, in denen sich jetzt Kommunisten, Sozialdemokraten, konservative Kräfte und Freikorps heftig bekämpften, fand er nirgendwo einen verläßlichen Orientierungspunkt. Am sinnvollsten erschien es ihm, sich nicht auf die Politik, sondern auf seine private Karriere zu konzentrieren. So entschied er sich für Jena – und für eine Laufbahn als Jurist.
Roland Freisler war – wie schon früher als Schüler – auch als Student eifrig und ehrgeizig. Sein Studium absolvierte er problemlos. Schon 1921 legte er seine Doktorarbeit mit dem Thema »Grundsätzliches über die Betriebsorganisation« vor, die mit »summa cum laude« benotet wurde und ein Jahr später in den »Schriften des Instituts für Wirtschaftsrecht« der Universität Jena veröffentlicht wurde.
Anschließend ging der junge »Dr. jur.« nach Berlin, wo er 1923 das große juristische Staatsexamen bestand und seine Zeit als Assessor absolvierte. Am 13. Februar 1924 kehrte er erneut nach Kassel zurück, um hier mit seinem Bruder, der zwischenzeitlich ebenfalls das juristische Staatsexamen abgelegt hatte, eine Rechtsanwaltskanzlei zu eröffnen. Die Brüder einigten sich auf eine klare Arbeitsteilung: Roland bearbeitete ausschließlich Strafsachen, Oswald konzentrierte sich auf Zivilklagen. Die Kanzlei etablierte sich rasch, über Mangel an Klienten konnten sich die beiden nicht beklagen.
Der Anwalt Roland Freisler verschaffte sich schnell Respekt. Fachlich galt er als außerordentlich kompetent, zudem von großer rhetorischer Geschicklichkeit. Er verstand es, seine Plädoyers klar und durchdacht vorzutragen; die Kunst des belanglosen Hinhaltens beherrschte er ebenso wie das energische Nachfragen. Während er in unpolitischen Prozessen als angenehmer, beinahe zurückhaltender Rechtsanwalt auftrat, präsentierte er sich in politischen Verfahren allerdings als kämpferischer Verteidiger mit eindringlicher Gestik und messerscharfen Formulierungen. Keinem Zusammenstoß mit dem Gericht ging er aus dem Weg. Für seine Mandanten war er ein guter Anwalt. Vor allem in schwierigen Revisionsverfahren bewies er seine juristischen Fähigkeiten so nachhaltig, daß man auch beim Reichsgericht in Leipzig, dessen Dritter Strafsenat für den Oberlandesgerichtsbezirk Kassel zuständig war, auf den jungen Rechtsanwalt Dr. Freisler aufmerksam wurde.
Seine zweite – politische – Karriere verfolgte er mit der gleichen Energie. Für den »Völkisch-Sozialen Block«, eine rechte Splitterpartei, zog Roland Freisler 1924 als Abgeordneter in das Kasseler Stadtparlament ein. Doch nachdem Hitler am 24. Dezember dieses Jahres vorzeitig aus der Festung Landsberg entlassen worden war und umgehend mit der Neuorganisation der NSDAP begonnen hatte, entdeckte auch Freisler seine nationalsozialistische »Heimat« und wechselte wie Tausende seiner Gesinnungsgenossen zur größeren Bruderpartei. Er erhielt die Mitgliedsnummer 9679.
Vielleicht spürte der ambitionierte Anwalt, daß es Hitler bald gelingen sollte, alle rechten und national gesinnten Splittergruppen im Reich zusammenzufassen und damit die politische Macht in Deutschland an sich zu reißen. Bei diesem »nationalen Aufbruch« wollte Roland Freisler dabeisein. Nicht in der anonymen Masse, sondern an vorderster Front.
Als Abgeordneter vertrat er fortan im Kasseler Stadtparlament die NSDAP. Getragen vom Elan der nationalsozialistischen Bewegung und getrieben von seinem starken persönlichen Geltungsbedürfnis, entwickelte er sich zu einem rigorosen Verfechter eines nationalsozialistischen Deutschlands. Ob im Gerichts- oder Plenarsaal – es galt, für die Ideen und Interessen seiner Partei zu kämpfen. Und für seine eigenen. Neben der florierenden Anwaltskanzlei, die er weiterhin mit seinem Bruder Oswald betrieb, verfolgte er nunmehr noch zielstrebiger als zuvor seine politischen Ambitionen.
Privat eher zurückhaltend, heiratete er am 23. März 1928 Marion Russegger – und seine Kasseler Parteigenossen feierten mit. Dabei war Freislers örtliche NS-Stellung nicht unumstritten. Als stellvertretender Gauleiter trachtete er nach dem Stuhl des Gauleiters von Hessen-Nassau Nord. Doch darauf saß mit Dr. Schultz ein enger Vertrauter von Rudolf Heß. Der zahllosen Intrigen und Angriffe Freislers überdrüssig, wandte sich Schultz über seinen Parteifreund mit einem Schreiben an die Parteispitze. Darin bestätigte er seinem Stellvertreter zwar ausdrücklich eine Ausnahmestellung als Anwalt und Redner in der Region, monierte aber gleichzeitig dessen Launenhaftigkeit, die ihn für eine Führungsposition als ungeeignet erscheinen ließ. Mit seiner Meinung stand der Provinz-Gauleiter nicht allein.
Tatsächlich war Freisler wegen seines Übereifers, seines hektischen und lärmenden Vorgehens, auch parteiintern schon häufig ins Zwielicht geraten. Es gab Parteifunktionäre, die sich außerdem an Freislers »Geschäftstüchtigkeit« störten. Sie warfen ihm eine Verknüpfung politischer und privater Interessen vor. Andererseits: Hatte er nicht in zahllosen Prozessen Parteigenossen hervorragend verteidigt und nicht selten sogar deren Freispruch erreicht? War man nicht dank seiner scharfen Rhetorik jeder Attacke des politischen Gegners im Stadtparlament gewachsen? Kämpfte dieser Mann nicht mit offenem Visier und geradezu hingebungsvoll für die Partei und die nationale Sache?
Selbst interne Kritiker konnten Freislers Stärken und Erfolge nicht abtun. Ohnehin waren sie in der Minderheit. Freisler galt im nordhessischen Raum als verdienter Parteigenosse. Er gehörte zur regionalen NS-Prominenz. Daran vermochte auch gelegentliche Kritik an seiner Person, etwa an seinen lärmenden Aktionen und Vorstößen gegen alles, was er als »deutschfeindlich« einstufte, kaum etwas zu ändern.
Da war zum Beispiel der Vorfall im Kasseler »Kleinen Theater«. Ein Theaterstück mit dem Titel »Seele über Bord« des hessischen Schriftstellers Ernst Glaeser stand auf dem Programm. Im dritten Akt dieses Stücks näherte sich in einer katholischen Kirche ein als Priester verkleideter Detektiv in eindeutiger Absicht einem Mädchen. Das Mädchen wandte sich still an den Erlöser und bat um Hilfe, doch ohne Erfolg. Die Presse lobte die schauspielerischen Leistungen, kein Kritiker nahm Anstoß am Inhalt des Stücks. Dennoch: Es sprach sich herum, welch blasphemisches Theater nun auch in Kassel zu sehen war, obschon das Drama im Laufe des Stücks gänzlich andere religiöse Wege ging und an keiner Stelle auch nur im geringsten angedeutet wurde, welche Meinung denn nun der Autor des Stücks selbst vertrat.
Ein Leserbrief, der nach der Premiere in der Lokalzeitung Kasseler Post erschien und worin sich ein anonymer Leser mit markigen Worten über die »gotteslästernde« Vorstellung beschwerte, mobilisierte Proteste gegen das Stück. Bei der ersten Wiederholung stürmte eine Truppe nationaler Moralwächter unter Führung von Rechtsanwalt und Parteigenosse Freisler das Theater, störte die Vorstellung und mißhandelte einen Besucher, der dennoch den Mut fand, für den Dichter und das Stück Partei zu ergreifen. Die gewalttätige Störaktion blieb für die Theaterstürmer folgenlos. Nicht sie wurden angezeigt, sondern das Stück wurde verboten und der Schriftsteller statt dessen der »Gotteslästerung« angeklagt. Gegen den Schriftsteller Kurt Tucholsky, der das Stück in einem Artikel verteidigt und über den Überfall berichtet hatte, wurde ebenfalls eine Anzeige wegen »Gotteslästerung« eingereicht.
Das geschah im Jahre 1926, und es war das erste Mal, daß der NSDAP-Mann Freisler nachhaltig in der Öffentlichkeit seine Bereitschaft demonstrierte, gegen alle »undeutschen Umtriebe« anzukämpfen – auch mit Gewalt.
Vier Jahre später, am 23. Juni 1930, ging der fanatische Nationalsozialist wiederum gegen seine politischen Gegner vor – diesmal etwas geschickter. In der Kasseler Stadtverordnetenversammlung stellte er einen Mißbilligungsantrag gegen den dortigen Polizeipräsidenten. Der Hintergrund: Wenige Tage zuvor hatte Freisler in vier Kasseler Restaurants NS-Veranstaltungen organisiert. Dabei waren auch Uniformen getragen worden, die die hessische Regierung durch einen Erlaß am 11. Juni verboten hatte. Die Nationalsozialisten scherten sich nicht um dieses Verbot. Zahlreiche Parteigenossen erschienen in Braunhemden samt Hakenkreuz-Armbinde vor den Veranstaltungslokalen. Eine Provokation – so sahen es vor allem die Kommunisten. Am 18. Juni, dem Tag der NS-Veranstaltungen, hielten sie nun ihrerseits öffentliche Versammlungen ab, ebenso wie das sozialdemokratische »Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold«, dessen Mitglieder gleichfalls unangemeldet und in voller Montur durch die Kasseler Straßen marschierten.
In dieser explosiven Situation war es nach dem Ende einer der NS-Veranstaltungen zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei, die zuvor mit einer halben Hundertschaft dafür gesorgt hatte, daß Besucher trotz Beschimpfungen und Drohungen den Versammlungssaal betreten konnten, war zwischenzeitlich auf Befehl des Polizeiführers wieder abgezogen worden. Danach war es zu wüsten Prügeleien zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten gekommen, in deren Verlauf zahlreiche Personen verletzt wurden.
Freisler machte dafür allein die Polizei verantwortlich, die es seiner Meinung nach versäumt hatte, die Besucher vor den Kommunisten zu schützen. Deshalb stellte er im Stadtparlament einen Mißbilligungsantrag gegen den örtlichen Polizeipräsidenten. Dieser, der frühere Rechtsanwalt Dr. Hohenstein, sei Jude und deshalb – so Freisler in seiner Begründung – gar nicht in der Lage, unparteiisch zu sein, sobald es sich um Nationalsozialisten handle. Und weil er gerade in Rage war, griff er an diesem Abend auch den verantwortlichen Einsatzleiter, den sozialdemokratischen Polizeileutnant Schulz, scharf an. Allein die Polizei und nicht die sich wehrenden NSDAP-Mitglieder sei der wahre Verursacher der Vorfälle.
Sowohl der Polizeipräsident als auch sein Leutnant wollten diese Verleumdungen nicht auf sich sitzen lassen und erstatteten Anzeige gegen Freisler. Es kam zum Prozeß. Vor dem Kasseler Schöffengericht wurde Freisler zwar wegen seiner Angriffe gegen Schulz freigesprochen, wegen übler Nachrede gegenüber Dr. Hohenstein allerdings zu einer Geldstrafe von dreihundert Mark verurteilt. Eine kleine, aber dennoch schmerzliche Niederlage für Freisler. Den Gerichtssaal verließ er mit deutlicher Verärgerung. Unter Gleichgesinnten beschwor er kämpferisch die Zukunft. Er war sich sicher, daß die Zeit für ihn, für seine Partei – für die nationalsozialistische Sache – arbeitete. Und dann sollten auch solch skandalöse Urteile der Vergangenheit angehören.
Obwohl Freisler im sozialdemokratisch regierten Hessen keinen leichten Stand hatte, einem Land, in dem sich Verwaltung, Polizei und Justiz stärker als anderswo in der Republik mit Entschiedenheit gegen die zunehmenden Attacken der Nationalsozialisten stellten, ging seine juristische und politische Karriere zügig voran. Neben Hans Frank – 1928 Gründer des »Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen«, einem Mann, der 1930 Leiter der Rechtsabteilung der Reichsführung der NSDAP, nach 1933 bayerischer Justizminister und Präsident der »Akademie des Deutschen Rechts«, später dann zunächst Reichsminister ohne Geschäftsbereich und schließlich ab 1940 Generalgouverneur in Polen werden sollte – neben diesem Hans Frank wurde Freisler mittlerweile innerhalb der NSDAP als herausragender Jurist beurteilt. Er galt als ein Parteigenosse mit einer ausgeprägten Fähigkeit, zu eindeutigen und schnellen Entschlüssen zu kommen. Kurzum, er war ein Mann, der alle seine Ambitionen systematisch mit jener Zielstrebigkeit verfolgte, die ein skrupelloser Mensch benötigt, um vorwärts zu kommen.
Doch trotz juristischer Prominenz, der Zugang zur inneren Führung der Partei blieb Freisler noch verschlossen. Weder als hervorragender Parteianwalt noch als NSDAP-Abgeordneter im Preußischen Landtag, dem er seit 1932 angehörte und wo er gelegentlich in Justizdebatten durch rüde Wortattacken von sich reden machte, wurde ihm die Tür ins Machtzentrum der Partei geöffnet.
Historiker sahen später vor allem in der Tatsache, daß Freisler hinsichtlich des Antisemitismus zu diesem Zeitpunkt nicht radikal genug gewesen sei und in seinen Reden die Juden kaum erwähnte, einen Grund dafür, daß ihm der Zutritt zur NS-Prominenz vorerst versperrt blieb. Vielleicht aber lag es auch daran, daß Freislers politischer Aktionsraum von den nationalsozialistischen Hochburgen Berlin und München zu weit entfernt war.
Doch es sollte nicht mehr lange dauern, bis die neuen Machtverhältnisse den ehrgeizigen Anwalt und NSDAP-Genossen Freisler aus der Enge der Provinz nach Berlin führten, in das nationalsozialistische Machtzentrum. Dort war Adolf Hitler am 30. Januar 1933 von dem greisen Reichspräsidenten Hindenburg zum neuen Reichskanzler ernannt worden.
»Jetzt sind wir soweit«, hatte Hitler unter dem Jubel seiner nationalsozialistischen Gefolgsleute im Hotel »Kaiserhof« ausgerufen, als er nach der Ernennung in der Berliner Wilhelmstraße 77, dem ehemaligen Sitz der Bismarckschen Amtswohnung, erschienen war. Alle hatten dem Führer die Hand geschüttelt: Goebbels, Heß, Röhm, Göring – die Schlange der Gratulanten schien endlos. Am Abend wurde eine gigantische Jubelfeier von den Nationalsozialisten organisiert. Von sieben Uhr abends bis weit nach Mitternacht marschierten unter Fackelschein und Marschklängen 25.000 Hitleranhänger zusammen mit Stahlhelm-Einheiten durch das Brandenburger Tor. Und auch Freisler und seine Kasseler Parteigenossen feierten an diesem 30. Januar 1933. Es war ihr Tag, ihr Sieg.
Hitlers Ernennung zum Reichskanzler war keineswegs ein kluger Schachzug der Nationalsozialisten, sondern eine durchaus verfassungsmäßige Angelegenheit. Er und seine neun deutsch-nationalen und drei nationalsozialistischen Minister besaßen das Vertrauen des Reichstages, wofür laut Verfassung eine einfache Mehrheit notwendig war. Erst am 23. März 1933, als Hitler das Ermächtigungsgesetz durchsetzte, veränderte sich die politische Situation schlagartig. Schon kurz nach der Machtergreifung begann im ganzen Land der Prozeß der Gleichschaltung, alle Länder hatten einen »Reichsstatthalter« bekommen, und hinter ihnen sorgten die NSDAP-Gauleiter dafür, daß Verbände und Institutionen, Behörden und Vereine »gleichgeschaltet« wurden. Die Volksgenossen schienen darauf geradezu gewartet zu haben. Die Mehrheit der Deutschen jedenfalls schien sich unter dem Banner des Hakenkreuzes sichtlich wohl zu fühlen.
Am 5. März – nachdem der Reichstag am 1. Februar aufgelöst worden war – hatten Neuwahlen stattgefunden. Für die NSDAP fiel das Ergebnis enttäuschend aus. Hitler und seine Gefolgsleute waren sich sicher, die absolute Mehrheit der Stimmen zu gewinnen, doch sie erhielten nur 43,9 Prozent. Nur der Allianz mit der deutsch-nationalen DNVP hatten es die Nationalsozialisten zu verdanken, daß eine »Regierung der nationalen Erhebung« gebildet werden konnte – eine Regierung, die von der Mehrzahl der Deutschen verfassungsgemäß gewählt war.
So konnte Hitler weiter darangehen, seine Machtbefugnisse auszuweiten. Und vor allem konnte er mit seinen Gegnern endgültig abrechnen. Dabei half ihm das Ermächtigungsgesetz, das ihm für vier Jahre beinahe unbegrenzte Vollmachten im Kampf um die »Behebung der Not am Volk und Reich« geben sollte. Schon drei Jahre zuvor hatte Hitler vor Parteigenossen in München angekündigt, was im Falle eines Machtwechsels auf seine Gegner zukommen würde:
»Wir Nationalsozialisten haben niemals behauptet, daß wir Vertreter eines demokratischen Standpunktes seien, sondern wir haben offen erklärt, daß wir uns demokratischer Mittel nur bedienen, um die Macht zu gewinnen, und daß wir nach der Machtergreifung unseren Gegnern alle die Mittel rücksichtslos versagen werden, die man uns in Zeiten der Opposition zubilligt…«
Jetzt war es soweit. Am 23. März 1933 ließ Hitler in seiner Reichstagsrede keinerlei Zweifel daran aufkommen, welch geringen Stellenwert er dem Reichstag zubilligte:
»Es würde dem Sinne der nationalen Erhebung widersprechen und für den beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten…«
Geradezu drohend beendete er seine Rede vor den Berufsparlamentariern mit den Worten:
»Die Regierung ist aber ebenso entschlossen und bereit, die Bekundung der Ablehnung und damit die Ansage des Widerstandes entgegenzunehmen. Mögen Sie, meine Herren, nunmehr selbst entscheiden über Frieden oder Krieg!«
Das war deutlich genug. Der sozialdemokratische Abgeordnete Otto Wels wies in einer leidenschaftlichen Rede auf die Konsequenzen dieses Vorgehens hin, die ein letzter Schritt zur Auflösung der parlamentarischen Demokratie seien. Doch seinem Appell, dem bevorstehenden Ermächtigungsgesetz die Stimme zu verweigern, folgte die Mehrheit der Reichstagsmitglieder nicht.
Nur seine eigene Partei stimmte gegen das Gesetz. Selbst wenn die zuvor bereits verhafteten Kommunisten ebenfalls dagegen gestimmt hätten – Hitler wäre eine Zweidrittelmehrheit sicher gewesen. So war er mit allen Vollmachten ausgestattet worden, die er brauchte, um die Weimarer Republik zu beseitigen. 82 Prozent hatten für ihn und sein Gesetz gestimmt – und sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt.
Wenn später – nicht selten von Nachkriegspolitikern – behauptet wurde, die Abgeordneten des Reichstags seien von den Nationalsozialisten eingeschüchtert und terrorisiert worden, so diente das allenfalls der Legendenbildung. Tatsache ist: Hitler und seine Gefolgsleute benötigten keinerlei Täuschungsmanöver. Fast alle Parteien waren ausnahmslos mit eigenen Machtgedanken beschäftigt, an der Republik hatten sie nur ein strategisches Interesse. »Weimar starb nicht wegen seiner Feinde, sondern weil es keine echten Freunde besaß, nicht einmal unter den Sozialisten«, charakterisiert der Historiker Hansjoachim Koch treffend die damalige Situation.
Der Reichstag wurde nach diesem 23. März 1933 zwar nicht abgeschafft, aber er war danach nicht viel mehr als eine von den Nationalsozialisten dominierte Versammlung, deren Funktion einzig darin bestand, gelegentlich zusammenzutreffen und den Worten der Machthaber zu lauschen, um danach gebührend – und mit deutschem Gruß – die Vorstellungen Hitlers zu beklatschen. Die Inszenierung der Macht konnte nun ungestört beginnen, der »nationale Aufbruch« ohne Rücksicht organisiert werden. Dazu brauchte es verläßliche Kräfte in allen Bereichen – Männer wie Roland Freisler.
Wenige Wochen nach Hitlers Machtübernahme hatte Freisler ein Schreiben aus Berlin erhalten: seine Berufung als Ministerialdirektor in das preußische Justizministerium. Freisler, gerade vierzig Jahre alt, hatte damit die erste wirklich bedeutsame Stufe der Karriereleiter erklettert. Doch damit nicht genug. Kaum vier Monate später, am 1. Juni 1933, wurde er bereits zum Staatssekretär im preußischen Justizministerium unter der Leitung des Ministers Dr. Hans Kerrl ernannt.
In einem Brief an den »Herrn Rechtsanwalt Dr. Freisler hier im Hause« teilte ihm sein Justizminister am 31. Mai 1933 mit:
»Der Herr Preußische Ministerpräsident hat Sie auf meinen Antrag durch die Ihnen bereits ausgehändigte Bestallung vom 29. d. Mts. unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Staatssekretär im Preußischen Justizministerium ernannt. Das neue Amt wird Ihnen vom 1. Juni 1933 ab übertragen. Von diesem Zeitpunkt ab beziehen Sie unter Einreihung in die Besoldungsgruppe 3 der festen Gehälter ein jährliches Grundgehalt von 24.000 Reichsmark und die Ihnen nach dem Preußischen Besoldungsgesetz sowie sonst etwa zustehenden weiteren Bezüge…
Sie wollen Ihre Löschung in der Liste der Rechtsanwälte bei dem Land- und Amtsgericht in Kassel umgehend herbeiführen … «
Am 19. Juni unterrichtete der neue Staatssekretär den Kasseler Landgerichtspräsidenten von seiner Beförderung und bat um die Löschung aus der Anwaltsliste:
»Nachdem ich unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Staatssekretär im Preußischen Justizministerium ernannt bin, stehe ich auf dem Standpunkt, daß damit meine Eigenschaft als Rechtsanwalt von selbst erloschen ist. Ich nehme deshalb an, daß meine Löschung von Amts wegen in der Liste der Rechtsanwälte beim Land- und Amtsgericht Kassel bereits durchgeführt ist. Für den Fall, daß diese meine Annahme unrichtig sein sollte, bitte ich um meine Löschung in der Liste…
Heil Hitler!«
Auszug aus Freislers Personalakte
Trotz seiner neuen Karriere in Berlin behielt Freisler weiterhin seinen Wohnsitz in Kassel. Auch als kämpferischer NSDAP-Mann trat er dort noch in Erscheinung. Nur kurze Zeit vor seiner Beförderung zum Staatssekretär hatte er mit lokalen Parteigenossen das Kasseler Rathaus gestürmt und war anschließend – ermuntert durch diesen Erfolg – zum Oberlandesgericht gezogen, um das Gebäude ebenfalls in nationalsozialistischen Besitz zu nehmen. Dem Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Anz gelang es jedoch, Freisler und seine Freunde davon zu überzeugen, daß ein Sturm auf das Gericht durch einen hohen preußischen Justizbeamten wohl doch seinem Rang unangemessen sei. Ihm gelang es, Freisler ins Gewissen zu reden und ihn zu überzeugen, von »pöbelhaften Handlungen Abstand zu nehmen«. Der Appell zeigte nur begrenzte Wirkung. Wenig später ließ Freisler unter dem frenetischen Beifall seiner Gefolgsleute die Hakenkreuzfahne über dem Haupteingang des Gerichtsgebäudes hissen.
Monate danach lud Freisler – mittlerweile zum Staatssekretär aufgestiegen – Dr. Anz zur Kaffeestunde nach Berlin ein, wohin er mittlerweile auch seinen Wohnsitz verlegt hatte. Das »mannhafte Verhalten« des Kasseler Oberlandesgerichtspräsidenten, der sich ihm und seinen. Männern damals so energisch entgegengestellt hatte, wußte er nun lobend zu erwähnen. Freisler setzte sogar seinen neugewonnenen Einfluß ein, um Anz zum Berliner Kammergerichtspräsidenten zu befördern. Doch die Macht Freislers war noch zu gering, um die Einwände der Parteiführung zu beseitigen, die keinen Mann an der Spitze des Berliner Kammergerichts akzeptieren wollte, der nicht der NSDAP angehörte.
Freisler war ein Mann mit Widersprüchen. Einerseits war er von nationalsozialistischen Grundsätzen unerschütterlich durchdrungen, andererseits schloß das keineswegs aus, daß er bei anderen eine unparteiliche Haltung respektierte, allerdings nur, wenn sie sich nicht als oppositionell erwies. Ein Mann, der im persönlichen Umgang liebenswürdig sein konnte, aber augenblicklichen Stimmungen unterworfen war. Er galt als launisch, unberechenbar, häufig von schneidender Arroganz.
Mit dem Antritt des ehrgeizigen Staatssekretärs hielt auch ein neuer Umgangston Einzug in die preußischen Justizbehörden. So rief Freisler schon in den ersten Tagen nach seiner Amtsübernahme den Berliner Landgerichtspräsidenten Dr. Kirschstein an und fragte ihn im Verhörton: »Herr Landgerichtspräsident, wie stehen Sie zu den Grundsätzen des Nationalsozialismus?« Als dieser erwiderte: »Ich habe in meinem Leben stets liberale und demokratische Grundsätze vertreten«, antwortete Freisler scharf: »Dann darf ich annehmen, Herr Präsident, daß Sie keinen Wert auf eine Zusammenarbeit mit uns legen.« Kirschstein: »Da haben Sie recht, ich lege keinen Wert auf irgendeine Zusammenarbeit mit dem NS-Regime.« Nach diesen Äußerungen bat Freisler den Landgerichtspräsidenten, sich zukünftig irgendwelcher Diensthandlungen zu enthalten. Das bedeutete das berufliche Ende für Dr. Kirschstein. Es dauerte nicht lange, bis der widerspenstige Landgerichtspräsident – ob unter Druck, wurde nicht bekannt – in den Ruhestand versetzt wurde.
Freislers Umgang mit Untergebenen war eindeutig: Wer seine nationalsozialistische Weltanschauung teilte, durfte mit Wohlwollen und Anerkennung rechnen, wer sich indessen als Andersdenkender oder sogar Oppositioneller erwies, den trafen Freislers Ablehnung und Verachtung.
Die meisten Juristen waren nicht so couragiert wie der Berliner Landgerichtspräsident Dr. Kirschstein. Jetzt, nach 1933, wechselten sie rasch und gehorsam unter das Dach des NS-Staates und halfen tatkräftig beim Aufbau und der Umsetzung einer neuen nationalsozialistischen Justiz.
Die steile Karriere des zu diesem Zeitpunkt vierzigjährigen Dr. Roland Freisler war bis zum Jahr 1933 keineswegs außergewöhnlich verlaufen. Sie entsprach seinem Ehrgeiz, seinem Machtinstinkt, seiner Skrupellosigkeit – auch seiner juristischen Kompetenz. Doch vor allem verdankte er seinen Aufstieg den neuen politischen Verhältnissen. Freislers weitere Karriere – das sollte sich zeigen – würde untrennbar verknüpft sein mit dem NS-Regime und dem moralischen Niedergang der Justiz in den folgenden Jahren – einer Justiz, die geradezu frohgemut in das Lager des Hitler-Regimes wechseln sollte.
Wie konnte das geschehen? Wie konnte sich jene kalte Funktionalität und kaum verständliche Unmenschlichkeit durchsetzen? Wie kam es zur einträchtigen Allianz zwischen den Planern in den NS-Machtzentralen und den willfährigen Vollstreckern in den Justizverwaltungen und Gerichtssälen? Ist das Bild von der »geknebelten«, ja, »leidenden« Justiz, die in ein böses System geraten und diesem schließlich ausgeliefert gewesen war, richtig?
Schon kurz nach der Machtübernahme hatte der Senatspräsident am Reichsgericht und Vorsitzende des »Deutschen Richterbundes«, Karl Linz, den Führer beruhigt, er könne im Namen aller deutschen Richter versichern, »daß sie geschlossen und mit allen Kräften an der Erreichung der Ziele mitarbeiten wollen, die sich die Regierung gesetzt hat…«
Die Richter sollten Wort halten.