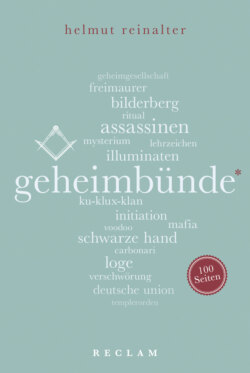Читать книгу Geheimbünde. 100 Seiten - Helmut Reinalter - Страница 7
ОглавлениеGeheimbünde im Europa der Neuzeit
Die Rosenkreuzer
Der Geheimbund der Rosenkreuzer fasste eine »Generalreformation der Welt« ins Auge. Zu seinen Mitgliedern zählten die damalige geistige Elite, darunter der Theologe Johann Arndt, Pansophen und Sozialkritiker wie Johann Valentin Andreae, Pädagogen wie Johann Amos Comenius, Ärzte, Alchemisten und Philosophen wie Michael Maier, der Leibarzt von Kaiser Rudolf II., Rechtsgelehrte wie Christoph Besold sowie der englische Arzt und Polyhistor Robert Fludd. Der Geheimbund erlangte eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für Politik und Wissenschaft.
Er nahm seinen Ausgangspunkt von den rosenkreuzerischen Traktaten, der Fama fraternitatis (1614) und der Confessio fraternitatis, die ein Jahr später in Kassel erschien. In diesen Manifesten finden sich ganz neue begriffsgeschichtliche Kategorien wie »Fortschritt«, »Fortschreiten im Erkenntnisvermögen« und »Aufklärung« als praktische und soziale Aufgabe. Die sogenannte »ältere Bruderschaft der Rosenkreuzer« wollte eine Gelehrtenrepublik gründen, um das umfassende Wissen der Zeit ans Licht zu bringen. Im Mittelpunkt der Traktate stand die Person des Christian Rosenkreuz, auf den wahrscheinlich die Gründung der »Bruderschaft des hochlöblichen Ordens der Rosenkreuzer« zurückgeht.
Als Reaktion auf diese Manifeste erschien 1616 in Straßburg eine weitere Veröffentlichung mit dem Titel Chymische Hochzeit: Christiani Rosenkreutz anno 1459 (gemeint ist ein alchemistisches Symbol des Wandlungs- und Erneuerungsgeheimnisses). Ihr Autor, Johann Valentin Andreae, war wahrscheinlich auch maßgeblich an der Abfassung der erwähnten Rosenkreuzer-Manifeste beteiligt. Posthum erschien Andreaes ausführlicher Bericht über sein Leben, in dem er die Idee einer Weiterführung der Reformation entwickelte. Den Grund für das Versagen der lutherischen Kirche sah er in ihrer Verkümmerung zu einer Staats- und Theologenkirche, aber auch im Zustand der Universität und des Gelehrtenstandes, da sich der Humanismus immer mehr in scholastischer Rechthaberei verliere. Daher forderte er eine Vereinigung, die die Verchristlichung des humanistischen Gelehrtenstandes anstreben sollte.
Mit dieser Reformationsutopie wollte er auf die Zustände reagieren. Offenkundig war sie drei Traditionen verpflichtet: der apokalyptisch-chiliastischen, der alchemistisch-chiliastischen Idee der Naturphilosophen und der Vorstellung von einer idealen Stadt, in der das gesellschaftliche Leben rational geregelt werden sollte. Zur Idee der Weiterführung der lutherischen Reformation kam bei ihm noch die Vorstellung der Lebensgemeinschaft auserwählter Christen in einer gottgewollten Ordnung hinzu.
Unter Chiliasmus versteht man den Glauben an die Wiederkunft Christi und die Errichtung seines tausendjährigen Reiches. Allgemeiner bezeichnet der Begriff den Glauben an das nahende Ende der gegenwärtigen Welt.
In der Schrift Chymische Hochzeit wird die »Einweihung« bzw. Initiation des Christian Rosenkreuz in »sieben Tagen« geschildert, bei der die Alchemie als Symbol des Wandlungs- und Erneuerungsgeheimnisses praktiziert wurde. Daneben verfasste Andreae noch weitere interessante Schriften wie z. B. den Turbo, in dem das Faustthema aufgegriffen und eine anthropologische Auffassung vom Menschen formuliert wurde, die später auch in die Freimaurerei hineinzuwirken begann. Andreae argumentierte darin, dass der Mensch nicht als fertige Persönlichkeit geboren werde, sondern stets an sich weiterarbeiten müsse.
Auch der utopische Entwurf Christianopolis wurde im Umfeld der Rosenkreuzer 1619 von Andreae verfasst. Darin beschreibt er einen idealen Staat, der in einem engen Zusammenhang mit der Nova atlantis (1627) des Francis Bacon und der Civitas solis (1623) von Thomas Campanella zu sehen ist. In der Christianopolis thematisiert Andreae nicht nur das Problem der Bildung einer Elitegesellschaft, sondern entwirft auch eine Gegenwelt. Sie gilt als Paradigma einer Reformationsutopie.
Stellten Sozialstruktur und Wirtschaftsleben der Christianopolis den Idealtyp einer frühneuzeitlichen Stadt dar, so zeigte ihr kulturelles Leben ein frühbürgerliches Bildungsideal, das sich allen modernen Wissenschaften verpflichtet wusste. Zwar hielt Andreae noch am theologisch-kosmologischen Selbstverständnis fest, doch sein Wissenschaftsideal überwand die scholastische und kirchliche Tradition. Als Bischof von Calw versuchte er später, ein organisiertes Sozialwesen auf der Basis eines christlichen Sozialismus zu errichten. Am Ende seines Lebens hat er in der Schrift Theophilus die Idee Christianopolis und seine übrigen Reformprogramme nochmals zusammengefasst.
Dass Andreaes Christianopolis Bacons heute berühmtere Utopie Nova atlantis beeinflusste, ist unumstritten. In Bacons Entwurf kommt dem »Haus Salomonis«, der intellektuellen Führungsspitze in dieser Utopie, eine zentrale Rolle zu, mit gewissen Parallelen zu den späteren Freimaurerlogen. Die weisen Männer im Haus Salomonis sind weitgehend identisch mit den Rosenkreuzern. Bis ca. 1630 kam eine Fülle von Schriften für und gegen das Rosenkreuzertum heraus, die den Rosenkreuzermythos verbreiteten. Wirkungsgeschichtlich entscheidend wurde aber Johann Amos Comenius, der Andreae als geistigen Vater verehrte. Er erfand ein pansophisches System universellen Wissens, in dem die Weltreformation auf pragmatische Weise verwirklicht werden sollte.
Im Mittelpunkt dieses Vorhabens stand die Pädagogik, mit deren Hilfe die Menschen in Wissen, Sprache und Religion vereinigt werden sollten. Comenius forderte in diesem Zusammenhang ein universelles Kollegium. Er entwickelte auch Pläne zu einer Weltverbesserung und brachte sie nach England, womit er eine unmittelbare Verbindung zwischen den Rosenkreuzern und der englischen Freimaurerei herstellte. Genau wie Andreae wollte er auch über alle trennenden Schranken hinweg einen großen »Menschheitsdom« errichten, in dem Menschen aller Völker, Nationen, Sprachen und Religionen zusammentreffen sollten.
Comenius wurde nicht umsonst auf Betreiben von Freimaurern vom englischen Parlament eingeladen, einen Entwurf für eine humanitäre Gelehrtengesellschaft zu verfassen. In seiner Schrift Via lucis (1641) schlägt er ein »Collegium universale« mit Sitz in England vor, das alle Bünde und Bruderschaften der Zeit mit dem Ziel einer Weltreformation vereinigen sollte. In der Satzung waren die Abgeschlossenheit des Bundes und die Verpflichtung seiner Mitglieder zur strikten Verschwiegenheit vorgesehen. Diese Initiative blieb nicht ohne Wirkung, da aus dem »unsichtbaren Collegium« 1660 die erste moderne wissenschaftliche Gesellschaft, die heute noch existierende Royal Society, hervorging, deren Mitglieder damals in enger Beziehung zum Rosenkreuzertum und zur Freimaurerei standen.
Zwischen der älteren Rosenkreuzerbewegung und der im 18. Jahrhundert entstandenen »Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer« bestand personell kein direkter Zusammenhang, wohl aber in ideeller Hinsicht. Der erste Hinweis auf die Gold- und Rosenkreuzer ist eine Schrift von Sincerus Renatus (Samuel Richter) aus dem Jahre 1710: Die wahrhaffte und vollkommene Beschreibung des philosophischen Steins der Bruderschaft aus dem Orden des Gülden- und Rosenkreutzes denen Filiis Doctrinae zum Besten publiciret von S. R. [d. i. Sincerus Renatus]. Die Verbindung von Rose und Kreuz mit dem Gold stand für die Zweiteilung des rosenkreuzerischen Geheimwissens in Theologie und Philosophie. Im »Stein der Weisen« werden Theologie und Philosophie zu einer Einheit zusammengeführt. In einem französischen Ritual einer Rosenkreuzer-Bruderschaft heißt es u. a., dass der philosophische Weg zum Naturgeheimnis und zu zeitlichem Glück führen solle, der theosophische Weg aber in das höchste Geheimnis der Göttlichkeit. Dank der Schrift ist belegt, dass sich Anfang des 18. Jahrhunderts eine Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer neu gegründet hat.
Die älteste Quelle über die Gold- und Rosenkreuzerbruderschaft Aureum Vellus seu Iunioratus Fratum Roseae Crucis von einem Mitglied der »Prager Assemblée« stammt aus dem Jahre 1761. Sie enthält Statuten sowie ein Ritual und wurde zum Teil wörtlich aus der 1749 in Leipzig erschienenen Schrift von Johann Heinrich Schmidt (alias Hermann Fictuld) abgeschrieben. Zweimal wird darin eine »Societät der Goldenen Rosenkreutzer« erwähnt. Vor 1767 bestand die Bruderschaft aus einem Kaiser und einem Vizekaiser, die aber nach der Ordensreform nicht mehr erwähnt werden, und aus sieben Klassen, die sich aus 77 Magi, 700 Majoratsmitgliedern, 1000 Adepti exempti, 1000 Jüngern sowie aus den zuletzt aufgenommenen Personen zusammensetzten. Spätere Organisationsformen waren bereits in ihrer Grundstruktur angelegt. Laut den Statuten war die Aufnahme von Deisten und »Heiden« verboten, während Juden in Ausnahmefällen beitreten durften. Dies stieß aber später auf strikte Ablehnung.
Der Orden wurde 1764 durch die Aufhebung des Prager Zirkels öffentlich bekannt. In diesem Kreis war bereits eine enge Verbindung zwischen den Rosenkreuzern und der Freimaurerei entstanden, was auch aus der Bezeichnung »Loge zur schwarzen Rose« und aus der Möglichkeit einer Doppelmitgliedschaft hervorgeht. Die Integration der Rosenkreuzer in die Freimaurerei wurde vor allem durch das Hochgradsystem begünstigt, das den aufgeklärten Zielen der Maurerei widersprach. Die Rosenkreuzer gaben sich innerhalb dieses Systems als die höchste Stufe der Freimaurerei aus. So wurde z. B. in dem 1777 erlassenen zweiten Hauptplan betont, zur besseren Verbergung der oberen Klassen seien drei unterste Klassen der Freimaurerei als Pflanzschule zu höheren Wissenschaften errichtet worden. Die Mitgliedschaft in der Freimaurerei wurde zur Voraussetzung für die Aufnahme in die Rosenkreuzer-Bruderschaft.
Das Herrschaftssystem des Ordens wurde durch eine Hierarchie des Wissens ideell gefestigt. Dieses System gliederte sich in neun Grade, die dem jeweiligen Stand in der rosenkreuzerischen Ausbildung und der praktischen sowie theoretischen Kenntnis der Lehre der Rosenkreuzer entsprachen. 1777 zählte der Orden bereits 5856 Mitglieder, die sich nun auf neun Grade verteilten: 7 Magi, 77 Magistri, 777 Adepti exempti, 788 Majores, 799 Minores, 822 Philosophi, 833 Practici, 841 Theoretici, 909 Juniores. Die Mitglieder der Bruderschaft waren Naturforscher, Ärzte, höhere Offiziere, Theologen und Abenteurer, stammten also vorwiegend aus höheren bürgerlichen oder adeligen Schichten.
Der Baum der Pansophie, Abbildung aus dem Speculum Sophicum Rhodostauroticum (1618) von Theophilus Schweighardt Constantiens
Die Ziele des Ordens waren religiöser Natur. Im Zentrum stand eine pansophische Emanationslehre, wonach die Natur ein »Ausfluss der Schöpferkraft Gottes und somit selbst ein Stück Gottheit sei«. Im Zuge der Entstehung politischer Richtungen in der Aufklärungszeit politisierte sich auch der Orden stark. Dabei standen eine ausgeprägte Personalpolitik und die Bildung einer sozial integrierenden älteren Gruppe im Vordergrund. Das Beispiel Johann Christoph von Wöllners (1732–1800) zeigt allerdings, dass die Rosenkreuzer auch nach der Politisierung des Ordenszweckes religiös orientiert blieben. Die Auseinandersetzung mit der Aufklärung, die die rosenkreuzerische Politik prägte, war ein ausgeprägter Kampf gegen Irreligiosität, Deismus und Naturalismus. Politisches Gewicht gewann der Orden vor allem in Preußen und mit Abstrichen auch in Bayern.
Nach 1767 breiteten sich die Rosenkreuzer rasch aus und gewannen zunehmend an Einfluss, insbesondere in Süddeutschland, Wien, Sachsen, Schlesien, Berlin und weiteren Gebieten in Norddeutschland, Russland und Polen. Mit der Herrschaft König Friedrich Wilhelms II. von Preußen (1744–1797) erreichte der Orden seinen Zenit, doch bald setzte aufgrund seiner verstärkten politischen Aktivität sein Niedergang ein. Intern kam zudem Kritik auf, da versprochene Wunder ausblieben und der Beschluss des Wilhelmsbader Freimaurer-Konvents von 1782 das Hochgradsystem der Strikten Observanz innerhalb der Freimaurerei und damit den Einfluss der Rosenkreuzer schwächte.
Nach 1787 trat der Orden nicht mehr in Erscheinung. In diesem Jahr wurde ein sogenanntes »Silarium«, der einstweilige Stillstand der Arbeit, verfügt. Das genaue Ende der Rosenkreuzer-Bruderschaft ist ebenso wie ihr Anfang leider nicht exakt zu datieren. Die Rosenkreuzer gelten in der Forschung als geradezu idealer Geheimbund, der wohltätiges, geheimes Wissen bewahrte, im Arkanum wirkte und sich mit einer Mischung aus kirchlichen Reformideen und mystischer Alchemie befasste.