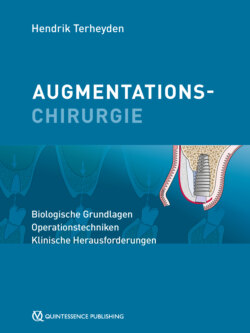Читать книгу Augmentationschirurgie - Luca Cordaro, Hendrik Terheyden - Страница 11
Оглавление3
Knochentransplantate
Knochen besitzt ein ausgeprägtes Heilungspotenzial, das selbst dann noch vorhanden ist, wenn der Knochen zeitweise von der Blutversorgung abgetrennt wird, also avaskulär transplantiert wird. Dies liegt an den im Knochen gespeicherten BMPs und Wachstumsfaktoren sowie am Prinzip des langsamen Umbaus des Knochens von innen heraus. Weil die Knochenstruktur lebenslang ständig funktionell umgebaut wird, können Transplantate in eigenen Knochen umgebaut werden und Knochenverletzungen heilen mit der Zeit narbenfrei aus.
3.1Biologische Wirkung von Knochentransplantaten
Autologe Knochentransplantate bringen drei zur Geweberegeneration notwendige Faktoren mit: Zellen, Matrix und Wachstumsfaktoren (Abb. 3-1).
Abb. 3-1 Knochenregeneration.
Zellen
Vitale, humane, teilungsfähige und osteogen differenzierte Zellen überstehen in Zellkulturexperimenten verschiedene Formen der Osteotomie (Fräsen, Knochenmühle, Auffangen im Knochenfilter, Abb. 3-2, 3-3), wobei Laborstudien zufolge das autologe Beckenkammtransplantat mit Abstand die höchste Ausbeute an vitalen osteogenen Zellen bot, was als Referenz für andere den Goldstandard setzte1 (Abb. 3-4). Unter den Osteotomiemethoden erbrachte die Bone-scraper-Technik und die Knochenmühle eine höhere Ausbeute an kultivierbaren vitalen Zellen als die Piezotechnik und die Fräse2. Es ist noch relativ unklar, wie lange diese nachgewiesenen vitalen Zellen nach einer Knochentransplantation überleben. Die überlebenden Zellen haben eine Relevanz für die osteoinduktive Wirkung des autologen Knochens, denn Studien an Ziegen haben gezeigt, dass Knochentransplantate mit Gehalt von vitalen Zellen eine schnellere und 30 % höhere Ausbeute an regeneriertem Knochen zeigten als dieselben Transplantate mit abgetöteten Zellen3.
Abb. 3-2 a. Knochenmühle nach Bull (Mondeal, Tuttlingen). b. Innenansicht mit abgeschabten Knochenchips. c. Knochenmühle nach Quetin.
Abb. 3-3 a. Wiederverwendbarer Knochenfilter zum Einsetzen in den Absaugschlauch (Schlumbohm GmbH, Brokstedt). b. Geöffneter Filter.
Abb. 3-4 a. Humane Knochenspäne unterschiedlicher Herkunft und Verarbeitung wurden in Zellkulturmedium gegeben. b. Das Wachstum osteogen differenzierter Zellen war am besten bei nativer Beckenspongiosa, aber auch das Abschleifen mit einer Stahlfräse vom Kiefer mit anschließendem Auffangen im Knochenfilter erbrachte noch vitale und teilungsfähige Knochenzellen (nach Springer et al.1).
Wachstumsfaktoren
Auch zellarme Kompaktastücke können transplantiert werden, weil ein wichtiger Teil der osteoinduktiven Wirkung des autologen Knochentransplantats durch seinen Gehalt an Knochenwachstums- und Differenzierungsproteinen wie den Bone Morphogenetic Proteins (BMP) bedingt ist. BMP sind relativ stabile Proteine, die aus frischem Knochen in aktiver Form mit einer Ausbeute von etwa 1 mg pro kg Knochen extrahiert werden können4 und vom Zahnarzt aus dem Knochen durch Eröffnen der Matrix (z. B. Scraper, Fräse etc.) freigelegt und bioverfügbar gemacht werden können.
Matrix
Der dritte Teil der Transplantatwirkung beruht auf der osteokonduktiven Wirkung der autologen Knochenmatrix. Wenn sich Osteoprogenitorzellen differenzieren, benötigen diese eine feste Unterlage zur Anheftung, um zu Osteoblasten zu werden. An der Matrix wachsen die Zellen wie an einer Leitschiene voran. Aber auch Osteoklasten werden aktiviert, die die Matrix resorbieren und BMP freilegen.
Ein Knochenersatzmaterial, das nur die Matrixfunktion erfüllt, kann durch Mischen mit autologen Knochenchips als gemischtes Transplantat osteoinduktive Eigenschaften erlangen und in seiner Effizienz verbessert werden (Abb. 3-5). Hierzu bieten sich der Bonescraper und der Knochenfilter an. Die Geschwindigkeit der Heilung hängt davon ab, ob alle drei Eigenschaften vorhanden sind. Einem Knochenersatzmaterial auf Hydroxylapatitbasis fehlen die zelluläre Komponente und die Wachstumsfaktoren, ebenso fehlt einem reinen Kortikalistransplantat die zelluläre Komponente. Entsprechend langsamer und weniger vorhersagbar im Vergleich zu autologen Beckenknochenblöcken ist die Einheilung dieser Materialien. In anspruchsvollen Defekten, z. B. der Vertikalaugmentation in der Implantologie, sollten möglichst vitale autologe Transplantate mit allen drei Eigenschaften verwendet werden.
Abb. 3-5 Verwendung autologer Knochenchips. a. Fenestrationsdefekt an Implantat 21. b. Gewinnung von Scraperknochen in der Defektumgebung. c. Der SafeScraperTwist (Next Dental, Sheffield, USA) ist ein Einweginstrument. d. Geöffneter Auffangbehälter mit Knochenchips in Form von Flocken, die viel Volumen einnehmen. e. Knochenpartikel im Knochenfilter, gewonnen bei der Implantatosteotomie. f. Knochenersatzmaterial wird mit sterilem autologen Blut gemischt. g. Nachdem alle Partikel mit der sterilen Blutflüssigkeit getränkt sind, wird der Filterknochen hinzugefügt. Dadurch wird eine Blutgerinnung ausgelöst. h. Die Titanoberfläche wird als innerste Schicht des Aufbaus mit den Scraperchips belegt. i. Zuschneiden der Kollagenmembran (Bio-Gide®, Geistlich, Baden-Baden). Der Mittelteil formt eine Zunge, die unter den palatinalen Lappen geklemmt wird. Der rechte Abschnitt dient der Doppellage. j. Einklemmen der Zunge unter den palatinalen Lappen. Das Knochenersatzmaterialgemisch wird nach Gerinnung wie ein Teppich in 4 mm Schichtdicke aufgelegt, die Kontur soll zu den Seiten harmonisch auslaufen. Nach koronal wird ebenfalls überkorrigiert. k. Der Membranabschnitt wird quer als Doppellage aufgelegt und soll die Standzeit der Barriere erhöhen und den Weichgewebelappen vor spitzen Partikeln abpolstern. Die Membran wird nach der Platzierung mit Kochsalzlösung angefeuchtet. l. Mit dem Einzinker wird der Lappen gehalten, und mit dem 15c-Skalpell erfolgt die Periostschlitzung zur Lappenmobilisation. m. Der Nahtverschluss erfolgt in koronal überkorrigierter Position durch Interdentalnähte und Einzelknopfnähte (Supramid 4x0 und 5x0, Resorba, Nürnberg).
3.2Das Transplantatlager
Fehlen einem Augmentationsmaterial eine oder zwei der drei Eigenschaften des autologen Transplantats, so muss das Transplantatlager diese ausgleichen. Umgekehrt muss das Augmentationsmaterial umso vollständiger beschaffen sein, je schlechter das Transplantatlager ist. Die Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt, wenn das Transplantatlager durch Weichgewebevernarbungen oder Allgemeinerkrankungen geschwächt ist. Bei Patienten mit Risikofaktoren ist die Verwendung von vitalem autologem Material ggf. eine sicherere Option als ein Knochenersatzmaterial.
Der Erfolg einer Knochentransplantation hängt ganz wesentlich von der Qualität des Lagergewebes am Empfängerort ab. Es ist entscheidend, ob es sich um ein gutes skelettales Lager (Beispiel Zystenhöhle), das Knochenzellen und BMP zur Verfügung stellt, oder um ein eher schlechtes, weichgewebig begrenztes Lager (Beispiel Unterkieferkontinuitätsdefekt mit minimalem Anschluss zum Restkiefer) handelt. Ein gut durchblutetes Transplantatlager wird als ersatzstarkes Transplantatlager bezeichnet. Je mehr Vernarbungen und Durchblutungsstörungen vorliegen, desto ersatzschwächer ist ein Lager. Eine Bestrahlung mit einer vollen Tumordosis führt zu einem nicht mehr regenerationsfähigen Weichgewebebett, das als ersatzunfähiges Lager bezeichnet wird.
Die Materialwahl in einem Knochendefekt hängt entscheidend von der Defektwandigkeit des Transplantatlagers ab, wie die Abfolge der Ein-, Zwischen-, An- und Auflagerungsosteoplastik zeigt.
3.3Der Goldstandard – das autologe Beckenknochentransplantat
Als Goldstandard der Knochentransplantation wird das autologe monokortikale Beckenkammtransplantat im internationalen Schrifttum fachübergreifend5–9 in Bezug auf seine klinische Vorhersagbarkeit und Heilungspotenz im Vergleich zu Materialien anderer Herkunft bezeichnet. Das autologe Beckenknochentransplantat weist im physiologischen Verhältnis Zellen, Wachstumsfaktoren und eine interkonnektierende Porosität der Matrix auf. Mit der autologen Knochentransplantation ist ein hoher Grad der Vorhersagbarkeit mit einer komplikationsarmen Wundheilung in kürzester Zeit verbunden. Der Begriff Goldstandard meint eine Referenz für die biologische Potenz, nicht automatisch das beste Material seiner Gruppe. Der Begriff Goldstandard kommt aus der Volkswirtschaft und bezeichnet eine Bezugsgröße für eine Währung, nicht automatisch das wertvollste Material. Zum Beispiel haben rekombinante Bone Morphogenetic Proteins in mancher Studie auch eine höhere Regenerationsleistung als das Beckenknochentransplantat gezeigt6.
3.4Spenderorte, Qualität und Entnahmemorbidität autologer Knochentransplantate
Für die Knochenregeneration steht eine Vielzahl von autologen Knochentransplantaten unterschiedlicher intraoraler Spenderorte zur Verfügung (Abb. 3-6). Bei größerem Mengenbedarf kann Knochen am Schädeldach und am anterioren und posterioren Beckenkamm entnommen werden (Abb. 3-7). Die verschiedenen Herkunftsorte und Gewinnungstechniken unterschieden sich in ihrer Invasivität und Patientenbelastung und in ihrer biologischen Effektivität. Weil in Spongiosatransplantaten vitale osteogene Zellen enthalten sind, eignen sie sich zur Behandlung von kritischen Defekten auch im schlechten Transplantatlager. Kompaktablöcke hingegen widerstehen der Oberflächenresorption der Einheilphase besser als partikuläre Transplantate. Sie stellen aber höhere Anforderungen an das Lager und an das Verhalten des Patienten. Wegen der höheren Dehiszenzgefahr im Vergleich zu partikulären Transplantaten sollte die Weichgewebebedeckung perfekt sein und der Patient sollte zum Beispiel nicht darauf Kauen. Die Bearbeitung mit Mühlen oder Fräsen reduziert die Zellteilungsfähigkeit in den Transplantaten1.
Abb. 3-6 Intraorale Gewinnung von autologem Knochen.
Abb. 3-7 Extraorale Gewinnung von autologem Knochen.
Scraperspäne, Frässpäne, Piezospäne
Zur Versorgung kleinster Knochendefekte und als Füller sind häufig Scraperspäne die beste Alternative. Scraperknochen ist einfach zu gewinnen, hat eine hohe Oberfläche mit freigelegten BMPs und hat ähnlich wie Kartoffelchips ein hohes Volumen. Einer In-vitro-Studie nach hatte die Spangewinnung mit dem Piezogerät gegenüber dem manuellen Scraper eine minimale nicht signifikante Einschränkung der Zellvitalität zur Folge7.
Relativ atraumatisch lassen sich Frässpäne bei solchen Implantatsystemen gewinnen, die niedrigtourige Spiralbohrer verwenden (Abb. 3-8). Bei jeder Bohrung sammeln sich die Späne in den Spiralwindungen, die mit Kochsalzlösung herausgespült und in einem Gefäß feucht zwischengelagert werden können. In spongiösem Knochen kann es sogar verantwortet werden, in Schrittgeschwindigkeit mit frischen scharfen Bohrern ohne Wasserkühlung zu arbeiten, um möglichst viele Späne zu gewinnen.
Abb. 3-8 Die Rillen dieses Spiralbohrers (Camlog, Wimsheim) haben sich beim niedrigtourigen Bohren mit Knochenspänen gefüllt, die gesammelt und aufbewahrt werden können.
Knochenkollektoren
Frässpäne aus einem Knochenkollektor, das ist ein in den Absaugschlauch integriertes Sieb, haben das Risiko einer höheren bakteriellen Kontamination als Scraperspäne, enthalten aber vitale teilungsfähige und osteogen differenzierte Zellen1. Um die Kontamination durch Speichelbakterien möglichst gering zu halten, ist die Einschaltung des Kollektors nur kurzzeitig während der Implantatbohrung oder während anderer Knochenarbeiten zu empfehlen. Es gibt verschiedene Ansätze, die Filterknochenpartikel zu desinfizieren. Dies geht aufgrund der toxischen Wirkung der Desinfizientien aber mit einer erhöhten Nekroserate der Knochenzellen und Inaktivierung der Wachstums- und Differenzierungsfaktoren einher8, weshalb sich diese Methode noch nicht durchgesetzt hat bzw. in der Entwicklung befindet. Derzeit ist 1 Minute Einwirkzeit von 0,2 % Chlorhexidinlösung das schonendste Verfahren aufgrund von Studiendaten9, wird aber vom Autor nicht verwendet.
Trepanspäne
Bei Trepanbohrern entstehen durch hohe Rotationsgeschwindigkeit und die große Oberfläche leicht Kühlungsprobleme, sodass wenig Druck und reichlich Kochsalzlösung zur Spülung verwandt werden soll. Es gibt Trepanbohrer mit Innenschneiden, die den Trepan zeitgleich zu Partikeln zermahlen und in einem Reservoir sammeln. 2,5-mm-Knochenstanzen lassen sich mit 3,5-mm-Trepanbohrern gewinnen, die anstelle der Implantatvorbohrung benutzt werden. Die Kerne werden mit Mikroschrauben im Empfängerort befestigt10. Meistens werden Knochentrepanzylinder am Kinn gewonnen (Abb. 3-9).
Abb. 3-9 Entnahme von Trepanspänen aus dem Kinn.
Knochenmühle, partikuläre Transplantate
Knochentransplantate können durch eine Knochenmühle zerkleinert werden. Die Zerspanung von Kompaktastücken bringt die eingeschlossenen Wachstumsfaktoren und osteoinduktiven Proteine an die Oberfläche und vergrößert das Volumen des Knochentransplantats ganz erheblich. Dafür sinkt die Zahl der vitalen Knochenzellen. Derartige Knochenpartikel lassen sich als Füller neben größeren Transplantaten oder zur Sinusbodenaugmentation einsetzen.
Intraorale Blocktransplantate von Linea obliqua, Crista zygomaticoalveolaris, Tuber maxillae und Kinn
Das Linea-obliqua-Transplantat (Abb. 3-10) hat ein besseres Nutzen-Risiko-Profil als der Kinnknochenblock (Abb. 3-11). Einer prospektiven Studie an 45 Patienten zufolge traten mit 40 % der Fälle sechsmal so viele Gefühlsstörungen in der Kinngruppe verglichen mit der Linea obliqua auf, wovon nach einem Jahr bei 2 Patienten der Kinngruppe versus keinen Patienten der Linea-obliqua-Gruppe permanente Restzustände verblieben waren. Die Patientenakzeptanz war zwischen Kinn und Linea obliqua gleich, aber signifikant höher, wenn die Blockentnahme mit der Entfernung eines Weisheitszahnes kombiniert worden war11. Eine retrospektive vergleichende Studie wies auf das Risiko einer verbleibenden dauerhaften Schädigung des Nervus buccalis mit gestörter Sensibilität des Vestibulums und der Innenwange hin12. Diese Komplikation wird vermieden, wenn der distale Entlastungsschnitt auf den aufsteigenden Unterkieferast nicht länger als 1 cm ausfällt.
Abb. 3-10 a. Freilegen der Linea obliqua und Anzeichnung der Transplantatlage mit einem Bleistift. b. Streng monokortikale Osteotomie seitlich des Siebeners mit der Lindemannfräse in Ausrichtung parallel zur Außenwand, vorderer und hinterer Schnitt, Verbindungsschnitt in Längsrichtung. Hier abgebildet, geschützte Mini-Kreissäge nach Khoury (Dentsply Sirona, Mannheim). c. Anpassen des Knochenblocks als vestibuläre Schalentechnik. d. Osteosynthese durch Zugschraube (1,5-mm-System, KLS Martin, Tuttlingen). e. Linea obliqua und Lage der Transplantatentnahme (gestrichelt maximal mögliche Ausdehnung). Die Transplantatentnahme sollte zur Vermeidung von Frakturen nicht im hochbelasteten aufsteigenden Kieferast erfolgen (X).
Abb. 3-11 a. Entnahme eines monokortikalen autologen Knochenblocks vom Kinn. b. Osteosynthese zur lateralen Augmentation in der regio 32-33. c. Aufschließen des Blocks zur rascheren Integration durch perforierende Kortikalisbohrungen. Gewinnung der Chips durch den Knochenfilter.
Der Kinnknochen hat einige bedeutende Nachteile. Zu seiner Gewinnung wird der Musculus mentalis abgeschoben. Dies resultierte in einer prospektiven Studie in einer messbaren postoperativen Kinnptose von 1,65 mm im Durchschnitt erhöhter unterer Zahnschau13, einer Komplikation, die man kennen muss, getreu Goethes italienischer Reise „Man sieht nur, was man weiß“. Der Autor hebt daher Kinnknochentransplantate nur, wenn keine anderen Knochenquellen in Frage kommen, und dann über einen Längsschnitt im Lippenbändchen ohne Ablösung des Musculus mentalis. Das Blocktransplantat vom Kinn sollte auch deshalb nicht im Regelfall eingesetzt werden, weil man ungewollt einen nach lingual perforierenden Defekt erzeugen kann, der nicht mehr vollständig abheilt. Bei großen Kinnknochentransplantaten sind Beeinträchtigungen der äußeren Weichteilkontur möglich. Die Hauptkomplikation der Kinnknochenentnahme sind etwa 30 % devitale untere Frontzähne14, auch weil der Nervus incisivus im Schnitt nur 3 mm unter der bukkalen Kompakta liegt15. Einer systematischen Übersichtsarbeit zufolge bevorzugten die Patienten sogar den Beckenkammblock gegenüber dem Kinnblock16. Das Kinn sollte ein Entnahmeort zweiter Wahl sein, wenn andere Orte bereits ausgenutzt worden sind.
Zusammenhängende Knochenspäne, die sich zum horizontalen oder vertikalen Kieferkammaufbau eignen, können auch vom Tuber maxillae gewonnen werden. Die Späne vom Tuber maxillae sind recht spongiös aufgebaut und haben eine höhere Resorptionsneigung als Späne von der Linea obliqua. Sie haben aber nur eine etwa halb so hohe Knochendichte wie Späne von der Linea obliqua17. Am Tuber lassen sich auch kombinierte Knochen-Weichgewebestanzen zur Ridge Preservation mit gleichzeitiger Wandrekonstruktion gewinnen18 (Abb. 3-12). Dabei sollte man aber nicht die Kieferhöhle eröffnen.
Abb. 3-12 a. Extraktion von 21 bei Verlust der bukkalen Alveolenwand. b. Ridge Preservation mit simultaner Wandrekonstruktion durch ein dreischichtiges Haut-Bindegewebe-Knochentransplantat vom Tuber maxillae.
Auch von der Crista zygomaticoalveolaris kann mithilfe des Piezogerätes unter Schonung der Kieferhöhlenschleimhaut ein intraorales Blocktransplantat mit minimaler Entnahmemorbidität gewonnen werden19.
Blocktransplantate vom Schädeldach (Calvaria)
Der Schädelknochen ist einer der am stärksten mineralisierten Knochen des Körpers, zehnmal höher als der Beckenkamm. Er widersteht bei Augmentationen verglichen mit Beckenknochen sehr lange der Resorption und wird deshalb gelegentlich für Augmentationen bevorzugt. In einer retrospektiven Studie am Oberkiefer wurden 33 % Höhenresorption für Beckenknochen versus 11 % für Schädelknochen berichtet20 (Abb. 3-13). Allerdings ist die Entnahme chirurgisch relativ anspruchsvoll (Abb. 3-14). Das Schädeldach besteht parietal auf beiden Seiten der Mittellinie im Regelfall aus zwei Tafeln, von denen die äußere als Transplantat gehoben werden kann. Der Aufwand und die Komplikationsmöglichkeiten sind verglichen mit Beckenknochenspänen höher. Allerdings war der unmittelbar postoperative Schmerz in einer prospektiven Untersuchung signifikant geringer als beim Beckenknochen21. Dieselben Autoren berichteten in einer früheren Studie22 aber auch, dass es in 11 % der Fälle zu Duraexpositionen gekommen war und dass die Entnahmedefekte mit Knochenzement gedeckt werden mussten, um keine Dellen im Schädeldach zu erzeugen. Dies sind doch erhebliche Nachteile.
Abb. 3-13 Nachuntersuchung der Augmentationshöhe nach Auflagerungsosteoplastik. Die autologen Schädelknochentransplantate zeigen kaum Höhenverlust durch Resorption (gepunktet), während die autologen Beckenkammtransplantate (durchgezogene Linien) einige Millimeter Höhe innerhalb der ersten Monate verlieren (modifiziert nach Mertens et al.20).
Abb. 3-14 a. Freilegung der Tabula externa des Schädels durch paramedianen Längsschnitt in der behaarten Kopfhaut. Eröffnung der Diploeschicht durch Kugelfräse in Rechteckform. Die Späne werden im Filter gewonnen. b. Aufgrund der Schädelkonvexität kann die oszillierende Säge flach in der Diploeschicht eingesetzt werden. c. Letztes Trennen der Spongiosaschicht der Diploe mit dem Blattmeißel. d. Entnahme eines etwa 6x4 cm großen Kortikalistransplantats mit innen anhaftenden Spongiosa.
Spongiosastanzen (Becken, Tibiakopf)
Große Spongiosamengen lassen sich schonend am vorderen oder hinteren Beckenkamm gewinnen. Die schonendste Technik, die auch in Lokalanästhesie eingesetzt werden kann, ist die Trepanstanze am Becken (Abb. 3-15). Über einen 1 cm langen Hautschnitt werden fächerförmig etwa 2 cm lange Trepanstanzen im Handbetrieb gewonnen. Wenn man hierbei die innere und äußere Kompakta der Beckenschaufel nicht perforiert, ist nur mit einer minimalen Traumatisierung und postoperativen Beschwerden zu rechnen. Allerdings können bei ungeübter Handhabung größere Blutungen verursacht werden. Ein analoges Verfahren wird am Tibiakopf zur Gewinnung von Spongiosastanzen angewandt mit anfänglich signifikant geringeren Schmerzwerten als am Beckenkamm23.
Abb. 3-15 a. Trepanstanzen mit Kreuzgriff (unten) zum Drehen im Handbetrieb. b. Gewonnene autologe Spongiosastanzen aus dem Beckenkamm.
Monokortikale Beckenspäne
Der Beckenknochen war in der Berichterstattung der letzten 20 Jahre angesichts aufkommender Alternativen im Tissue Engineering zu negativ bewertet worden. Das Tissue Engineering konnte aber die Erwartungen bislang nicht erfüllen, sodass immer noch der Beckenkamm Standard ist, wenn intraorale Transplantate oder Knochenersatzmaterialien nicht ausreichen. Die Studien mit hohen Entnahmemorbiditäten stammten großenteils aus der Orthopädie und Neurochirurgie. In diesen Fächern werden häufig sehr große Knochenmengen bikortikal mit entsprechenden Defekten entnommen (Abb. 3-16). Bei richtiger monokortikaler Entnahmetechnik kleinerer Mengen für die Implantologie von der Innenseite ist die Komplikationsrate sehr gering (Abb. 3-17). In einer randomisierten prospektiven Studie traten keine Komplikationen am Beckenkamm auf. Auf einer visuellen Analogskala (VAS 0-100) betrug der postoperative Schmerz 40 und ging innerhalb von 14 Tagen auf 4 zurück, bei gleichzeitig hoher Zufriedenheit der Pateinten von 93 Punkten auf der VAS5. Eine Vorstellung über das Maß der Belastung durch eine Beckenknochenentnahme für implantologische Zwecke vermittelt folgende Studie24. Nur bei 38 % der Patienten traten überhaupt Entnahmeschmerzen an der Hüfte auf, die nach durchschnittlich 18,1 Tagen verschwunden waren. Der stationäre Aufenthalt lag bei 4,3 Tagen, 20,2 Tage Krankschreibung wurden angeordnet bei 90,5 % Gesamtzufriedenheit der Patienten.
Abb. 3-16 Großer hufeisenförmiger monokortikaler Beckenspan zur Auflagerungsosteoplastik des atrophierten Unterkiefers, einzeitig direkt mit Zahnimplantaten versorgt.
Abb. 3-17 Schonende Entnahme des Beckenknochens über 2,5 cm langen Hautschnitt medial der Crista iliaca. Vermeidung der Spina iliaca (Anzeichnung) mit Schonung des dort laufenden Nervus cutaneus femoris lateralis. Knochenentnahmen nur von der Innenseite und Schonung der äußeren Muskelansätze zur Schmerzvermeidung.
Auch die Resorptionsneigung, die dem Beckenknochen nachgesagt wurde, ist eine Frage der Operationstechnik, denn sichere Osteosynthese, Vermeidung von reinen Blockauflagerungen und ein gutes Timing der okklusalen Belastung durch Zähne oder Zahnimplantate verhindern Resorptionen. In einer großen Studie zu Blockauflagerungen im atrophierten interforaminären Unterkiefer betrug die Langzeitresorption bei 16 mm Aufbauhöhe nur 2 mm nach 10 Jahren, übrigens auch ein Beispiel für den knochenprotektiven Effekt von Zahnimplantaten25.
Mikrochirurgisch anastomosierte Knochentransplantate
Der mikrochirurgisch anastomosierte, vaskularisierte Knochenspan (Fibula, Becken, Schulterblatt) ist eine gute Wahl bei großen Tumor- und Unfalldefekten. In der präprothetischen Chirurgie ist er eine seltene Ausnahmesituation und zum Beispiel schwersten Kieferatrophien nach Versagen anderer Verfahren vorbehalten (Abb. 3-18 und 3-19).
Abb. 3-18 a. Völliger Verlust des Oberkiefers nach Verletzung durch einen Vorschlaghammer bei einem 43-jährigen Pateinten. Hier Ersatz des Orbitabodens durch ein patientenindividuelles Keramikimplantat. b. Intraorale Ansicht des Oberkieferdefekts mit Fistel zur Nase. c. Formung eines neuen Oberkiefers durch zweimalige Osteotomie des Wadenbeins, dazwischen die Hautinsel der Fibula zum Ersatz des Gaumens. Oben der Gefäßstiel der Vena und Arteria peronea. d. Oberkieferrekonstruktion unter mikrochirurgischer Anastomosierung der Fibulagefäße mit der Arteria und Vena facialis. e. Seitliches Fernröntgenbild vor Rekonstruktion mit Defekt. f. Seitliches Fernröntgenbild nach Rekonstruktion mit verbesserter Weichgewebeprojektion. g. Insertion von Zahnimplantaten in den Fibulaknochen. h. Zahnimplantate (Spiegelaufnahme) im rekonstruierten Oberkiefer. i. Prothetische Versorgung (Dr. Szyczewski, Poznan).
Abb. 3-19 a. Ameloblastom im linken Unterkiefer bei einem 24-jährigen Patienten. b. Kieferrekonstruktion durch doppelläufiges (double barrel) Fibulatransplantat, mikrochirurgisch anastomosiert. c. Abgeheilter Entnahmedefekt der Fibula ohne funktionelle Einschränkungen. d. Insertion von Zahnimplantaten in den Fibulaknochen. e. Prothetische Versorgung durch metallkeramische Einzelkronen mit Restitutio ad integrum.
3.5Literatur
1Springer IN, Terheyden H, Geiss S, Härle F, Hedderich J, Açil Y. Particulated bone grafts – effectiveness of bone cell supply. Clin Oral Implants Res 2004;15:205–212.
2Miron RJ, Gruber R, Hedbom E, Saulacic N, Zhang Y, Sculean A, Bosshardt DD, Buser D. Impact of bone harvesting techniques on cell viability and the release of growth factors of autografts. Clin Implant Dent Relat Res 2013;15:481–489.
3Kruyt MC, Delawi D, Habibovic P, Oner FC, van Blitterswijk CA, Dhert WJ. Relevance of bone graft viability in a goat transverse process model. J Orthop Res 2009;27:1055–1059.
4Urist MR, Sato K, Brownell AG, Malinin TI, Lietze A, Huo YK, Prolo DJ, Oklund S, Finerman GA, DeLange RJ. Human bone morphogenetic protein (hBMP). Proc Soc Exp Biol Med 1983;173:194–199.
5Putters TF, Wortmann DE, Schortinghuis J, van Minnen B, Boven GC, Vissink A, Raghoebar GM. Morbidity of anterior iliac crest and calvarial bone donor graft sites: a 1-year randomized controlled trial. Int J Oral Maxillofac Surg 2018;47:1474–1480.
6Kim HJ, Buchowski JM, Zebala LP, Dickson DD, Koester L, Bridwell KH. RhBMP-2 is superior to iliac crest bone graft for long fusions to the sacrum in adult spinal deformity: 4- to 14-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 2013;38:1209–1215.
7Pekovits K, Wildburger A, Payer M, Hutter H, Jakse N, Dohr G. Evaluation of graft cell viability-efficacy of piezoelectric versus manual bone scraper technique. J Oral Maxillofac Surg 2012;70:154–162.
8Sawada K, Fujioka-Kobayashi M, Kobayashi E, Schaller B, Miron RJ. Effects of Antiseptic Solutions Commonly Used in Dentistry on Bone Viability, Bone Morphology, and Release of Growth Factors. J Oral Maxillofac Surg 2016;74:247–254.
9Sawada K, Nakahara K, Haga-Tsujimura M, Fujioka-Kobayashi M, Iizuka T, Miron RJ. Effect of Irrigation Time of Antiseptic Solutions on Bone Cell Viability and Growth Factor Release. J Craniofac Surg 2018;29:376–381.
10Khoury F, Doliveux R. The Bone Core Technique for the Augmentation of Limited Bony Defects: Five-Year Prospective Study with a New Minimally Invasive Technique. Int J Periodontics Restorative Dent 2018;38:199–207.
11Raghoebar GM, Meijndert L, Kalk WW, Vissink A. Morbidity of mandibular bone harvesting: a comparative study. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;2:359–365.
12Clavero J, Lundgren S. Ramus or chin grafts for maxillary sinus inlay and local onlay augmentation: comparison of donor site morbidity and complications. Clin Implant Dent Relat Res 2003;5:154–160.
13Nóia CF, Rodríguez-Chessa JG, Ortega-Lopes R, Cabral-Andrade V, Barbeiro RH, Mazzonetto R. Prospective study of soft tissue contour changes following chin bone graft harvesting. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41:176–179.
14Nóia CF, Ortega-Lopes R, Fernandes Moreira RW, Mazzonetto R. Prospective clinical assessment of pulp sensitivity after chin bone harvesting. Implant Dent 2013;22:199–202.
15Vu DD, Brockhoff HC 2nd, Yates DM, Finn R, Phillips C. Course of the mandibular incisive canal and its impact on harvesting symphysis bone grafts. J Oral Maxillofac Surg 2015;73:258.e1–258.e12.
16Nkenke E, Neukam FW. Autogenous bone harvesting and grafting in advanced jaw resorption: morbidity, resorption and implant survival. Eur J Oral Implantol 2014;7 Suppl 2:S203–S217.
17Kamal M, Gremse F, Rosenhain S, Bartella AK, Hölzle F, Kessler P, Lethaus B. Comparison of Bone Grafts From Various Donor Sites in Human Bone Specimens. J Craniofac Surg 2018;29:1661–1665.
18Raghoebar GM, Meijer HJA, van Minnen B, Vissink A. Immediate Reconstruction of Failed Implants in the Esthetic Zone Using a Flapless Technique and Autogenous Composite Tuberosity Graft. J Oral Maxillofac Surg 2018;76:528–533.
19Sakkas A, Schramm A, Karsten W, Gellrich NC, Wilde F. A clinical study of the outcomes and complications associated with zygomatic buttress block bone graft for limited preimplant augmentation procedures. J Craniomaxillofac Surg 2016;44:249–256.
20Mertens C, Decker C, Seeberger R, Hoffmann J, Sander A, Freier K. Early bone resorption after vertical bone augmentation--a comparison of calvarial and iliac grafts. Clin Oral Implants Res 2013;24:820–825.
21Wortmann DE, Boven CG, Schortinghuis J, Vissink A, Raghoebar GM. Patients’ appreciation of pre-implant augmentation of the severely resorbed maxilla with calvarial or anterior iliac crest bone: a randomized controlled trial. Int J Implant Dent 2019;5:36.
22Kuik K, Putters TF, Schortinghuis J, van Minnen B, Vissink A, Raghoebar GM. Donor site morbidity of anterior iliac crest and calvarium bone grafts: A comparative case-control study. J Craniomaxillofac Surg 2016;44:364–368.
23Huang YC, Chen CY, Lin KC, Renn JH, Tarng YW, Hsu CJ, Chang WN, Yang SW. Comparing morbidities of bone graft harvesting from the anterior iliac crest and proximal tibia: a retrospective study. J Orthop Surg Res 2018;13:115.
24Gjerde CG, Shanbhag S, Neppelberg E, Mustafa K, Gjengedal H. Patient experience following iliac crest-derived alveolar bone grafting and implant placement. Int J Implant Dent 2020;6:4.
25Boven GC, Meijer HJ, Vissink A, Raghoebar GM. Reconstruction of the extremely atrophied mandible with iliac crest onlay grafts followed by two endosteal implants: a retrospective study with long-term follow-up. Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43:626–632.