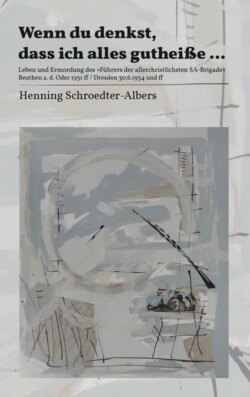Читать книгу Wenn du denkst, dass ich alles gutheiße … - Henning Schroedter-Albers - Страница 10
Beuthen 1931
ОглавлениеSie war im Juli 1931 nach Erledigung ihrer Klausuren an der Universität Königsberg wie jeden Sommer in den Semesterferien für eine Woche nach Berlin zu ihrer Mutter gefahren, um ihr dankbar und mit verantwortungsvoller Liebe haargenau über den Aufenthalt und den Fortgang ihrer Studien zu berichten, besonders auch über die für sie enttäuschend wenigen Treffen mit ihrem Onkel Alfred Mitscherlich, dem mütterlichen Cousin, der zu dieser Zeit aufgrund seiner hohen wissenschaftlichen Forschungsverdienste in der Landwirtschaft turnusmäßig gerade Rektor der Universität geworden war. Sie hatte sich von der verwandtschaftlichen Beziehung deutliche Unterstützung in ihrer schwachen finanziellen Lage erhofft, nämlich dass sie öfters eingeladen würde und sich dadurch die Mahlzeiten in der Mensa hätte sparen können. Stattdessen hatte sie bei Kurzbesuchen eine dermaßen arbeitgetriebene Familienatmosphäre erlebt, dass sie wahres Mitleid für die Kinder, aber insbesondere für die unter Leistungsdruck stehenden Söhne empfand und sie sich stets zu schneller Flucht aus dem arbeitsbesessenen Haus gedrängt fühlte.
Umso mehr freute sie sich nun auf die Aufnahme bei ihrer Tante Else, der Cousine ihrer Mutter, die jeden Sommer sie bereitwillig und warmherzig in ihrem Haus in Beuthen empfing und ihr alle Freiheiten gewährte, deren sie nach einem anstrengenden Semester bedurfte. Denn sie musste die ihr seit Studienbeginn gewährte Gebührenermäßigung regelmäßig mit Fleißarbeiten und besonders guten Klausurnoten rechtfertigen. Ihre Mutter Rita hatte ihre reiche Erbschaft auf Anraten ihres Ehemanns, eines Offiziers, vollständig in Kriegsanleihen angelegt und entsprechend nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs den Großteil ihres Vermögens verloren. Sie lebte nunmehr geschieden in Berlin-Schöneberg in einer immer noch weitläufig herrschaftlich zu nennenden Wohnung, war aber genötigt, mehrere Zimmer an gut situierte Herren zu vermieten, um über ein Einkommen zu verfügen und wenigstens ihrer Tochter eine für sie wichtige »gesellschaftlich angemessene« Ausbildung zu ermöglichen.
Ein mehrwöchiger Sommeraufenthalt in Beuthen war für Beatrice jährlich ein heiß ersehnter Genuss: die üppig angebotenen Mahlzeiten der lebensfrohen Tante, die mit den Cousins und Cousinen bis in die Nächte geführten hitzigen Gespräche über alles Mögliche, was sie gemeinsam interessierte: Kunst, Religion, Literatur, Philosophie … , die Bademöglichkeiten vom Oderstrand aus, bis zu dem das Privatgrundstück der Familie reichte, die Radausflüge – das alles erschien ihr wie ein Paradies im Vergleich zu den ihr oft grausig langweilig und trocken erscheinenden Vorlesungen, die sie besuchen musste.
Überdies war für sie das Haus der Familie selbst schon ein Anziehungspunkt: die Beuthener Villa soll ursprünglich der Witwensitz der auf der gegenüberliegenden Oderseite ansässigen Fürsten von Carolath gewesen sein. Diese mündliche Überlieferung ist aber tatsächlich nie durch Urkunden belegt worden. Die Villa lag am Stadtrand der Kleinstadt Beuthen, war wie das Schloss Carolath von riesigen Fliederbüschen zur Landstraße nach Glogau abgegrenzt und hinter dem Gebäude mit einem von Tante Else liebevoll und mit langjähriger Gärtnererfahrung gepflegten Obstgarten verbunden, der in Oderwiesen bis zum Oderstrand überging. Das war wie geschaffen für die Wasserratte Beatrice; sie gab es offen zu: das größte Vergnügen, mehrmals am Tag – bereits im Badeanzug – vom Haus aus die fünfzehn Minuten im Dauerlauf bis zum Wasser zu spurten, dann erst einmal tief durchzuschnaufen, die Glieder zu strecken und dann nichts wie rein in den Strom zu springen. Wenn sie von den gleichaltrigen Familienmitgliedern begleitet wurde, war sie stets die Erste am Ufer. Ihre Augen leuchteten stolz den Nachkommenden entgegen: »Entschuldigt, ich will nicht angeben, aber irgendetwas muss ja aus meinem Studium der Leibesübungen herauskommen«.
Als sie Ende Juli 1931 in Beuthen ankam, verbrachte sie gleich frohgemut den Spätnachmittag mit drei Cousins von fünf Kindern der Familie, nämlich mit ihrer gleichaltrigen Cousine Waltraut und deren jüngeren Brüdern Siegfried und Hans an der Oder. Sie frönten mit Genuss der angenehm warmen Sonne, sprangen immer wieder ins Wasser, bis sie sich entspannt darüber austauschten, was sie zurzeit beschäftigte.
Waltraut erzählte – wie immer sehr sachlich, für die übermütige Beatrice manchmal zu ernsthaft – über ihre Ausbildung in Berlin als Lehrerin in rhythmischer Gymnastik bei dem damals für Frauen neuartig künstlerisch-sportlichen Ausbildungsangebot des bekannten Bode-Instituts.
Siegfried berichtete mit witzigen Anekdoten über die Pfarrersfamilie Bronisch im brandenburgischen Züllichau, bei der er für den Gymnasiumsbesuch untergebracht war.
Hans hörte nur aufmerksam zu, er hielt sich bescheiden mit seinen dreizehn Jahren zurück: »Was kann ich schon Großes erzählen!? Ich bin hier glücklich mit Mama, mit meinen Freunden in der Nachbarschaft. Die Schule in Glogau ist mit ihren Lehrern nichts Besonderes.«
Als sie am Abend mit der Mutter im Salon saßen, drängte Beatrice ihre Cousine, ihre Eindrücke von Berlin zu schildern, wie sie die Geschehnisse der sich bekämpfenden Parteien auf den Straßen beurteilte. Sie hatte in Königsberg nur bruchstückweise darüber in Zeitungsnachrichten erfahren. Und während ihres kurzen Besuchs bei ihrer Mutter hatte sie sich ganz der kirchlichen Sozialarbeit ihrer Gemeinde in Berlin-Schöneberg gemeinsam mit ihrer Mutter Rita gewidmet und nur wenig mit ihr über die politische Entwicklung gesprochen.
Waltraut enttäuschte sie. Ihre Cousine lebte asketisch konzentriert ganz ihrer Ausbildung, fern vom Rummel der Großstadtmitte und hatte nach ihren eigenen Angaben im Dahlemer Viertel nichts Aufregendes beobachten können. Als Beatrice sie über ihr Zimmer dort befragte, erzählte sie beiläufig, dass sie – wie auch schon in München davor – eigentlich immer bei jüdischen Witwen in Untermiete wohne. Bei ihnen fühle sie sich am wohlsten. Sie seien immer freundlich, zurückhaltend, mit ihren Mietkosten durchaus günstig. Und vor allem könne sie sich immer bei ihnen Rat holen, wo sie was preiswert kaufen kann.
Beatrice schaute ihre Cousine gespannt an: »Und du hörst von diesen Frauen nicht, wie sie sich von dieser Dreckspartei bedroht fühlen?«
Waltraut erwiderte den Blick gelassen: »Du meinst die NSDAP? Die nimmt doch niemand ernst! Solange Hindenburg und andere dagegen stehen.« Sie stockte. »Ja, doch, ich erinnere mich. Vor einem halben Jahr sagte mir eine Vermieterin: Mich schüttelt es, wenn ich auf dem Bürgersteig die Aufrufe dieser gefährlichen Halunken liegen sehe. Ich konnte die arme Frau gar nicht genug beruhigen.«
Siegfried lachte abgehackt auf: »Wisst ihr, was mich mein Geschichtslehrer vor kurzem gefragt hat? Ob es in meiner Familie Juden gibt. Meine braunen Augen und meine Nase … Er zeigte sich richtig besorgt«. Er lachte weiter.
»Siegfried!« kam es da für alle überraschend mit empörter Stimme aus einer bisher ruhigen Ecke des Salons, wo die Mutter ruhig in Stopfarbeit von Strümpfen versunken schien. Sie hatte aber das Gespräch mitbekommen. Mit Siegfried angesprochen, normalerweise in der Familie Zickel genannt, wusste der Fünfzehnjährige sofort, es wurde für ihn ernst. »Das ist partout nicht zum Lachen! Es ist schlimm genug, dass du Witze bei deinen Kameraden über unsere längst vergessenen Scharfrichterahnen aufleben lässt! Du solltest dich schämen!«
Siegfried löste sich aus der freundschaftlichen Umrandung von Waltraut und Beatrice, sprang vom Sofa auf und lief auf die streng dreinblickende Mutter zu: »Mama! Nimm das doch nicht so streng! Fast in jeder Stunde macht er Bemerkungen über diese Partei und warnt, dass sie gefährlich werden könnte. Paah! Die mit ihrem Schmiergerede!«
Er kniete theatralisch vor seiner Mutter auf den Boden, streckte die Hände nach ihr und rief Waltraut zu: »Spiel einen Walzer! Mamà möchte unbedingt am Abend tanzen.«
Tatsächlich milderte sich der Gesichtsausdruck der Mutter augenblicklich, ihre Augen ruhten belustigt und liebevoll auf ihrem immer zu Streichen aufgelegten fünften Kind.
Waltraut brauchte nie lange zum Klavierspielen aufgefordert zu werden. Schon saß sie am Flügel und flink gingen ihre Finger über die Tasten.
Sie wusste, wie ihre Mutter umzustimmen war, wenn sie – was selten geschah – mit einem der Kinder ungehalten war. Siegfried erhob sich, öffnete feierlich seine Arme und zog mit Kraft seine stämmige Mutter vom Sessel in seine Arme zum Tanz. Sie zeigte keinen Widerstand, lachte »Ach, Zickel!«, drehte ein paar Tanzschritte mit ihm und rief dann auch schon außer Atem »Nicht so schnell! Zu Hülfe!«, wand sich aus seinen Armen und ging benommen von den Drehungen zu ihrem Sessel zurück »Ich bin ja ganz taumelig!«
Ihr Gesicht aber strahlte. Sie fühlte sich glücklich im Kreis ihrer Kinder und war wie stets um Harmonie besorgt. Beatrice war erleichtert, dass die ältere Tochter Ingeborg nicht anwesend war. Sie brachte durch ihre Launenumschwünge oft eine beklemmende Stimmung in das Haus. Tante Else hatte sie brieflich schon darauf vorbereitet, dass Ingeborg sich für eine längere Zeit zu einer Behandlung ihrer Depressionen in Beelitz aufhalten würde.
Waltraut hatte das Spielen abgebrochen, Siegfried stand mit gespielt beleidigtem Gesicht eines gefoppten Tänzers in der Mitte des Zimmers, Beatrice und Hans hatten amüsiert den raschen Szenenwechsel beobachtet – und wie jeden Abend beschloss die Mutter mit liebevoller, fester Stimme den Tag: »Ich glaube, Mucki ist jetzt müde nach der Reise und dem Schwimmen. Ich gehe auch zu Bett.« Mucki war seit frühester Kindheit der Familienspitzname für Beatrice.
Die jungen Leute zeigten sich einverstanden, lächelten belustigt über die besorgt freundliche Aufforderung der Mutter und alle zogen sich in die Schlafräume im oberen Stockwerk zurück.
Beatrice wachte am nächsten Morgen spät auf. Sie bemerkte, dass sich die Familie bereits zum Frühstück begeben haben musste. Alle Schlafzimmertüren standen weit offen, das Dienstmädchen war mit der Bettwäsche beschäftigt. Als sie endlich fröhlich als Langschläferin begrüßt am Tisch saß und herzhaft in die frische Semmel biss, stieß sie erschrocken einen Wehlaut aus »Mein Zahn!« Sie griff ohne Rücksicht auf Tischmanieren in den Mund und zog triumphierend ein Zahnteil in die Höhe. »Das mir das jetzt passieren muss!«
Ihre Tante reagierte mit gelassener Stimme: »Das ist kein Unglück. Gegenüber hat Dr. Schroedter seine Praxis. Du hast ihn bisher nicht kennen gelernt. Hans, möchtest du bitte nach dem Frühstück rübergehen? Schau, ob er da ist und du meldest Mucki an.« Und wieder zu Beatrice gewandt: »Du wirst sehen, er ist ein vorzüglicher Zahnarzt. Ich schätze ihn sehr. Ich lade ihn auch öfters zu uns ein.«
Tatsächlich ging Beatrice am Nachmittag zu einer verabredeten Zeit über die Glogauer Straße in die Praxis und war erfreut, dass sie von der Sprechstundenhilfe gleich in das Behandlungszimmer gebeten wurde. Dort streckte ihr – wie sie sich später in ihrem Bericht über den Besuch ausdrückte – ein enorm gut aussehender Mann in weißem Kittel die Hand zur Begrüßung entgegen: »Schroedter«. Beatrice erzählte, dass sie sich bei seinem Anblick gleich streng vorgenommen hatte, ihre Überraschung über sein gutes Aussehen sich nicht anmerken zu lassen.
Als sie ins Haus der Familie zurückkehrte, wurde sie gleich von ihrer Tante Else mit einem schelmischen Lächeln empfangen: »Nun, Mucki? Hat er dich gleich über deine Einstellung zur Religion geprüft?« Beatrice gab sofort zu, sie sei verdutzt gewesen, dass sie – nach zwei Minuten auf den Patientenstuhl gesetzt – unverzüglich nach ihrem Studienfach befragt wurde und dann detailliert über ihre bisherigen Studienerfahrungen berichten sollte.
Sie verzog schmunzelnd ihren Mund. »Es war schon ulkig. Er unterbrach immer wieder das Bohren, damit ich den Mund öffnen und sprechen, ihm antworten konnte. Und er scheint wirklich auch da nachzubohren!« Ihre Tante amüsierte das Wortspiel und lachte herzlich.
»Ja, er verwickelt alle Patienten in Religionsgespräche. Und bei dir findet er natürlich ein geeignetes Gesprächsopfer. Das war uns gleich klar!« Sie gab ihr charakteristisches gemütliches Glucksen von sich, als ob sie einen vergnüglichen Kinderstreich begangen hätte.
»Ich habe nichts dagegen. Und – hat er dir den Zahn ausgebessert?«
Zwei Tage später kam Beatrice leicht verwirrt von einer Nachbehandlung aus der Praxis zurück ins Haus der Tante. Die Familie saß bei Kaffee und Kuchen. Alle schauten Beatrice neugierig entgegen.
Tante Else erkannte mit mütterlichem Instinkt am Gesichtsausdruck sofort, dass ihnen nicht allein ein Bericht über die Zahnbehandlung bevorstand. »Mucki, dir macht doch nicht etwa die Rechnung von Dr. Schroedter Kummer? Ich kann dich beruhigen und du musst es annehmen. Ich habe ihn gestern schon angerufen, dass ich das übernehme.«
»Das ist so lieb von dir, Tante Eche!« In der Familie waren Spitznamen untereinander selbstverständliche Anredeform. »Meine Mutter und ich sind dir sehr dankbar dafür. Dr. Schroedter hat mich schon darüber informiert.« Beatrice schöpfte Atem und schaute ihre Verwandten an. »Wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Ihr glaubt es mir nicht. – Dr. Schroedter hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will!«
Siegfried sprang händeklatschend auf: »Und du nimmst das ernst? Der ist doch ein Spaßvogel! Ich finde ihn wunderbar, wie er aus dem Stegreif Theater spielen kann!«
Beatrice schüttelte den Kopf: »Nein, nein! Das wäre schön. Aber er hat es ernst gemeint. Ihr wisst, wie ich meine Klappe nicht halten kann. Kaum habe ich mich zur Behandlung hingesetzt, da sah er mich mit seinen blauen Augen wie hypnotisierend fest an, ich wollte schon lachen, da fragte er mich zuerst weiter über meine Gründe zum Religionsstudium aus und auf einmal – ohne irgendeine Vorwarnung – fragte er mich: Wollen Sie mich heiraten? Sie sind die Richtige für mich! Wir passen zusammen! –
Ich war so baff, ich dachte für einen Moment auch, er macht Spaß mit mir, aber an seinem gespannten Gesicht verstand ich, er meint es tierisch ernst.«
Siegfried konnte nicht an sich halten: »Also was hast du gesagt?«
Beatrice blickte unsicher zu ihrer Tante hinüber.
»Ich habe bestimmt nicht die passende Antwort gegeben. Ich brachte nur heraus: Sie sind ja verrückt! Sie kennen mich doch gar nicht!«
Und wieder ging ein fragender Blick zu ihrer Tante, die mit ihren großen braunen Augen, ohne ein Wort zu verlieren, den bisherigen Bericht aufmerksam verfolgt hatte.
»Ja, was konnte ich in dem Moment sagen!? – Es war peinlich. Er schaute mich fassungslos an und – ja, dann sagte er: Trampeln Sie mir nicht mein Porzellan kaputt!«
Sie bat ihre Tante um Rat: »War ich zu unhöflich? Ich wollte ihn nicht beleidigen. Aber – ich kenne ihn doch wirklich nicht – und er mich auch nicht!«
Siegfried feixte: »Und dann hat er dich rausgeschmissen?«
»Siegfried!« kam es entrüstet von der Tante.
»Nein, nein! Er nahm sich zusammen, nahm irgendein Instrument in die Hand und sagte: Dann wollen wir mal sehen, wie wir mit dem Zahn weiterkommen. Er behandelte mich, als ob nichts geschehen sei.
Nach ein paar Minuten meinte er, dass die Plombe fest liegen müsste, ich sollte den Sitz testen, mit den Zähnen klappern. Das lief ohne Störung. Und als er mir erklärte, dass ich aufstehen könnte, machte er eine Pause und bat: »Lachen Sie bitte nicht über mich. Ich meine es ganz ernst. Überlegen Sie es sich.« Sie schüttelte in Erinnerung den Kopf, »Ich bin wie nach einer nicht gelungenen Klausurprüfung aus der Praxis gewankt.«
Alle schauten sich ratlos an. Selbst Siegfried wich nicht zu einem Witzchen aus. Tante Else atmete wie bei einer Sportübung hörbar tief aus und ein, ließ eine Weile verstreichen, strich ihr volles schwarzes Haar entschieden hinter die Ohren und versuchte ihrem Charakter getreu ihre Nichte zu beruhigen:
»Mucki, du hast Oberst v. Bagenski schon öfters bei uns getroffen. Er hatte uns vor drei Jahren zum ersten Mal gebeten, Dr. Schroedter einzuladen. Da waren wir ja erst gerade mal eineinhalb Jahre hierher gezogen und ich war aus Gewohnheit von Salisch aus weiter zu unserem Familienzahnarzt Dr. Filcher in Glogau gefahren. Oberst Bagenski kannte Dr. Schroedter schon als Oberleutnant vom Krieg her und schätzte ihn bald genauso als Zahnarzt, als er gehört hatte, dass er seine Stellung an der Poliklinik Breslau aufgegeben und hier eine Praxis eröffnet hatte. Als Dr. Schroedter sich vor drei Jahren scheiden ließ, dachte Bagenski, wir könnten ihm gesellschaftlich unter die Arme greifen. Denn wir wussten ja am besten aus eigener Erfahrung, wie Scheidungen in solchen Kleinstädten aufgenommen werden. Bagenski hatte aber nicht gewusst, wie beliebt Dr. Schroedter damals bereits in der Bevölkerung war, sodass diese Geschichte seinem Ruf offensichtlich überhaupt nicht geschadet hatte. Seine Frau galt wohl als etwas großstädtisch stolz, vielleicht sogar als arrogant, sodass niemand ihm die Scheidung übel nahm. Es war bereits allgemein in Beuthen bekannt, wie großzügig Dr. Schroedter Patienten die Rechnungskosten erließ oder wenigstens senkte, wenn er sah, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hatten. Und außerdem lief es genau damals vor drei Jahren wie ein Lauffeuer in der Stadt herum, dass er einmal im Monat nach Michowitz in Oberschlesien fährt, um dort im Kinderheim Friedenshorst der Gräfin Tiele-Winkler alle Waisenkinder kostenlos zu behandeln.«
Tante Else hielt inne. Ihre Kinder waren sprachlos. Sie waren es nicht gewohnt, ihre Mutter eine so lange Rede halten zu hören. Statt viel zu sprechen, handelte ihre Mutter, arbeitete im Haus, für die Familie, im Garten, – aber bei Gesprächen im Familien- oder Freundeskreis hielt sie sich stets bescheiden zurück und zog es vor, zuzuhören. Und wenn sie direkt um ihre Meinung angesprochen wurde, fiel diese immer sehr knapp und sachlich aus.
Sie hob wieder ihre Brust, zog hörbar Luft ein und fuhr fort:
»Oberst Collet, der seit Jahren hier in Beuthen wohnt, und den du, Mucki, auch schon hier bei uns angetroffen hast, hatte mich in gleicher Weise über diesen selbstlosen Einsatz unterrichtet. Und als wir ihn zuerst als sehr tüchtigen Zahnarzt, dann als unterhaltsamen und kultivierten Gast im Haus kennen lernten, waren wir alle sehr angetan von ihm und sind seitdem mit ihm in permanenter Fühlung. Er scheint uns in seiner politischen wie sozialen Einstellung sehr verantwortungsvoll zu denken. Als Gast kann er – was mir sehr besonders sympathisch ist – sehr geistreich und spaßhaft reden. Also, ich glaube, wir alle mögen ihn.«
Sie wandte jetzt bewusst ihre Augen voll auf ihre Nichte Beatrice: »Wenn Dr. Schroedter dich jetzt dermaßen überrumpelt hat mit seinem Antrag, dann ist das für mich ganz übereinstimmend mit seinem impulsiven Benehmen, wenn er sich seiner sicher glaubt, dass er es mit einem ihm ebenbürtigen Menschen zu tun hat.«
Beatrice reckte ihren Rücken am hohen Stuhl wie herausfordernd gerade. Ihre sportliche Figur betonte diese Bewegung: »Ich verstehe dich, Tante Eche, aber ich kann nur wiederholen, er kennt mich doch gar nicht und da macht eine solche Erklärung von ihm für mich keinen Sinn. Lohnt es sich darüber weiter zu diskutieren?«
Tante Else versuchte sie mit einem warmen Lächeln zu begütigen: »Mucki, ich denke nicht daran, dich zu verkuppeln. Ich möchte nur, dass du keinen falschen Eindruck von ihm bekommst. – Warte. Ich habe eine Idee. Siegfried, willst du nachsehen, ob Else noch unten in der Küche ist. Möchtest du sie bitte zu uns rufen?«
Siegfried fiel es offensichtlich leicht, den Kreis schnell zu verlassen.
»Mucki«, fuhr die Tante fort, »du weißt ja, dass unsere liebe Köchin Else Paschke von Alt-Strunz gerne mit uns umgezogen ist, weil ihre jüngere Schwester seit Jahren hier verheiratet ist und sie ihr gerne abends Gesellschaft leistet, wenn die Kinder schlafen und der Mann auf dem Kahn draußen auf der Oder ist. Die Schwester ist mit der Sprechstundenhilfe von Dr. Schroedter eng befreundet und erfährt von ihr auch nur das Beste über ihn. Ich interessiere mich nicht für Klatsch über Nachbarn. Aber für gute Taten ist es doch immer gut, offene Ohren zu haben, nicht wahr?« Und bei diesen Worten bewegte die Tante artistisch ihre Ohren nach oben und unten, eine seit ihrer Kindheit geübte Beherrschung ihrer Gesichtsmuskeln, Zuschauer zum Lachen zu bringen. Beatrice und Waltraut und Hans kamen nicht umhin, sofort in Gelächter auszubrechen, da der Kontrast zu der vorherigen ernsthaften Ansprache für sie geradezu befreiend wirkte.
Beatrice erinnerte sich bei diesem Anblick an ein schon mehrmals bedachtes Vorhaben. Sie wollte, ja, sie musste unbedingt endlich einmal ihre Tante porträtieren. Dieser runde, biedere Gemütlichkeit und Mütterlichkeit ausstrahlende Kopf mit der damenhaft feinen Adlernase übte immer wieder einen starken Eindruck auf sie aus. Sie konnte sich nie entscheiden, war es mehr der hellbräunliche Teint, die braunen lebhaften Augen, das volle schwarze Haar, die entschiedene Indianerhäuptlingsnase, wie sie sie im Stillen für sich nannte, was sie so am Aussehen ihrer Tante malerisch reizte?
»Frau Pastor, « trat die Köchin in den Salon, »der junge Herr Siegfried lässt bestellen, er möchte wohl mit dem Nachbarsjungen zur Oder gegangen sein.«
Obwohl Tante Else seit fünf Jahren geschieden war, wurde sie im Ort und von ihren Hausangestellten immer noch mit Frau Pastor angeredet. Tante Else hatte es längst aufgegeben, sich dagegen zu wehren. Waltraut hatte allerdings den Verdacht, dass sie es vielleicht sogar noch ein bisschen gerne hörte, obgleich ihre Mutter sich selbst wiederholt über die Sitte lustig machte, dass Ehefrauen auf dem Lande mit der Berufsbezeichnung des Mannes angesprochen wurden. Sie gab dafür immer ein spaßiges Beispiel mit der von ihr selbst erfundenen Berufsbezeichnung Frau Oberleichenwagenbremserin.
»Else«, sprach sie aufmunternd die rundliche, von der ganzen Familie geliebte Köchin an, »Sie erfahren immer von Ihrer Schwester viel über Dr. Schroedter. Setzen Sie sich bitte und erzählen Sie Beatrice über ihn, was man hier in Kuh-Beuthen von ihm hält.«
Die Köchin zierte sich zunächst ein bisschen, sich zu der Herrschaft zu setzen. Da sie aber schnell verstand, dass man auf ihre Nachbarschaftskenntnisse Wert legte, zögerte sie dann nicht lange, diese preiszugeben.
»Die Scheidungsgeschichte vom Herrn Doktor hat ja wohl zuerst die Beuthener ratlos gemacht, was da gespielt wurde. Aber der Herr Doktor ist ja so großzügig zu allen Patienten, dass man schon davon spricht, »der gibt sein eigenes letztes Hemd her, wenn er einen Armen in Lumpen sieht«. Beim Lebensmittel-Schmidt am Markt hat er oft schon seinen Geldbeutel gezogen, wenn er gesehen hat, dass eine Mutter gejammert hat, sie könnte die Milch für ihre Kinder nicht bezahlen. So ist er der Herr Doktor.
Das Fräulein Mischnik, was die Freundin meiner Schwester Frieda ist, dem Herrn Doktor die Sprechstundenhilfe, die schimpft manchmal mit ihm, wenn er so gar nicht darauf achtet, dass die Leute mal ihre Rechnungen bezahlen. Also auf den lassen die Beuthener nichts kommen.
Und er rackert sich ja krank in der Praxis und mit seinen Fahrten rundherum zu Patienten. Wenn einer von den Ärzten in der Gegend hier Vertretung braucht, dann ist er immer dazu bereit. Die Mischnik hat vor kurzem mitbekommen, rein zufällig natürlich, sagt sie, weil die Zwischentür offen stand, wie der Herr Doktor mit seinem Vater telefoniert hat, er hat ja genauso einen Apparat wie die Herrschaft hier im Haus, das ist ja auch wichtig für einen Doktor. Sie meinte, er hat wohl mit seinem Vater gestritten, dass er nicht genug Geld für sich selbst einnimmt. Sie sagte, er hat immer wiederholt, mach dir keine Sorgen, Vater, ich darbe nicht. Dabei ist der Vater seit drei Jahren nicht mehr von Breslau hierher gekommen. Seit der Scheidung. Das hat dem alten Herrn sicher nicht gepasst. Nach der Geburt von dem Sohn ist der Großvater ja früher alle zwei Wochen mit der Bahn gekommen.
Und das mit der SA gefällt dem alten Herrn auch nicht, das hat die Mischnik selbst bei einem Gespräch verstanden, dass der Herr Doktor mit dem Herrn von Bag …, na, Sie wissen schon, der Offizier, der ab und zu Sie hier besucht und von Salisch rüberkommt.«
Hier unterbrach Tante Else kurz zu Beatrice gewandt: »Der Oberst von Bagenski.«
Mit einem Blick auf die Uhr schlug sich die Köchin an den Kopf und schrie auf: »Jessas!«, fasste sich aber sogleich und bat: »Entschuldigung, Frau Pastor, das rutscht mir so heraus, wenn ich mich aufrege. Ich bin schon spät. Ich hab Frieda versprochen, auf die Kinder aufzupassen. Sie muss noch was besorgen.«
Als die Familie unter sich war, wollte Beatrice gleich wissen: »Er hat einen Sohn? Wo ist der? – Und was ist das mit der SA? Was hat er damit zu tun?«
Tante Else besann sich und erklärte: »So viel wir wissen, hat die Frau bereits einige Monate nach der Geburt das Haus verlassen und ist zu ihren Eltern irgendwo an der Grenze zur Tschechoslowakei mit dem Kind gefahren. Von der Scheidung erfuhren wir dann viel später über Pastor Klepper. Du weißt, wir haben uns nie um Klatsch und Tratsch gekümmert. Die Beuthener haben es wohl als keine große Skandalgeschichte verstanden, jedenfalls haben wir nie etwas in der Richtung gehört.«
»Und die SA?«
Tante Else fing an, den Kaffeetisch aufzuräumen, die Tassen zusammenzustellen, als ob sie die Antwort hinauszögern wollte. Sie blickte wie um Hilfe heischend zu Waltraut. Ihre Tochter fühlte sich aber nicht angesprochen und erwartete wie Beatrice eine Erklärung von der Mutter.
»Als Dr. Schroedter das erste Mal hier bei uns mit Oberst von Bagenski und Oberst Collet zu Abend eingeladen war, ich erinnere mich sehr gut daran, drehte sich sehr schnell das Gespräch unter den Herren nur noch um den Grenzschutz und die unsichere Situation von deutscher Seite aus.
Die Herren echauffierten sich sehr. Alle drei waren besorgt, dass man mit einem Übergriff rechnen müsste. Dr. Schroedter erklärte wieder und wieder, dass er sich nicht mehr einmischen wollte, er hätte sich bei seinen Einsätzen nach 1918 genügend die Hände verbrannt. Bagenski und Collet wussten offensichtlich Bescheid. Ich erfuhr zum ersten Mal davon, ich mischte mich aber nicht ins Gespräch, hörte nur zu. Die älteren Herren bedrängten den Jungen richtig, dass er es dem Vaterland schuldig sei, sich der »Sache« zu verpflichten, wie sie es ausdrückten.«
Tante Else erinnerte sich: »Oberst von Bagenski berichtete mir einige Wochen später, dass sie nach mehreren Treffen mit Dr. Schroedter in seiner Wohnung ihn hatten überzeugen können. Er habe sich der SA angeschlossen. Da verstand ich, was sie mit der »Sache« gemeint hatten.«
Beatrice schüttelte ungläubig mit dem Kopf: »Das versteh ich nicht: religiös? Gläubig? Und dann ausgerechnet SA wählen für die Grenzverteidigung? In Berlin und auch in Königsberg hat die SA den Ruf einer Draufgängerbande.«
Sie erwartete Zustimmung – Waltraut und Tante Else erwiderten ihren fragenden Blick mit hilflosem Augenschlag, bis Tante Else entschied: »Ich kann dazu nichts sagen. Wir haben bei späteren Treffen das Thema nicht mehr berührt. Dr. Schroedter diskutiert gerne über Kunst, über Musik. Das sind nicht so heikle Geschichten.«
Sie stockte, »Ach, was meinst du, vielleicht ist es am besten, ich lade Bagenski und Dr. Schroedter am Wochenende ein? Dann kannst du – wenn die Herren einen Besuch einrichten können – das Gespräch so lenken, dass du ihn direkt nach seinen Beweggründen fragst?«
Beatrice fand diese Idee in keiner Weise angenehm. Wie leicht könnte die Einladung als Reaktion auf den Antrag fälschlich verstanden werden. Das wollte sie unbedingt vermeiden. Tante Else besänftigte sie aber in ihren Befürchtungen. Sie hätte Oberst Bagenski sowieso schon versprochen, ihn bald mal wieder einzuladen. Sie würde zuerst die Einladung an ihn aussprechen; wenn er zusagte, würde sie das als Grund für eine Einladung an den Nachbarn erklären.
Beatrice war von einem Erfolg dieses geplanten Schachzugs der sonst eigentlich schachtrainierten Tante nicht überzeugt. Sie bat sich aus, dass sie es sich noch überlegen dürfte, ob sie dem Besuch nicht lieber fern bliebe. Ihr Stolz erlaube ihr nicht, in dieser prekären Situation missverstanden werden zu können.
Ihre Cousine Waltraut hatte volles Verständnis für Beatrices Zurückhaltung und riet ebenfalls ihrer Mutter, den Personenkreis für das Kaffeetreffen offen zu halten.