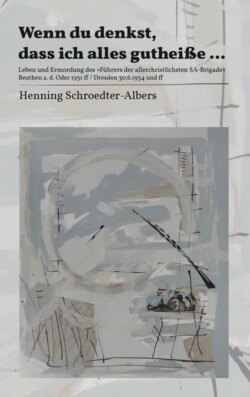Читать книгу Wenn du denkst, dass ich alles gutheiße … - Henning Schroedter-Albers - Страница 11
Breslau 1931
ОглавлениеTatsächlich ergab sich eine überraschende Wendung für den geplanten Wochenendbesuch. Oberst von Bagenski hatte die bereits erfolgte Zusage an Tante Else wegen Informationen über Gerüchte eventueller Infiltrationen seitens der polnischen Seite an der Grenze, die nah an die Wälder des Guts Salisch stieß, zurücknehmen müssen. Tante Else hatte aber schon hoch erfreut über die übermittelte Zusage von Bagenski nun auch Dr. Schroedter ihre Einladung ausgesprochen. Und sie wollte ihm auf keinen Fall absagen. Das wäre ihr äußerst unangenehm gewesen. Da ergab sich eine erfreuliche Wendung für die jungen Leute. Dr. Schroedter erschien bereits am Freitagabend »auf einen Sprung«, wie er es ausdrückte, in der Villa und fragte Waltraut gleich an der Tür mit einem etwas bekümmerten Gesicht: »Fräulein Albers, kommt es sehr ungelegen, wenn statt eines samstäglichen Nachmittagkaffees ich Sie mit Ihrer Cousine zu einem Ausflug am späten Vormittag nach Breslau einlade? Ich muss wegen eines dringenden Termins an den Museumsplatz fahren. Da Sie beide Kunstinteressenten sind, könnten Sie sich vielleicht unterdessen die neue Skulpturenausstellung ansehen – und sobald ich frei bin, würde ich mich Ihnen nur zu gerne anschließen, – wenn Sie beide Lust haben, könnte man sich danach noch gemeinsam in der Confiserie Micksch das Leben versüßen?«
Er bemerkte, wie Waltraut seinem Vorschlag offenkundig mit Wohlwollen zuhörte und so fuhr er fort:
»Ich muss mich entschuldigen, dass ich erst spät auf diese Idee gekommen bin. Aber Sie beide haben doch sicherlich noch nicht die Neuerwerbungen des Museums der Bildenden Künste am Museumsplatz gesehen? Genau dort habe ich in einem Nebengebäude einen Termin bei einem befreundeten Rechtsanwalt. Ich hoffe sehr, dass diese Planänderung keine Umstände für Sie und vor allem für Ihre verehrte Frau Mutter bedeuten würde? Oberst v. Bagenski wird Verständnis dafür haben.«
Waltraut konnte nicht anders als beglückt ihre Freude über diese Ausflugsaussicht zeigen; sie rief nach hinten ins Haus hinein nach Beatrice. Da keine Antwort kam, fragte sie Dr. Schroedter, ob er nicht eintreten wolle. Er bedauerte, er müsste noch einen Patienten außerhalb von Beuthen besuchen. Er sah ihr nach, wie sie mit einem fast tänzerischen Schritt tiefer ins Haus trat, um vom Treppenhaus aus nochmals nach Beatrice zu rufen. Ihm kam seine Beobachtung in den Sinn, wie Beatrice seine Praxis verlassen hatte: mit sportlich fest entschiedenem Schritt. Er lächelte über den augenfälligen Unterschied beider Cousinen. Beatrice, selbstbewusst und spontan in ihren Äußerungen, Waltraut, distanziert und vorsichtig in ihren Formulierungen.
Waltraut kam zu ihm zurück und fragte, ob auch der junge Siegfried mitkommen könnte. Kaum zugesagt, kam Siegfried auf ihr Rufen sofort herbei geflogen und war begeistert. Er machte keinen Hehl daraus, dass ihn die Fahrt mit dem Auto am meisten reizte und tatsächlich noch mehr – das war seine typisch lustige Art, Freunde und Bekannte zu provozieren – die Aussicht auf die berühmten Pralinen bei Micksch. Als nach wiederholtem Rufen endlich auch Beatrice an der Haustür erschien, erkannte sie nach den wiederholten Erklärungen von Dr. Schroedter an den Gesichtern von Waltraut und Siegfried sofort, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als zuzusagen. Viele Jahrzehnte später erklärte sie mir, sie hätte in dem Moment des kurzen Zusammentreffens an der Haustür die Einladung zu einer Autofahrt wie ein Komplott empfunden, doch hatte sie verstanden, dass sie unmöglich den anderen die Freude an einer Ausfahrt hätte verderben können.
Tante Else zeigte sich einverstanden mit der Einladung für die Jugend, bat Siegfried in weiser Voraussicht nicht zu kess zu sein und entließ sie am nächsten Morgen mit der Gewissheit, sie in guten Händen zu wissen. Die drei mussten ja nur die Straße überqueren, wo das Auto schon auf sie wartete.
Dr. Schroedter hatte bereits die Sitzordnung geplant. Ob man einverstanden sei, fragte er, wenn Siegfried neben ihm sitzen sollte, die jungen Damen auf den hinteren Sitzen? Beatrice war erleichtert, sie hatte gefürchtet, dass er aus Höflichkeit ihr den Vordersitz überlassen würde.
Während Waltraut und Beatrice ganz versunken im Betrachten der vorbeiziehenden Landschaft waren, schwatzten Siegfried und der Fahrer munter über die technischen Besonderheiten des Wagens, über die Schule und über Hobbys. Beatrice kam nicht umhin, die Geduld und das Einfühlungsvermögen von Dr. Schroedter für den Jungen zu bewundern. Bei dem Geratter des Motors und den Steinschlägen gegen die Reifen auf der einfachen Landstraße waren immer wieder nur Gesprächsfetzen von vorne zu verstehen. So verstand sie, dass Siegfried ohne Hemmung den Älteren im Gegenzug über dessen Schulerlebnisse ausfragte und sie war beeindruckt, wie witzig offensichtlich Dr. Schroedter über seine Lehrer und seine Freunde erzählte, denn Siegfried lachte ohne Unterlass. Der Ältere prahlte nicht mit großartigen Leistungen auf der Schule, er stellte seine Erfolge mehr als Glücksfälle dar. Soweit Beatrice es in Bruchstücken mitbekam, trafen die Interessen von ihm in den verschiedensten Fächern genau mit den jeweils behandelten Schulthemen überein. Privatgeigenunterricht zu Hause half ihm im Musikfach der Schule, die phantasievolle Erzählfreude seiner Mutter förderte sein Ausdrucksvermögen, sein Ehrgeiz, Gesehenes in Skizzen oder Aquarellzeichnungen festzuhalten, brachte ihn im Kunstunterricht voran. Seine naturwissenschaftlichen Interessen glaubte er vor allem seinem Vater zu verdanken, der ihn von seinen Berufskenntnissen her in diesen Fächern beiläufig auf Ausflügen und an Wochenenden im Schrebergarten in der Vorstadt unterstützte.
Je mehr Beatrice zu hören bekam, desto mehr spitzte sie die Ohren. Sie musste sich eingestehen, dass sie anfing, Herrn Schroedter allmählich sympathisch zu finden. Ab und zu blickte sie zur Seite, ob auch ihre Cousine Waltraut auf das Gespräch achtete. Waltraut war aber ganz verträumt in den Anblick der vorüberziehenden Landschaft.
Beide Cousinen protestierten sofort, als ihnen angeboten wurde, auf der halben Strecke in der Nähe des Ortes Schawa in einem dörflichen Gasthaus Rastpause zu machen. Tante Else hatte mit einem Korb voll Obst und Broten für das leibliche Wohl vorgesorgt. Alle entschieden, am Wegrand auf einer Wiese zu picknicken. Beatrice wollte sich nicht anmerken lassen, dass sie viel von dem Gespräch aufgeschnappt hatte. Als Siegfried bei der informellen Brotzeit seine Fragen zur Schulzeit fortsetzte und die Antworten von Dr. Schroedter sehr natürlich erfolgten, war Beatrice angenehm überrascht, wie selbstverständlich er auf Siegfrieds Neugier einging.
Der Arzt saß in einer leichten Sommerkleidung ungezwungen im Gras und amüsierte sich offenkundig mit viel Verständnis für den Jungen. Er lächelte Siegfried freundlich zu und ermunterte ihn, von seinen Schulerlebnissen in Züllichau bei der Pfarrersfamilie Bronisch zu berichten. Beatrice dachte an Tante Elses Bemerkung über ihn: »ein ungemein gut aussehender, gebildeter Mann aus gutem Haus«. Sie stimmte insgeheim dem Urteil zu und fügte für sich hinzu: außerdem auch humorvoll und feinfühlig für andere. Sie vermutete zu verstehen, dass der Arzt auch aus Zurückhaltung ihr gegenüber so stark auf Siegfried einging, damit sie sich nicht von ihm bedrängt fühlen sollte. Dabei bezog er beide junge Frauen mit in das Gespräch ein, indem er ihnen bei witzigen Ausdrücken von Siegfried schelmisch zuzwinkerte oder sie belustigt anschaute. Beatrice verfolgte die Konversation aufmerksam, während Waltraut nur mit halbem Ohr aus Höflichkeit zuhörte. Beatrice verdächtigte sie, in jemanden in München verliebt zu sein und von ihm zu träumen, wie sie so in sich selbst versunken auf der Wiese saß. Plötzlich aber schlug sie wild um sich. Die Mücken der Oderwiesen hatten sie mit ihrer zarten Haut als geeignetes Opfer ausgemacht und schwirrten um sie herum. Der Arzt erkannte sofort die Flucht als einzige Chance, dem Angriff zu entkommen. Sie brachen auf.
Beatrice konnte nicht umhin, sich über sich selbst lustig zu machen: »Da sieht man doch wieder, wie gut es ist, ein festes bayrisches Fell geerbt zu haben! An mir finden die Biester keinen Geschmack!«
Bis nach Breslau war es nur noch eine kurze Strecke. Dr. Schroedter entschuldigte sich gleich bei der Stadteinfahrt: »Ich nehme nicht die kürzeste Strecke zum Museumsplatz. Ich kann nicht anders, ich muss immer durch die Innenstadt beim Rathaus vorbeifahren, so beschwerlich es besonders an Samstagen bei Markt ist. Eine Fahrt nach Breslau, ohne das Rathaus passiert zu haben, das geht bei mir nicht.«
Die drei Mitfahrer waren gerne mit dem Umweg einverstanden. Die Fahrt über die Brücken in das Stadtzentrum verlief sogar leichter als befürchtet, da nicht so viele Fuhrwerke vom Land unterwegs waren. Dr. Schroedter ließ es sich nicht nehmen, rund um das Rathaus zu fahren, dabei auf die Architektureigenheiten und auf das ehrwürdige Alter aus dem Mittelalter hinzuweisen. Beatrice war beeindruckt von seinen Kenntnissen und seiner Bewunderung insbesondere für das Treppenhaus und die vielen Skulpturen. Er wäre wohl gerne länger dort verweilt, wenn er nicht plötzlich durch den Glockenschlag der Rathausuhr an seinen Termin erinnert worden wäre. Er schlug sich an den Kopf. »Oh, Teufel! Ich muss ja schon in der Kanzlei sein! Entschuldigen Sie. Ich fahre Sie jetzt direkt zum Museum. Ich lass auch den Wagen gleich dort stehen, weil ich ja im Nachbarhaus meinen Termin habe.«
Sie brauchten nur die Schweidnitzer Straße südlich bis zur Tauentzienstraße zu fahren und von da westlich abgebogen waren sie nach wenigen Metern vor dem Museum der Bildenden Künste angekommen.
Höflich wollte Dr. Schroedter den jungen Damen zuvorkommen und ihnen aus dem Auto helfen, aber sowohl Beatrice wie auch Waltraut und Siegfried waren schon behende aus dem Wagen gesprungen. Er verbeugte sich spaßeshalber »Hatte die Ehre! Das Museum ist bereits von mir telefonisch informiert, der Eintritt geht auf meine Rechnung. Keine Widerrede!« Er verbeugte sich nochmals »Spätestens in einer Stunde werde ich mich Ihnen anschließen!« und eilte dem Nebengebäude zu.
Beatrice und Waltraut waren verblüfft und gleichzeitig erleichtert, denn beide hatten nicht an ihre Portemonnaies gedacht, sie hätten den Eintritt gar nicht bezahlen können. Sie waren beide überwältigt von der großzügigen Verantwortung ihres Gastgebers und als Erwachsene auch beschämt in Anwesenheit von Siegfried, der sie sicherlich ob ihrer Verträumtheit belacht hätte.
Tatsächlich wurden sie an der Kasse erwartet, erhielten dazu auch einen Druck zu der Sonderausstellung von Georg Kolbe und konnten sich nun ganz in Ruhe den malerischen und bildnerischen Kunstwerken des Hauses widmen. Von den Berliner Museumsschätzen verwöhnt waren die beiden Studentinnen der Kunst erstaunt, welche Meisterwerke hier allein im letzten Jahrhundert und insbesondere der neuesten Kunst von Oscar Schlemmer und Otto Müller angesammelt worden waren.
Genau nach einer Stunde des Herumwandelns und Besichtigens erinnerte Siegfried daran, dass Dr. Schroedter angekündigt hatte, in einer Stunde sich zu ihnen gesellen zu wollen. Beatrice hatte Mitgefühl mit dem Cousin, mehr als eine Stunde durfte man ihm wohl nicht zumuten, Gemälde und Plastiken anzuschauen. Also stimmte sie ihm zu, dass sie sich ins Foyer des Museums zurückbegeben sollten, um Dr. Schroedter zu ersparen, nach ihnen zu suchen. Dort konnten sie zufällig einer für sie sehr informativen Einführung durch einen Kurator des Museums beiwohnen, sodass ihnen gar nicht bewusst wurde, dass Dr. Schroedter erst nach einer halben Stunde erschien.
Er erblickte sie abseits von der Führungsgruppe, eilte auf sie zu und entschuldigte sich überschwänglich, um gleich einen Vorschlag zu machen.
»Sie brauchen doch sicherlich eine Stärkung? Wie ich Ihnen versprach, bringe ich Sie zu der besten Confiserie hier in Breslau, gleich um die Ecke. Das Besondere an diesem Laden ist, dass man bei der mit uns über die Freimaurerloge meines Vaters befreundeten Familie Micksch auch ein Tischchen finden und in Ruhe wunderbare heiße Schokolade genießen kann. Und es werden eben nicht wie in ihren anderen Filialen nur ihre eigenen Pralinen und Gebäcke angeboten. Sind Sie bereit?«
Siegfried wartete erst gar nicht die Antworten von Beatrice und Waltraut ab: »Und wie wir bereit sind! Wir sind ganz nah einem Zusammenbruch!« Beatrice beobachtete belustigt die tadelnden Blicke der älteren Schwester Waltraut, die nichts anderes bedeuten konnten als »so etwas sagt man doch nicht!«
Siegfried blieb unberührt davon und schaute den Gastgeber erwartungsvoll an.
Der Arzt hatte sichtlich mit einer Zustimmung gerechnet. Er nahm Waltrauts tadelnden Ausdruck nicht wahr und da keine Widerrede erfolgte, bot er ihnen einen fünfminütigen Spaziergang in aller Gemütlichkeit im Schatten der Linden vom Kunstmuseum bis zur Confiserie Micksch an.
Auf dem Weg versuchte Waltraut den Gastgeber in ein Kunstgespräch zu verwickeln, sie war übervoll des Lobes über die Werke und das Geschick des Museums, die Ausstellung dem Publikum darzustellen. Es war offenkundig, dass sie ihre neu erworbenen Kenntnisse und ihre Gefühle weitergeben wollte. Ganz besonders hatte sie der Bildhauer Kolbe mit seinen Plastiken bewegt. Beatrice dagegen schaute schweigend von einem zum anderen, war überrascht von Waltrauts Begeisterung und ihrem Redefluss, den sie in dieser Weise in Gegenwart von Fremden noch nie an ihr erlebt hatte. Waltraut war ganz in Weiß gekleidet, ein luftiges weites Kleid, das angenehm von ihrem dunklen Haar in Knabenschnitt abstach. Die grünen Augen begleiteten ihr Sprechen mit lebendigen Bewegungen. Sie war dermaßen vertieft in ihre Schilderung, dass sie – wie Beatrice es sehr wohl für sich bemerkte – nicht beachtete, ob ihr Gesprächspartner ihr tatsächlich zuhörte. Er ging ernst neben den drei Jüngeren einher, nickte nur ab und zu mit dem Kopf. Für Beatrice schien es, er sei in Gedanken abwesend.
Sobald sie in die Confiserie Micksch eintraten, – Beatrice bewunderte beim Eingang die stolze Reklameschrift »Königlicher Hoflieferant«, – nahm sie wahr, wie Joachim Schroedter wie ein alter Bekannter herzlich begrüßt wurde:
»Jesder kuschik! Der Dokter!« rief eine ältere Angestellte in weißem Kittel einer jüngeren Kollegin ebenfalls in Weiß zu, eilte hinter der Theke nach vorne auf ihn zu und machte einen höflichen Knicks. Beatrice fragte Waltraut hinter vorgehaltener Hand: »Ist das Polnisch?«
Anstelle von Waltraut antwortete aber Joachim Schroedter, der das Flüstern mitbekommen hatte: »Nein, das ist Schlesisch, ganz typisch. So viel wie »Du meine Güte!« als nette Begrüßung. Sie kennt mich ja seit meiner Jugend aus der Nachbarschaft.«
»Frau Matzke, grieß Gott! Sie wussten ja, dass ich komme. Herr Micksch hatte Sie doch informiert? Ist dieser Tisch mit den vier Plätzen für uns reserviert?«
»Jawohl, Herr Dokter! Und was wünschen Sie? Wie immer Bienenkorb und Baumkuchen mit Sahne?«
Beatrice amüsierte sich köstlich, wie Waltraut so ganz anders als ihr Gastgeber in den Laden eintrat. Mit einem hoheitsvollen Neigen ihres Kopfes grüßte sie die Angestellte in einem gleichermaßen hoheitlich gedehnten Ton: »Guten Tag!« Was für ein Unterschied zwischen diesen beiden Personen!
»Nu, watten Se ock a weng, Frau Matzke. Lassen Sie uns erst einmal setzen. Auf alle Fälle fir jeddn a Tippla heeße Schokkolatt, bitt scheen!« und zu den jungen Damen und Siegfried gewandt: »Das ist doch allen recht? Das ist die beste Schokolade, die ich kenne.« Und mit einem fragenden Gesichtsausdruck an Beatrice: »Aber das haben Sie doch gerade verstanden? Hat Ihre Mutter Ihnen nicht ein paar Brocken Schlesisch beigebracht?« er lachte »Sozusagen a weng geloabert?«
Das hatte Beatrice verstanden: »In Berlin wird das auch benutzt: »labern«. Nein, meine Mutter achtet ganz streng auf ein elegantes Hochdeutsch. Sie ist mit meiner Berliner Schnauze, wie sie es manchmal nennt, gar nicht zufrieden. Aber unter Freunden reden wir schon frei weg, wie die Berliner sagen: »wie uns der Schnabel gewachsen ist.«
Sie konnte es in diesem Moment nicht lassen, ihn provozierend anzusehen, bereute es aber im nächsten Moment, als sie sich an ihre spontane Reaktion auf sein Heiratsersuchen erinnerte, und um es gleichsam sofort wieder gut zu machen: »Offensichtlich haben Sie die gleiche Freude wie ich, nach Luther, ›dem Volk auf das Maul zu schauen’.«
Sie tauschten ein freundliches Lächeln aus. Waltraut musste belehrend nachhaken: »Ich glaube, – nein: ich bin sicher, dass die gesamte Familie Ackermann hier in Schlesien so gut wie kein Schlesisch spricht. Meiner Großmutter hörte man leise von der Sprechmelodie her ihre Herkunft aus dem Rheinland an. Das hat auch meine Mutter ein bisschen beeinflusst. Dagegen hat mein Vater oft genug sehr stolz auf sein Friesisch zurückgegriffen. Das musste er uns jedes Mal erklären, wir verstanden kein einziges Wort. Aber die Ackermanns selbst haben immer Hochdeutsch gesprochen.«
Am Tisch wurde ihnen die Karte gebracht und der Gastgeber erklärte ihnen, was traditionsweise zur heißen Schokolade bestellt wird:
»Entweder probieren Sie Einzelstücke vom »Bienenkorb«, einem marzipanhaltigen und vom Äußeren her mehr makronenartigen Gebäck in Form eines kleineren oder höheren Bienenkorbs. Oder »Baumkuchen«, ein aus mehreren Schichten von Sandteigmasse bestehendes zart luftiges hohes Gebäck in Form eines Baumstamms, mit Schokolade oder mit einem Aprikosenzuckerguss umgeben. Bienenkorb fester, Baumkuchen sehr leicht, sodass heiße Schokolade als Getränk für beides dazu genau passend ist, wie ich meine. Auf alle Fälle kann ich es sehr empfehlen.« Er hielt für eine Sekunde inne und lächelte: »Seit meiner Schulzeit intensivste Erfahrungen.«
Siegfried sah ihn achtungsvoll an: »Sie könnten ja direkt in Konkurrenz mit den Backkünsten unserer Mutter stehen!«
Sie einigten sich auf eine Bestellung beider Gebäckarten und waren dann bald in genüssliches Schwelgen versunken, zumal die drei Gäste gleich bei den ersten Schlucken der heißen Schokolade feststellten, dass sie einen dermaßen aromatisch dickflüssigen Kakao noch nie auf ihren Zungen erlebt hatten.
Sobald Waltraut sich gestärkt hatte, sie war zurückhaltender beim Zugreifen, kam sie darauf zurück, den geleisteten Rundgang im Kunstmuseum zu kommentieren und die Gemälde und Skulpturen hervorzuheben, die ihrer Meinung nach besondere Wertschätzung verdienen.
Beatrice bewunderte ihr Erinnerungsvermögen, ihre präzisen Beschreibungen, ihr analytisches Denken und speziell ihr ruhiges Selbstbewusstsein, sich in einem gleichmäßig entwickelnden Redefluss zu äußern. Sie hörte ihr aufmerksam zu und erkannte, dass sie bei allem Unterschied ihrer Charaktere in der ästhetischen Beurteilung von Kunstwerken vollkommen übereinstimmten.
Erst als Siegfried sich etwas ungeduldig räusperte, dieser ernsthafte Vortrag entsprach sicherlich nicht seinen Vorstellungen eines vergnügten Ausflugs, warf Beatrice einen Blick auf den Gastgeber. Auch er befand sich ersichtlich nicht mehr in Waltrauts Gedankenwelt. Beatrice vermutete, dass er sich, wie sie es schon auf dem Herweg beobachtet zu haben glaubte, wieder mit Problemen auseinandersetzte, die er kurzzeitig hatte beiseite schieben können. Waltraut konnte seine gekräuselte Stirn und seine nach innen gerichteten Augen nicht wahrnehmen, da sie ihren Blick in ihrer auf ihr Thema gezielten Konzentration ganz auf die vor ihr stehende Tasse gerichtet hatte. Beatrice bedachte sich nicht lange, sie fühlte, dass sie handeln musste und so warf sie sich geschickt in Waltrauts Vortragsfluss ein, als sie gerade bedauerte, dass sie aus Zeitgründen nicht mehr die Abteilung des Schlesischen Meisters aus dem Mittelalter besuchen konnten.
»Warum nutzt du nicht die Gelegenheit, Traute, das noch jetzt schnell nachzuholen? Herr Schroedter, Sie haben doch sicherlich nichts dagegen, wenn Waltraut sich noch dreißig bis fünfundvierzig Minuten absentiert? Ich selbst habe keine Kraft mehr. Ich bleibe hier und nuckle noch an meiner Schokolade. Eine Stunde Ausstellungsbesuch ist für mein Auffassungsvermögen genau richtig gewesen. Mehr schafft mein simples Gehirn nicht.« Sie sah Waltraut auffordernd an. Ihr deutlicher Wink wurde aufgenommen und Joachim Schroedter war überrascht, sich nach einigen Worten der Verabredung mit Waltraut auf eine baldige Rückkehr mit Beatrice allein zu sehen, da Siegfried sie auch verließ. Er wollte sich lieber in der Umgebung als nochmals in dem Museum umschauen.
Wie überrascht von dieser Situation sahen sich beide prüfend an, um wie auf ein Signal gleichzeitig zum Sprechen anzusetzen und zwar mit den gleichen Worten, als ob sie es im Chor eingeübt hätten:
»Also, jetzt sagen Sie mal …« beide fingen sofort über diesen nicht erwarteten Gleichklang zu lachen an. Er fasste sich zuerst und forderte sie auf: »Sie zuerst! Bitte!«
Beatrice besann sich und setzte von neuem an: »Also, sagen Sie ganz ehrlich, was ist passiert, dass Sie jetzt so besorgt dreinschauen? Sie können natürlich sagen, das geht mich nichts an. Aber ich habe mit Spaß beobachtet, wie Sie sich mit Siegfried unterhalten haben und auf ihn einfühlsam eingegangen sind. Und jetzt fürchte ich, dass unsere Gegenwart Sie eigentlich nur belastet? Das tut mir leid. Sie können mir ohne Umschweife sagen, dass Sie es vorziehen, alleine zu sein, ich gehe solange etwas spazieren. Oder vielleicht hilft es Ihnen, Ihre Sorgen mit mir zu teilen?«
Seine graublauen Augen waren gebannt auf sie gerichtet. Als sie endete, hob er seine auf dem Tisch liegende Hand wie zum Sprechen ansetzend auf, ließ sie wieder sinken, senkte den Kopf, um Beatrice gleich wieder fest anzuschauen:
»Sie überraschen mich. Sie zeigen sich besorgt um mich. Um mich, nachdem ich erst vor ein paar Tagen Ihnen etwas in meiner Praxis vorgeworfen habe, was ich lieber nicht wiederhole. Entschuldigen Sie. Mit Ihrer Frage beweisen Sie, dass ich Ihnen in meiner egoistischen Verletztheit Unrecht getan habe.« Er machte eine Pause, sie hörte ihm aufmerksam zu. »Andererseits hat mich mein erstes Gefühl über Sie nicht betrogen. Sie können nicht nur gescheit über Christentum reden, Sie handeln auch entsprechend, wenn Sie Anteilnahme an Ihrem Mitmenschen zeigen. Sie beobachten mit Einfühlung und sind bereit, sich eventuell eine Ablehnung einzuholen, wenn Ihr Mitgefühl nicht gefragt ist. Das weiß ich sehr zu schätzen.«
Wieder machte er eine Pause. Beatrice sah ihn ruhig an, sie konnte warten. Er sollte sich in Ruhe sammeln. Vielleicht konnte sie als Jüngere ihm einfach nur durch Zuhören eine Erleichterung schaffen.
»Sie haben Recht. Ich fühle mich wie erschlagen. Und es ist vielleicht gut, nein, ich verbessere mich, es ist sicher gut, dass ich mir selbst klar werde, wie ich das eben Erlebte verdauen kann, wenn ich mich Ihnen wie einem Beichtvater anvertraue. Das soll ja bei den Katholiken wie ein Reinigungsprozess, wie eine Katharsis bei den antiken Griechen wirken.«
Er hielt inne, er überlegte wohl, wie er seine Erklärung anfangen sollte. Dann streckte er entschieden sein Gesicht ihr entgegen:
»Ich hatte gestern Abend diese Fahrt hierher mit einem Termin erklärt, den ich mit einem befreundeten Rechtsanwalt am Museumsplatz vereinbart hatte. Tatsächlich ist er seit meiner Schulzeit mein bester Freund. Er wohnte in der Nachbarschaft, wir verbrachten die Schulpausen zusammen, auch meistens alle Nachmittage, größtenteils bei ihm zu Hause. Er ist das einzige Kind der Familie. Wir hatten bei ihm immer Ruhe gefunden zur Hinwendung an unsere gemeinsamen Interessen. Wir wurden nicht gestört von meinen jüngeren Geschwistern. Das bedeutete mir viel. Die Familie ist jüdisch. Das war interessant und neu als Erfahrung für mich. Ich hatte mich immer für Religion interessiert und ich durfte in seiner Familie an vielem teilnehmen, was andere in meinem Alter nie erleben konnten.
Bei Kriegsbeginn habe ich mich freiwillig gemeldet, mein Vater war entsetzt, wollte es verbieten, aber ich setzte mich durch. Die schwere Krankheit meiner Mutter – unheilbarer Krebs, ein Jahr vor dem Krieg ausgebrochen – hatte mich so hilflos gemacht, mich so niedergeschlagen, dass ich damals glaubte, im Kampfeinsatz für das Deutsche Reich kann ich einen neuen Sinn im Leben finden. So erkläre ich mir heute im Nachhinein selbst meine damalige spontane Entscheidung.
Mein Freund war der gleichen Meinung. Aber er wurde zu seinem großen Kummer beim Militär nicht angenommen, da er immer wieder starke Asthmaanfälle hatte. Wann immer ich Kriegsurlaub erhielt, hielt ich mich mehr bei ihm auf als zu Hause. Ich wusste, wie sehr er an allem teilnehmen wollte, was ich erlebte.
Und zu Hause warf mir mein Vater ständig vor, dass ich mein Leben riskiere, wegwerfe. Er ist als Freimaurer für friedliche Völkerverständigung und total gegen Kriege. Das hatte er von seinem Vater, der in derselben Loge gewesen war wie er, eingeimpft bekommen und zwar nach dessen Erfahrungen im Frankreichkrieg 1870/71.
Und nach dem Krieg, als ich zu studieren begann, wiederholt das Studium kurz unterbrach, wenn ich in Freikorps gegen Grenzüberschreitungen kämpfte – da tobte mein Vater. Er wollte und konnte meinen Einsatzwillen nicht verstehen. Dafür umso besser mein Freund, der mich um diese Aktionen direkt beneidete. Er stand zu dieser Zeit bereits kurz vor dem Abschluss seines Jurastudiums.«
Hier unterbrach er sich erschrocken: »Entschuldigen Sie vielmals, ich sollte mich kürzer fassen. Ich greife so weit aus, damit Sie besser verstehen, warum ich mich jetzt nach dem Treffen mit meinem Freund frage, ob ich mir etwas vorzuwerfen habe.«
Beatrice beruhigte ihn mit einem ermutigenden Lächeln: »Nein, ich verstehe Sie gut. Sprechen Sie bitte weiter.«
»Sie werden es besser verstehen« fuhr er fort »wenn ich Ihnen das heutige Gespräch schildere. Mein Freund arbeitet in der Kanzlei eines der angesehensten jüdischen Rechtsanwälte Breslaus, Max Jacobsohn, der auch sehr engagiert in der Jüdischen Gemeinde tätig ist. Ich hatte mich schon gewundert, dass mein Freund Walter mich an einem Samstag, also an einem Schabbat in die Kanzlei bittet, was nicht üblich ist. Aber ich hatte mir naiv vorgestellt: er kennt meine prekäre finanzielle Belastung aufgrund der Scheidung und will mir auf mein Drängen aus der Patsche helfen, am besten an einem Tag ohne meine Sprechstundenpflichten. Das will er auch, aber die ganze Situation ist jetzt für ihn und mich peinlich kompliziert geworden. Ach, was, kompliziert, sie ist ein – was soll ich sagen – ein Schock für mich und wie ich sicher bin, auch für ihn.
Jacobsohn kennt meinen Scheidungsfall mit allen finanziellen Anforderungen und weiß, dass mein Freund sich für mich einsetzt. Jetzt hat er davon Wind bekommen, dass ich neuerdings bei der SA mitversuche, eine Wehrmannschaft gegen eventuelle Angriffe der Bolschewiken aufzubauen. Und da hat er meinem Freund klipp und klar gesagt, dass er mich nicht in seiner Kanzlei antreffen will. Deswegen der heutige Termin, wenn er selbst nicht da ist. Solch ein Unsinn, mich mit einigen antisemitischen Raufbolden, die es überall in Deutschland gibt, gleichzusetzen. Mein Freund konnte ihm das nicht ausreden.«
Er schöpfte kurz Atem. Er fühlte sich erleichtert, dass ihm Beatrice gegenübersaß, ihm aufmerksam und ernstlich mitfühlend zuhörte, und dabei ihn in ihrer so jugendlichen Frische wie im Traum von seinen Sorgen zu entlasten schien. Er nahm den Faden wieder auf: »Was mich aber besonders bekümmert: selbst mein Freund macht sich ernsthafte Sorgen um mich, ob ich da auf dem richtigen Weg mit der richtigen Partei bin. Er sei persönlich schon mehrmals von einem gleichaltrigen Nachbarn in SA-Uniform rüde angerempelt und als Judenbengel beschimpft worden. Eine Anzeige, meint mein Freund, würde nichts nützen, da solche Tätlichkeiten noch harmlos seien im Vergleich zu Vorkommnissen, die aus der Jüdischen Gemeinde berichtet werden und nach Anzeige bei der Polizei ohne Straffolgen im Sande verliefen. Er fragte mich, wie ich meine religiöse Gesinnung mit dem Parteiprogramm der NSDAP vereinbaren kann. – Das ist genau der Vorwurf, den mir mein alter Herr jetzt ständig macht, wenn er überhaupt noch mit mir spricht. In letzter Zeit ist seine Mahnung sowieso nur noch am Telefon: man kann nicht zwei Herren dienen, Christus und Hitler.«
Er stutzte. Beatrice hatte die letzten Worte mit heftigem Nicken begleitet und blickte ihn erwartungsvoll an.
»Sie denken, dass mein Vater mit seiner Ablehnung Recht hat?«
Beatrice zögerte nicht, ihm frei zu erklären, dass im Haus ihrer Tante über ihn in diesem Gedankenzusammenhang gesprochen wurde.
»Ich kann mir gut vorstellen, Ihr Engagement für die NSDAP und gleichzeitig – wie ich in den letzten Tagen verstanden habe – Ihr wohl in ganz Beuthen bekannter christlicher Glaube ist für viele ein Widerspruch. Ich will mir kein Urteil darüber erlauben, weil ich politisch nicht wirklich informiert bin. Ich plappere mehr alles nach, was meine Mutter in Berlin beobachtet und gehört hat und was meine Verwandten hier und auch in Königsberg politisch zum Ausdruck bringen. Sie sehen Hitler als den Oberrabauken an und fürchten seine Schläger als Unruhestifter. – Und wie ich aus Ihren Bemerkungen in Ihrer Praxis verstanden habe, meinen Sie es ja mit Ihrem Glauben wirklich ernst. Wenn Ihr Freund Sie viel besser kennt, verwirrt ihn das doch auch. Konnten Sie …«
Hier unterbrach er Beatrice: »Entschuldigen Sie. Ich kann es gleich vorwegnehmen. Nein, ich konnte ihn nicht beruhigen. Er kennt seit Jahren meine Bereitschaft, mich ganz für die deutsche Sache einzusetzen. Für das Vaterland zu kämpfen, es vor einem Niedergang retten zu wollen, das ist doch eine so heilige Pflicht, wie für Christus einzustehen. Können Sie das nachvollziehen?«
Beatrice hörte aus seinem beschwörenden Ton, wie wichtig es ihm war, dass sie ihm zustimmen würde. Tatsächlich fühlte sie sich aber unsicher. Diese Vorstellungen von Vaterlandseinsatz im Verein mit religiösem Glauben waren ihr bisher nie in dieser Weise in einem Zusammenhang mit den Geschehnissen der ihr von einigen Kommilitonen andeutungsweise berichteten Berliner Straßenkämpfen begegnet. Sie war beeindruckt von dem Feuer, mit dem er sprach. Und sie war überzeugt, dass er von Idealismus angetrieben diese Vorstellungen besaß. Ihre realistische Intuition hinderte sie aber, ihm mit der gleichen Begeisterung folgen zu können. Als hätte er ihre Gedanken erraten, fuhr er fort, seine Einstellung genauer in Worte zu fassen:
»Walter, so heißt ja mein Freund, wie ich Ihnen schon sagte, kennt mich als verantwortungsvollen und pflichtbewussten Menschen. Er kennt meine vaterländische Gesinnung. Meine Kraft für die Formung meiner SA-Männer setze ich ganz in diesem Sinne ein. Was an Schmutz passiert, und zwar in ganz Deutschland durch alle Gesellschaftsschichten hindurch, genau dagegen richtet sich mein Einsatz. Es muss wieder aufwärts gehen. Da dürfen solche Lausbübereien von Einzelnen nicht irre machen. So schlimm es für meinen Freund ist, auf der Straße von einem höchstwahrscheinlich neidischen, auf alle Fälle primitiven Nachbarn angerempelt zu werden, das ist doch kein Grund, eine ganze Bewegung zu verdammen und in Verruf zu bringen. Und vor allem mein verantwortungsvolles Festhalten an meinen Idealen zu bezweifeln. Was meinen Sie?«
Beatrice sah über den kleinen runden Tisch ihn wie eine ihr neue Person an, und sie bestätigte sich wieder erneut: ja, die Familie hat Recht. Er ist wirklich ein ungemein gut aussehender Mann mit seinem dunklen Teint, seinen hellen Augen, dem schwarzen Haar, der schlanken Figur. Er ist galant. Und er ist so wortgewandt, so lebenserfahren, dass ich nichts zu sagen weiß.
Zaghaft brachte sie dann heraus: »Ich fühle mich wie ein dummes, kleines Schulmädchen. Sie stellen Ihre Sicht so geschickt dar, dass ich Ihnen jetzt bei Ihrem Problem mit Ihrem Freund überhaupt nicht hilfreich zu raten weiß.«
Er lächelte sie freundlich an: »Geschickt? – Soll das heißen, ich versuche, Sie zu meiner Überzeugung zu verführen? Nein, nein, ganz im Gegenteil! Ich bin beim Reden bemüht, mich selbst zu finden, mir klar zu werden, was ich will, – mit welchen Argumenten ich auch meinem Freund näher kommen kann. Es ist, ganz wie Kleist es in einer kleinen Schrift erklärt, dass Sie mir durch Zuhören und Fragen geholfen haben, mich aus dem Wirrwarr der Gefühle nach dem Treffen herauszuwinden. Dafür gebührt Ihnen mein voller Dank!«
Er ergriff über den Tisch impulsiv ihre Hand und drückte sie, sie entzog sie ihm erschrocken. »Sie übertreiben, Herr Doktor Schroedter! Ich kann nicht einmal Ihre Bemerkung über Kleist verstehen. Wir haben in der Schule den »Zerbrochenen Krug« gelesen. Mehr kenne ich nicht von ihm. Und Sie sagen, ich hätte Ihnen geholfen …«
Er nahm zögerlich seine Hand von ihr zurück, als ob er sich bewusst geworden sei, dass er vielleicht wieder einmal zu gefühlvoll reagiert habe, dabei zielten seine Augen fast wie hypnotisierend auf ihre Augen. Beatrice befand sich im Zweifel, sollte sie lachen oder sich gedulden?
Er atmete tief durch, entschied sich zu sprechen: »Ja, ganz genau, wie ich es Ihnen gerade erklärte. Ich schulde Ihnen meinen tiefsten Dank. Denn Sie waren bereit, mir zuzuhören und so konnte ich meine Gedanken nach dem Treffen mit meinem Freund wieder in Ruhe ordnen. Ich weiß jetzt, wie ich ihm meine Einstellung nahe bringen will und vor allem ihn beruhigen will, dass auch in der Politik alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
Er ist von dem Kanzleiinhaber dermaßen verunsichert worden, dass er sogar an Auswanderung in die USA denkt. Stellen Sie sich das vor! Das ist ja eine völlig übertriebene Reaktion auf Pöbeleien von mutwilligen Schlägertypen auf der Straße.
Ja, bitte nehmen Sie meinen zutiefst empfundenen Dank an.«
Er nahm erneut Anlauf:
»Und bitte, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich fühle mich Ihnen so verbunden, dass Sie mir erlaubten, meine Beichte loszuwerden. Es würde mir eine unsägliche Freude bereiten, wenn Sie mich – als um einige Jahre Älteren – mit meinem unter Freunden üblichen Vornamen Jochen anreden würden und mir das Gleiche erlaubten. Seien Sie versichert, ich werde mir deswegen keine Freiheiten herausnehmen.«
Bei dem Wort »Beichte« hatte er Beatrice kurz verschmitzt lächelnd angeschaut, um gleich darauf sie ängstlich bettelnd mit seinen Augen so anzuflehen, wie Beatrice es von treuen Hundeaugen her beobachtet hatte. Dieser blitzartig in ihr aufkommende Vergleich rührte sie. Sie spürte ein freundschaftliches Gefühl in sich aufkommen. Kurzerhand ging sie auf seinen Wunsch ein: »Alles, was Sie jetzt gesagt haben, Ihre lauteren Motive für Ihr politisches Handeln, das nehme ich Ihnen wirklich ab. Ich glaube Ihnen. Aber das heißt nicht, dass ich auch Ihre Einstellung teile. Ich bin politisch nicht sehr gebildet, aber nach allem, was ich höre und lese, bin ich skeptischer als Sie. Es ehrt Sie, dass Sie sich die Lage in Deutschland für die Zukunft so idealistisch vorstellen können. Viele meiner Kommilitonen und auch meiner Familie sehen gerade die Rolle der SA bei den Straßenkämpfen als äußerst bedenklich und nicht gerade hilfreich in der jetzigen politischen Situation an. Ich will Ihren Vorschlag annehmen, aber bitte unter der Bedingung, wie Sie es jetzt selbst gerade formulierten: unter Freunden. Das heißt für mich kameradschaftlich-sportlich, damit kein Missverständnis entsteht. Wenn Sie das akzeptieren können, dann bin ich ganz einverstanden.«
Ihr fragender Blick wurde umgehend von einem Aufleuchten in Jochens Augen beantwortet: »Das freut mich ungemein! Sie werden sehen, ich halte mich an abgemachte Regeln …«
Hier unterbrach ihn Beatrice und wies mit ihrer rechten Hand so unauffällig wie möglich zum Fenster hinaus auf die Straße: »Da kommt meine Cousine Waltraut. Ich hatte schon vor ein paar Minuten kurz den Eindruck gehabt, sie wäre auf der anderen Straßenseite vorbeiflaniert. Aber da war ich ganz Zuhörerin. Sie ist unwahrscheinlich rücksichtsvoll, hat uns sicherlich beobachtet und möchte wohl nicht stören. Sollten wir nicht rausgehen und ihr zuwinken?«
Sie brauchte gar nicht weiter zu reden. Er stand sofort auf. »Natürlich! Ich muss mich bei ihr entschuldigen. – Aber können wir noch etwas verabreden? Ich soll am kommenden Samstagabend bei Fritzsches einen kleinen Vortrag über meine Beziehung zum Christentum berichten. Sie haben sicherlich im Haus Ihrer Tante von dem Ehepaar auf dem benachbarten Schloss Klein-Tschirne gehört. Beide sind meine Patienten und haben mich vor Jahren als Neuankömmling in Beuthen unter ihre Fittiche genommen. Sie führen einen religiösen Kreis. Man trifft sich regelmäßig und zurzeit wechselt man sich ab mit Berichten über die eigene religiöse Entwicklung. Da hätten Sie Gelegenheit, mehr über mich zu erfahren. Wenn das nicht unbescheiden von mir ist. Und außerdem würden Sie einen für die heutige Zeit seltenen Gesellschaftskreis antreffen. Können Sie? Wollen Sie?«
Diese Fragen stellte Jochen hastig, während er zahlte und beide sich dann zum Ladenausgang wandten. Beatrice konnte nicht umhin, ihn leicht spöttisch lachend zurückzufragen: »Aha, kaum haben Sie den kleinen Finger, wollen Sie auch schon den ganzen Arm? – Ja, ich habe von meiner Tante über Frau Fritzsche gehört. Das wäre interessant. Aber ich muss vorher sehen, was meine Familie am Wochenende vorhat. Meine Tante sprach von einem eventuellen Besuch bei ihrer Schwester in Salisch.«
Jochen ließ nicht locker: »Glauben Sie, Sie könnten das in den nächsten zwei Tagen herausfinden, was Ihre Familie plant? Ich müsste bei Fritzsches früh genug Bescheid geben, wenn ich Sie mitbringe. Da ist Frau Fritzsche sehr pingelig.«
Sie traten aus dem Laden in das helle Sonnenlicht und winkten und riefen Waltraut auf der anderen Straßenseite zu. Sie hatte sich zufällig in dem Moment beim Auf- und Abwandern ihrer Straßenseite zugewendet. Gleichzeitig erblickten sie Siegfried, der auf ihrer Seite waghalsig auf einem Hydranten saß und genau so wie Waltraut geduldig auf sie gewartet hatte.
Beatrice erinnerte sich nicht nur drei Jahre später gezwungenermaßen an dieses Gespräch, das ihre Beziehung zu Jochen entscheidend beeinflusst hatte. Bis zu ihrem Lebensende, sie starb kurz nach ihrem 98. Geburtstag, kamen ihr die Bilder dieses Nachmittags mit allen gesprochenen Worten täglich messerscharf quälend in den Sinn.