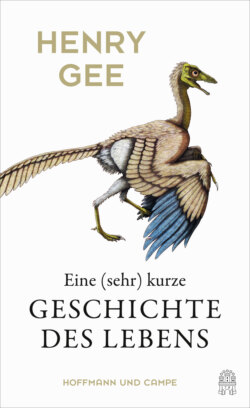Читать книгу Eine (sehr) kurze Geschichte des Lebens - Henry Gee - Страница 10
4 Fester Boden
ОглавлениеMittlerweile war das Leben in den Meeren vollends aufgeblüht – von den schillernden Lebensformen des frühen Kambriums bis hin zu den fischreichen Ozeanen des Devons. Doch nur wenige Organismen hatten sich bislang aufs Trockene gewagt. Und das mit gutem Grund.
Erstens: Lange Zeit gab es nur sehr wenig Land. Und zunächst wuchsen die Kontinente äußerst langsam. Wenn tektonische Platten zusammenstießen, erhoben sich dort bogenförmig aufgereiht Vulkaninseln aus dem Meer. Ströme glühenden Magmas brachen aus den Tiefen der Erde durch die Kruste und formten mehr davon. So entstand Insel um Insel, und als die ruhelose Erde darunter sie zusammenschob, bildeten sie die ersten Kontinente.
Zweitens: Das Leben an Land ist hart. Wasser ist eine schützende Wiege. Ohne seinen Auftrieb spüren die Geschöpfe jedes Gramm ihres eigenen Gewichts, das sie zu Boden zieht. In der sengenden Sonne würde ihr Gewebe rasch austrocknen. Und ohne einen ständigen Wasserfilm versagen Kiemen ihren Dienst, sodass die Tiere nicht mehr atmen können. Jedes abenteuerlustige Geschöpf, das sich an Land gewagt hätte, wäre verdorrt, erstickt und zermahlen worden. Solche Pioniere hätten eine Umgebung vorgefunden, die fast so lebensfeindlich gewesen wäre wie das Weltall.
Auch der feste Boden selbst wäre erbarmungslos gewesen, denn es gab nichts als karges vulkanisches Gestein – keine schattenspendenden Bäume, da sich Bäume erst noch entwickeln mussten. Mit Ausnahme von herbeigewehtem Staub gab es auch kein Erdreich, denn erst Lebewesen – Wurzeln, Pilze und im Boden wühlende Würmer – schaffen und reichern Böden an, in denen Pflanzen wachsen können. Die Erde oberhalb der Wasserlinie war eine Ödnis, so trocken und leblos wie die Oberfläche des Mondes, der noch immer riesengroß über dem Horizont stand.
Doch wie wir gesehen haben, neigt das Leben dazu, sich jeder Herausforderung zu stellen. Eine komplett neue Umgebung ohne den Überlebenskampf der Ozeane bot Geschöpfen, die Wege finden würden, den Widrigkeiten zu trotzen, ungeahnte Möglichkeiten. Der erste Schritt war die Besiedlung von Tümpeln und Flüssen durch Algen, die bereits vor 1200 Millionen Jahren begonnen hatte.[85] Möglicherweise verbargen sich schon damals einige hartnäckige Bakterien, Algen und Pilze in abgeschiedenen Nischen entlang der kargen Küsten. Und es ist durchaus denkbar, dass manche der Geschöpfe des Ediacariums einige Zeit oberhalb der Wasserlinie verbrachten, wenn sie von den Gezeiten überrascht wurden.[86] So glitt etwa im Kambrium ein unbekanntes Wesen auf die flachen Strände des Urkontinents Laurentia[87] und hinterließ Spuren, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Profilabdrücken von Motorradreifen aufwiesen.[88] Dies jedoch waren seltene und wagemutige Unterfangen, als hätte der Biker ein paar rasante Wheelies hingelegt, wäre dann aber rasch wieder unter die Wellen zurückgekehrt. Das Leben hatte sich an Land gewagt, doch heimisch geworden war es längst noch nicht.
*
Die tatsächliche Eroberung des Landes begann erst Mitte des Ordoviziums, vor rund 470 Millionen Jahren[89] – etwa zur gleichen Zeit, als ein evolutionärer Innovationsschub in den Meeren dafür sorgte, dass viele der merkwürdigen Kreaturen des Kambriums von einer moderneren Riege ersetzt wurden.[90] Kleine Kriechpflanzen wie Lebermoose und andere Moosarten sicherten Millionen winziger Brückenköpfe an Land. Ihren Sporen – zäh und resistent gegen Austrocknung – war es zu verdanken, dass dieses Wagnis kein folgenloses Intermezzo blieb. Schon bald darauf reckten sich bereits die ersten Bäume in Richtung Himmel. Die ersten waren die Nematophyta. Eine Art, die Prototaxites, hatte Stämme von einem Meter Durchmesser, und sie wurde mehrere Meter hoch. Allerdings war es weniger ein Baum, ja nicht einmal ein Baumfarn, als vielmehr eine gewaltige Flechte – ein Pilz, der einer Alge ähnelte.
Darunter kam die Erde nicht zur Ruhe. In einer Phase gewaltiger Vulkanausbrüche wurde Gestein ausgespien, das gut mit Kohlendioxid reagierte und es so der Atmosphäre entzog. Ohne Kohlendioxid, das den Treibhauseffekt am Laufen gehalten hatte, kühlte sich die Erde ab. Zugleich schob sich der riesige Südkontinent Gondwana über den Südpol. An Land bildeten sich wieder Gletscher. Diese Gletscher wiederum nährten sich aus Meerwasser, was den Meeresspiegel sinken ließ. Dadurch reduzierte sich der Platz auf den Festlandsockeln, wo die meisten Tiere lebten. Diese Eiszeit dauerte rund 20 Millionen Jahre an, sie begann vor 460 und endete vor 440 Millionen Jahren. Sie war nicht so verheerend wie die im Ediacarium, ja sogar weniger folgenschwer als jene, die der Großen Sauerstoffkatastrophe vorausging. Dennoch starben viele Spezies von Meerestieren aus.
*
Doch wie immer passte sich das Leben auch dieser neuen Umgebung an. Als die Vergletscherung sich langsam löste, traten zähe farnartige Pflanzen in Erscheinung, deren Sporen der Trockenheit an Land noch effektiver trotzten als die der Lebermoose. Den Lebermoosen, rettungslos unterlegen, blieb nichts übrig, als sich in jene feuchten schattigen Winkel zurückzuziehen, in denen sie noch heute zu finden sind. Über das einst so karge, triste Land breitete sich ein strahlend grünes Kleid.
Im unteren Silur, vor etwa 410 Millionen Jahren, gab es bereits Wälder, die aus Nematophyta, Moosen und Farnen bestanden. Die Wurzeln dieser Pflanzen begannen das Gestein unter sich zu zermahlen und es in Erdboden zu verwandeln. Mit den Böden kamen die Bodenpilze, und einige davon – die Mykorrhizen – gingen mit den Pflanzen nützliche Verbindungen ein. Die Pilze wucherten in den Boden hinein und förderten in ihm Mineralien, die dem Pflanzenwachstum dienten. Im Gegenzug boten die Pflanzen ihnen Nahrung, die sie durch Photosynthese hergestellt hatten. Pflanzen mit Mykorrhizen-Parasiten waren gegenüber anderen deutlich im Vorteil. Ein gutes Wachstum verdankt heute fast jede Pflanze einem Mykorrhizapilz an ihren Wurzeln.[91]
Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert, verloren diese Pflanzen Schuppen, Sporen und andere Materie, und in den klammen Nischen dieser ersten Waldböden krabbelten bald die ersten kleinen Tiere.
*
Die ersten Tiere auf dem Land waren kleine Gliederfüßer: Tausendfüßer, spinnenähnliche Tiere wie die Weberknechte sowie Springschwänze – enge Verwandte der Insekten, die bald zu den erfolgreichsten Landtieren aller Zeiten aufsteigen sollten, sowohl was Anzahl als auch was Artenfülle betrifft.
Im Laufe des Devons gediehen diese Wälder und breiteten sich aus. Doch hatten sie noch wenig mit den heutigen Wäldern gemein.[92] Urzeitliche Waldbäume wie etwa die Cladoxylopsida glichen eher riesigen Schilfrohren, deren hohle, zweiglose Stämme zehn Meter oder höher in den Himmel ragten, wo sie in bürstenartigen Bauschen endeten, die wie Fliegenwedel aussahen.[93] Später kamen bärlappähnliche Pflanzen und der Ackerschachtelhalm (Equisetum) hinzu, der auch heute noch in feuchten Gegenden zu finden ist. Die heutigen Arten sind sehr klein; ihre urzeitlichen Verwandten waren Riesen. Das Bärlappgewächs Lepidodendron wurde bis zu 50 Meter hoch, die Schachtelhalme bis zu 20 Meter. Die meisten dieser Bäume waren hohl. Sie enthielten kein Kernholz und wurden nur von ihrer dicken Außenrinde gestützt. Manche dieser Bäume, wie zum Beispiel Archaeopteris, sahen heutigen Bäume etwas ähnlicher und hatten auch Kernholz – unterschieden sich aber darin, dass sie Sporen abwarfen wie Farne, statt sich mit Hilfe von Samen zu vermehren.
Die Fülle dieser Pflanzen, so möchte man meinen, müsste eine hervorragende Nahrungsquelle abgegeben haben. Doch noch viele Millionen Jahre lang standen Pflanzen nicht auf dem Speiseplan von Tieren. Holziges Gewebe ist hart und unverdaulich, zudem produzieren Pflanzen chemische Stoffe wie Phenole und Harze, die für Tiere schädlich sind. Pflanzliches Material konnte erst gefressen werden, wenn es von Pilzen und Bakterien in verdaubaren Detritus, organisches Restmaterial, zerlegt worden war. Sehr lange Zeit dienten Pflanzen folglich weniger als Nahrungsquelle denn als Kulisse für alltägliche Minidramen, bei denen winzige Fleischfresser ebenso winzige Detritusfresser unter der urzeitlichen Laubdecke hin und her jagten. Das Pflanzenfressen war eine Fähigkeit, die sich erst entwickeln musste. Es begann damit, dass Insekten anfingen, sich von zarten Pflanzenteilen zu ernähren – etwa Fortpflanzungsstrukturen wie Zapfen. Und schließlich mit der Ankunft von Neuankömmlingen aus dem Meer – den Tetrapoden.
*
Tiere, so wie alles Leben, entwickelten sich ursprünglich im Meer. Die meisten ihrer Nachkommen leben noch immer dort, und auch die Wirbeltiere bilden da keine Ausnahme. Auch heute noch sind die meisten Wirbeltiere Fische. Vor diesem Hintergrund ließen sich die Tetrapoden – jene Wirbeltiere, die den Schritt an Land gemacht haben – mit einigem Recht als ziemlich seltsame Fischgattung bezeichnen, die sich an das Leben in negativer Wassertiefe angepasst hat.
Ihre Wurzeln reichen zurück bis ins Ordovizium, als im Zuge zunehmender Biodiversität die ersten Kieferfische aufkamen.[94] Bis zum Silur war so eine ganze Reihe kiefertragender Fische entstanden wie etwa der Guiyu oneiros, den wir in Kapitel 3 kennengelernt haben. Diese ersten Fische vereinen Merkmale, die man heute bei zwei ganz unterschiedlichen Gruppen antrifft. Die erste dieser beiden Gruppen, die Strahlenflosser, umfasst nahezu alle heute lebenden Fischarten, vom Aal bis zum Zackenbarsch, von der Äsche bis zum Zander. Bei diesen Fischen sind die paarigen Flossen mit direkt an der Außenhaut anliegenden Knochen verbunden. Diese Fischklasse war nicht immer so dominant. In der Urzeit dominierten noch ihre Vettern, die Fleischflosser. Wie der Name vermuten lässt, sitzen ihre Flossenpaare weiter vom Körper entfernt, an fleischigen Fortsätzen, die von zusätzlichen Knochen unterstützt werden.
*
Die Fleischflosser waren einst eine überaus vielfältige Gruppe. Zu ihnen gehörten etwa die Onychodontiformes, Geschöpfe mit locker sitzenden Schädelknochen und Fangzähnen im Unterkiefer, sowie riesige Raubfische wie die Rhizodontidae. Der größte Rhizodont, Rhizodus hibberti, erreichte eine Länge von bis zu sieben Metern. Darüber hinaus gab es noch eine Fülle anderer Arten, viele davon mit dicken Schuppenpanzern, die von einer Form von Zahnschmelz überzogen waren.
Die wohl unscheinbarsten Fleischflosser waren (und sind) die Quastenflosser. Sie tauchten erstmals im Devon auf[95] und veränderten ihr Aussehen bis zu ihrem Aussterben etwa zur Zeit der Dinosaurier kaum – jedenfalls glaubte man das sehr lange. Und zwar bis zum Jahr 1938, als ein (jüngst verstorbenes) Exemplar vor der Küste von Südafrika entdeckt wurde, das zu einem Bestand gehört, der noch immer unweit der Komoren im Indischen Ozean lebt.[96] Seither wurde eine weitere Population in Indonesien entdeckt.[97] Diese Tiere sahen ihren entfernten Vorfahren aus dem Devon immer noch verblüffend ähnlich. Obwohl sie den einheimischen Fischern durchaus bekannt waren, hatten sie keinerlei wissenschaftliche Beachtung erfahren – womöglich aufgrund ihres abgelegenen Lebensraumes im Tiefwasser, meist in der Nähe steiler unterseeischer Klippen.
Manche der Lungenfische hingegen sind kaum wiederzuerkennen. Obwohl es sich bei dem Australischen Lungenfisch, Neoceratodus, um einen mit knochigen Schuppen bewehrten Süßwasserfisch handelt, der den urzeitlichen Fleischflossern durchaus ähnelt, haben sich seine Vettern, der südamerikanische Lepidosiren und der afrikanische Protopterus, so verändert, dass sie in der Vergangenheit oft mit Landwirbeltieren verwechselt wurden.[98]
Wieso, das lässt ihr Name schon erahnen.
Wenngleich alle Fische ursprünglich eine Lunge besaßen – eine Art Sack, der aus dem Gaumen herauswuchs –, hat sich diese bei den meisten Fischen zu einem separaten Organ entwickelt: der Schwimmblase, mit der sie ihren Auftrieb regulieren. Beim Quastenflosser, der ausschließlich im Meer vorkommt, ist sie mit Fett gefüllt. Lungenfische allerdings leben in Flüssen und Tümpeln, die austrocknen können, sodass die Fische zuweilen buchstäblich auf dem Trockenen sitzen. Infolgedessen nutzen die Lungenfische ihre Lunge viel häufiger dazu, tatsächlich Luft zu atmen. Der südamerikanische Lepidosiren ist sogar gänzlich auf die Luftatmung angewiesen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Lungenfische besonders eng mit Landwirbeltieren verwandt wären. Ihre Anpassung an das Leben an Land vollzog sich völlig unabhängig, und bei Lepidosiren und Protopterus sind die Gliedmaßen zu dünnen peitschenähnlichen Fortsätzen verkümmert, anstatt so dick und kräftig zu werden, dass sie ihr Gewicht an Land tragen könnten. Die frühen Lungenfische des Devons dagegen ähnelten den Fleischflossern ihrer Zeit.
Das gilt auch für jene Fische, deren Vettern schließlich den Schritt aufs Land wagten. Geschöpfe wie Eusthenopteron und Osteolepis sahen so fischig aus, wie man es sich nur vorstellen kann, doch ihre nahen Verwandten waren längst zu gelegentlichen Landgängen imstande, bevor sie sich diese zur Gewohnheit machten.
Viele dieser Fische lebten in flachen, dicht bewucherten Fließgewässern, wo sie ihren kleineren Verwandten auflauerten. Manche wurden immer größer und benutzten ihre biegsamen, knochenunterstützten Flossen, um zu den besten Verstecken zu robben und aus dem Hinterhalt über nichts ahnende Passanten herzufallen. Die Rhizodontidae etwa taten dies. Eine andere Gruppe aber, die Elpistostegalia, gingen noch erheblich weiter.
*
Elpistostegalia waren die geborenen Flachwasserjäger. Im Gegensatz zu den meisten Fischen, die so schmal sind, als hätte man sie von beiden Seiten zusammengequetscht, waren sie platt wie Krokodile – ideal fürs Auflauern im niedrigen Wasser. Manche trugen ihre Augen sogar oben auf dem Kopf statt an den Seiten, was den Vergleich noch unterstreicht. Die unpaarigen Flossen – Rücken- und Afterflossen und so weiter – waren verkümmert oder fehlten ganz, und ihre paarigen Flossen hatten sich zu einer Art von Gliedmaßen entwickelt, im Grunde kleinen Armen und Beinen mit flossenartigen Fransen. Ein typisches Beispiel war Tiktaalik[99] aus dem oberen Devon, Elpistostege[100] ein weiteres. Diese Tiere waren rund einen Meter lang, also in etwa so groß wie ein kleines Krokodil. Sie besaßen breite, flache Köpfe und Augen, die mittig oben auf dem Schädel lagen; dazu einen gewundenen kräftigen Körper und beinartige Vorderglieder. Die Knochen dieser Gliedmaßen glichen bereits in allen Einzelheiten denen landlebender Wirbeltiere. Diese Fische hatten Lungen und benutzten ihre Kiemen wohl nur selten. Jener Teil der Schädeldecke, der normalerweise über die Kiemengegend geragt hätte, war recht kurz und bildete deutlich einen Hals – ein klarer Vorteil für einen Lauerjäger, der rasch den Kopf drehen können musste, um nach fliehenden Beutetieren zu schnappen. Elpistostegalia waren fast in jeder Hinsicht Vierfüßer, außer dass ihre Beine – statt in Füßen und Zehen – noch in flossenartigen Fransen endeten.
*
Tiktaalik, Elpistostege und ihre Verwandten lebten vor rund 370 Millionen Jahren, in der Spätzeit des Devons. Ihre Geschichte allerdings reicht viel weiter zurück. Ein Mitglied ihrer Familie muss seine Strahlenflossen schon mindestens 25 Millionen Jahre zuvor gegen Finger und Zehen eingetauscht haben. Bereits vor 395 Millionen Jahren hinterließ einer von ihnen seine Fußabdrücke an einem Strand, der heute in Zentralpolen liegt.[101] Niemand weiß, was für ein Vierfüßer diese Spuren hinterlassen hat, aber kein anderes Lebewesen außer einem Tetrapoden kann es gewesen sein.
Was diesen Fund – abgesehen von dem frühen Zeitpunkt – so bemerkenswert macht, ist, dass die Abdrücke nicht in Süßwasser entstanden, aber in einem Watt nahe dem Ozean. Wie die Venus von Milo[102] entstiegen die ersten Landwirbeltiere also unmittelbar dem Meer. Sie hatten sich an Salzwasser angepasst oder zumindest an das brackige Wasser der Mündungsgebiete.[103]
*
Tief darunter bewegte sich die Erde noch immer. Seit dem Zerfall des Superkontinents Rodinia waren die Kontinente auseinandergedriftet und voneinander getrennt. Nun aber, nach einer halben Milliarde Jahren, trieben sie langsam wieder aufeinander zu. Das ordovizische Massenaussterben, das dadurch ausgelöst worden war, dass sich der große Südkontinent Gondwana über den Südpol geschoben hatte, war ein Vorbote dieser Entwicklung.
Gegen Ende des Devons hatten Gondwana und zwei große nördliche Landmassen, Euramerika und Laurussia, begonnen sich aufeinander zuzubewegen. Die Kollision sollte gewaltige Bergketten hervorbringen und eine einzige große Landmasse – Pangäa. Erneut hatte das Verschmelzen der Kontinente drastische Folgen für die Geschöpfe, die auf ihrer Oberfläche lebten: Es war in etwa so, als würde man eine Bettdecke ausschütteln und sämtliche Spielzeuge, Krümel, Bücher und Frühstückssachen durcheinanderwirbeln, die achtlos dort verstreut lagen. Die Verwitterung der neuen kargen Gebirge entzog der Luft große Mengen Kohlendioxid, drosselte den Treibhauseffekt und führte zur erneuten Vergletscherung Gondwanas, das immer noch über dem Südpol lag. Andernorts forderte der Vulkanismus seinen Tribut. Ein weiteres Massensterben kündigte sich an.
Am verheerendsten traf es die Ozeane: Korallen wurden dezimiert. Die Stromatoporen, die im Devon sehr häufigen riffbildenden Schwämme, starben aus.[104] Stromatolithen feierten ihre Wiederauferstehung an den Riffen. Die Umwälzungen besiegelten das Schicksal der letzten Panzerfische, kiefertragend oder nicht, ebenso wie das der meisten Fleischflosser. Andere Gattungen hingegen überlebten. Was die letzten Epochen des ausgehenden Devon vor allem prägte, war die Vielfalt neuer Vierfüßer.
*
Zunächst allerdings blieben diese Tetrapoden vorwiegend im Wasser. Obwohl sie Gliedmaßen mit Fingern hatten, besetzten sie die Nischen der wasserlebenden Lauerjäger, ganz ähnlich wie ihre Vorgänger, die Rhizodontidae und Elpistostegalia. Wofür auch immer Finger und Zehen gut waren, für das Leben an Land hatten sie sich anscheinend nicht eigens entwickelt.
Die primitivsten dieser Vierfüßer waren Elginerpeton[105] aus Schottland und der im heutigen Lettland gefundene Ventastega.[106] Es gab Tulerpeton[107] und Parmastega[108] aus Russland und Ichthyostega aus den tropischen Sümpfen des heutigen Ostgrönland. In Aussehen und Lebensweise ähnelte Parmastega ebenso seinem Vorgänger Tiktaalik wie einem heutigen Kaiman: Er schlängelte sich beutesuchend durchs flache Wasser, wobei allein die Augen über die Oberfläche ragten. Mit einer Länge von rund 1,5 Metern war Ichthyostega recht groß, sehr stämmig, und seine seltsam gebogene Wirbelsäule lässt vermuten, dass er auf dem Trockenen unbeholfen wie ein Seehund übers Land gerobbt sein muss, anstatt seine dicken Stummelbeinchen zu benutzen.[109] Der ebenfalls in Grönland gefundene Acanthostega war indes nur halb so groß und erheblich schlanker gebaut. Obwohl er Beine hatte, standen sie seitlich ab und waren zum Laufen gänzlich ungeeignet. Er besaß innen liegende Kiemen wie ein Fisch und konnte demnach ausschließlich im Wasser leben.[110] Sein Zeitgenosse Hynerpeton aus Pennsylvania hingegen war außerordentlich muskulös und für das Leben an Land durchaus gut gewappnet.[111] Bis zum Ende des Devons hatten sich die Tetrapoden zu einer äußerst vielfältigen, doch vorwiegend im Wasser lebenden Gruppe seltsamer Fleischflosser entwickelt, die eben Beine hatte.
*
Allerdings schienen es die frühen Vierfüßer mit ihren Beinen – zumindest jedoch mit Händen und Füßen – nicht allzu genau genommen zu haben. Tulerpeton hatte sechs Finger an jedem seiner Glieder, Ichthyostega sieben und Acanthostega nicht weniger als acht.[112] Viele Landwirbeltiere haben im Laufe der Evolution seither Finger oder sogar ganze Gliedmaßen eingebüßt, doch keiner der heutigen Vertreter bildet im Normalfall mehr als fünf Finger pro Glied aus. Das Fünf-Finger-Glied (ein Prinzip, das Pentadaktylie genannt wird) scheint derart tief verwurzelt, dass man es fast schon als Archetyp im Baukasten Gottes betrachten könnte – und das vereinzelte sechsfingrige Geschöpf als Verstoß gegen die natürliche Ordnung der Dinge.
*
Die vielen neu entstandenen Arten von Tetrapoden überlebten zwar das Ende des Devons, machten in der folgenden Periode des Karbons aber einer »modernen« Fauna kleinerer und schlankerer Tiere Platz.[113] Diese sahen Salamandern ähnlicher als Fischen und hatten sich schließlich darauf geeinigt, wie viele Finger oder Zehen sie am Ende ihrer Gliedmaßen denn haben wollten.
Vor etwa 335 Millionen Jahren, als Pangäa allmählich seine endgültige Form annahm, wimmelte es in den dunklen, dunstigen Urwäldern des heutigen West Lothian, Schottland, vor krabbelndem Getier, und das Quaken früher Tetrapoden erfüllte die Luft dieser vulkanisch geprägten und womöglich auch von heißen Quellen aufgewärmten Gegend. Kein Wunder also, dass einer der vierbeinigen Bewohner dieser schwülen Sümpfe Eucritta melanolimnetes getauft wurde – das Monster aus der Schwarzen Lagune.[114]
*
Selbst als ihre Beine kräftig genug geworden waren, um ihr Gewicht an Land zu tragen, gab es noch immer eine Sache, die die frühen Tetrapoden stets zurück ins Wasser zwang: die Fortpflanzung. Wie heutige Amphibien waren diese ersten Landwirbeltiere darauf angewiesen, zum Laichen ins Wasser zurückzukehren. Ihre Jungen müssen Kaulquappen geähnelt haben – fischähnlichen Wesen mit Flossen, die mit Kiemen atmeten.
Bald jedoch sollte eine Tiergruppe auf den Plan treten, die die Fortpflanzung revolutionieren und so den Weg für die endgültige Eroberung des Landes ebnen würde. In den Kohlewäldern, unter dem Quaken anderer früher Landwirbeltiere, neben hundegroßen Skorpionen und in ständiger Gefahr vor Eurypteriden, riesigen Seeskorpionen, die den Vierfüßern an Land gefolgt waren, lebte ein Tier namens Westlothiana. Dieses kleine echsenartige Geschöpf[115] war evolutionär sehr eng verwandt mit einer Gruppe von Tetrapoden, die Eier mit fester wasserdichter Schale hervorgebracht hatten. Jedes Ei war nun sein eigener kleiner Tümpel und konnte abseits des Wassers abgelegt werden, wodurch die Verbindung zwischen Wirbeltieren und dem Meer endgültig gekappt wurde. Es waren die Tiere, aus denen eines Tages die Reptilien, Vögel und Säugetiere hervorgehen sollten.