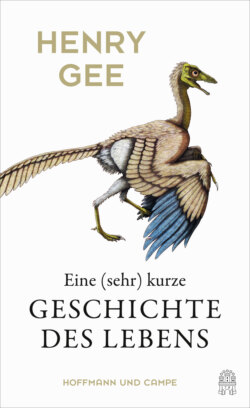Читать книгу Eine (sehr) kurze Geschichte des Lebens - Henry Gee - Страница 9
3 Die Wirbelsäule wächst
ОглавлениеWährend in den warmen flachen Meeren des frühen Kambriums stachelige Kopffüßer mit ihren Zangen um die Wette klapperten, nahm im sandigen Schlamm aus Mineralkörnern darunter eine ganz andere Geschichte ihren Lauf. Ein kleines, gerade einmal stecknadelkopfgroßes Geschöpf namens Saccorhytus fristete sein karges Dasein, indem es Abfälle aus dem Wasser zwischen den Körnern siebte.[54] Es war keine große Neuerung, Nahrung aus dem Meer zu filtern – Schwämme taten es seit 300 Millionen Jahren, und viele andere Lebewesen, wie etwa die Muscheln, waren gerade dabei, es neu zu erfinden. Den Sedimentboden nach Essbarem zu durchsieben, ist eine wenig aufwendige, aber effiziente Art, über die Runden zu kommen, insbesondere für kleine Tiere mit recht anspruchslosem Stoffwechsel. Saccorhytus war ein solches Tier.
Geformt wie eine Kartoffel, war Saccorhytus doch viel kleiner und hatte einen großen runden Mund, in den er mit Hilfe von Reihen wedelnder Zilien Wasser hineinströmen ließ, ähnlich wie es bei Schwämmen abläuft. An beiden Seiten besaß er jeweils eine Reihe von Poren, wie Bullaugen an einem Schiff, durch die das gefilterte Wasser wieder austrat. In seinem Inneren hielten Netze aus klebrigem Schleim Detritus aus der Wasserströmung zurück. Der Großteil des Innenlebens von Saccorhytus bestand aus dieser Kombination aus Mund und Bullaugen, die Pharynx – oder einfach Rachen – genannt wird. Dieser Schleim wurde dann zu einem Strang gewunden und von einem Darm geschluckt. Der Darm war gemeinsam mit allen übrigen inneren Organen auf relativ kleinem Raum an der Hinterseite des Tieres untergebracht. Auch der Anus lag innen, und die Fäkalien wurden durch die Bullaugen herausgeschwemmt, zusammen mit Spermien oder Eizellen, die, vom Muttertier ausgestoßen, ihr Glück in der feindlichen Außenwelt versuchen mussten.
*
Ansonsten jedoch war Saccorhytus völlig hilflos, seiner Umgebung ebenso ausgeliefert wie die Mineralkörner, zwischen denen er lebte. Zahllose dieser Tiere fielen mit Sicherheit anderen Filtrierern wie Schwämmen oder Muscheln zum Opfer, wenngleich sie von größeren Raubtieren wohl kaum beachtet wurden. Einige ihrer Nachkommen jedoch befreiten sich aus dieser misslichen Lage, indem sie größer, wendiger, besser gepanzert oder schlicht gefährlicher wurden – oder eine Kombination aus diesen vier Dingen.
Größer zu sein birgt einen klaren Vorteil: Es verringert die Gefahr, im Ganzen geschluckt oder gefressen zu werden, obwohl es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass andere Tiere einen anknabbern und häppchenweise verspeisen. Um diesem Schicksal zu entgehen, legten sich nun manche Tiere Rüstungen – sprich Panzer – zu. Etliche andere Tiere hatten dies bereits getan, indem sie ihre äußeren Schichten mit Kalziumkarbonat verstärkten, das sie aus den mineralreichen Meeren gewannen. Kalziumkarbonat ist eines der häufigsten Minerale – es ist der Grundstoff von Kalzit, Kreide, Kalkstein und Marmor. Die kambrischen Meere waren reich an Kalziumkarbonat, das, von Lebewesen geformt, zu Perlmutt wird. Es bildet die Gehäuse von Muscheln und Krustentieren, die mikroskopisch kleinen Spicula der Schwämme und das Gerüst, auf dem die phantastischen Formen von Korallenriffen aufgebaut sind.
Einige der gepanzerten Erben von Saccorhytus schufen sich ganz eigene unverwechselbare Kettenhemden, bei denen jedes Glied aus einem einzigen Kalzitkristall bestand. Auf diese Weise entwickelten sie sich zu den Stachelhäutern, den Vorfahren der heutigen Seesterne und Seeigel. Heutzutage weisen alle Stachelhäuter eine charakteristische Körperform auf, die auf der Zahl fünf basiert und sich von allen anderen Tieren unterscheidet. Im Kambrium waren ihre Formen jedoch vielfältiger. Einige waren bilateral symmetrisch aufgebaut, andere dagegen triradial (das heißt, ihre Symmetrie basierte auf der Zahl drei), wieder andere hatten völlig unregelmäßige Formen entwickelt. Doch alle begannen mit dem Mund-mit-Bullaugen-Pharynx des Saccorhytus, wenngleich dieser im Laufe der Zeit durch andere Arten der Nahrungsaufnahme ersetzt wurde. Kein heutiger Stachelhäuter ernährt sich mehr auf diese Weise.
*
Als Verteidigungsstrategie gegen Fressfeinde entschieden sich die Stachelhäuter für die Panzerung. Eine andere Lösung wäre Flucht gewesen – die Fähigkeit, dem Angreifer möglichst schnell davonzuschwimmen. Diese Strategie wählte ein anderer Zweig der Saccorhytus-Nachkommen. Einige von ihnen entwickelten einen peitschenden Schwanz, der aus dem hinteren Ende des Rachens ragte und es ihnen ermöglichte, jeder potenziellen Gefahr so rasch wie möglich zu entfliehen.
Die Grundform dieses Schwanzes, ein langer, fester und doch biegsamer Stab, entwickelte sich aus einem rudimentären Fortsatz des Darms. Man kann sich diese Notochord oder Chorda dorsalis genannte Struktur in etwa so vorstellen wie die wurstförmigen Ballons, aus denen Alleinunterhalter bei festlichen Anlässen so erstaunliche Formen knoten. Trotz seiner Biegsamkeit konnte das Notochord, wenn es nicht unter Spannung stand, stets wieder in seine ursprüngliche lange dünne Form zurückschnellen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignete es sich als Ansatzpunkt für Muskelstränge auf beiden Seiten. Diese konnten sich abwechselnd zusammenziehen und entspannen, wodurch der Körper des Tieres in s-förmige Windungen versetzt wurde, die es im Wasser vorwärtsbewegten. Gesteuert wurden diese Muskeln durch eine Reihe von Nervenfortsätzen, die gleichmäßig über die Oberseite des Notochords verteilt waren – das Rückenmark.
Ein kambrischer Tierstamm, die sogenannten Vetulicolia, sieht in etwa so aus.[55] Diese Tiere, die nur ein paar Zentimeter lang sind, haben einen Saccorhytus-ähnlichen Rachen, an den sich ein vielgliedriger Schwanz anschließt. Obgleich manche Vetulicolia im offenen Meer schwammen,[56] verbrachten sie die meiste Zeit vergraben im Sand, nur das Maul schaute heraus, mit dem sie in aller Ruhe Sediment einsaugten und filterten. Drohte jedoch Gefahr, konnten sie mit dem Schwanz schlagen und blitzschnell die Flucht ergreifen, sich an einem neuen Ort niederlassen und mit ihrem Schwanz ein neues Versteck in den Sand graben. Die Yunnanozoa waren Vettern der Vetulicolia, bei ihnen hatten Schwanz und Rachen begonnen zusammenzuwachsen. Jedoch entwickelte sich der Schwanz nicht nur nach hinten; er wuchs ebenfalls nach vorn über den Rachen hinweg, bis er ihn schließlich einschloss und dem Tier damit eine fischähnlichere Form verlieh.[57] Zu diesem Typ gehörte etwa Pikaia, ein sonderbares Geschöpf aus dem Burgess-Schiefer.[58] Ein anderes solches Tier war Cathaymyrus aus der Chengjiang-Faunengemeinschaft in China.[59]
*
Auf den ersten Blick sah Cathaymyrus aus wie ein Sardellenfilet. Obwohl sein Notochord und seine Muskelstränge, von denen der erste den Rachen ganz umschließt, gut zu sehen sind, scheint doch einiges zu fehlen. Ein einzelner Pigmentfleck an der Vorderseite diente als Auge. Cathaymyrus hatte keinen Kopf, keine Schuppen, keine Ohren, keine Nase, kein Gehirn – nichts davon. Der Zauberer von Oz hätte ihm so manchen Wunsch erfüllen können: Offenbar hatte er aber Dorothys Einladung ausgeschlagen, mit ihr über den gelben Ziegelsteinweg zu wandern, um ihn zu suchen. Dennoch haben Cathaymyrus und seine Verwandten eine halbe Milliarde Jahre erfolgreich, wenn auch sehr genügsam, überdauert – mit dem Schwanz im Sand, in den wenig beachteten Spalten und Ritzen des Meeresbodens, wo sie fast ihr gesamtes Leben damit verbrachten, auf altbewährte Weise Detritus aus dem Meerwasser zu sieben. Nur wenn sie sich bedroht fühlen, schießen sie heraus und schwimmen so lange umher, bis sie einen sicheren neuen Zufluchtsort gefunden haben. Ein paar von Cathaymyrus’ Verwandten haben sogar bis heute überlebt – man nennt sie Lanzettfischchen oder Amphioxus.
*
Cathaymyrus brachte Rachen und Schwanz zu einem einzigen stromlinienförmigen Tier zusammen. Manche seiner Verwandten allerdings entschieden sich für eine völlig andere Lebensweise: Anstatt Rachen und Schwanz miteinander zu verbinden, »dekonstruierten« diese Geschöpfe – die Manteltiere – sie und bedienten sich ihrer jeweiligen Vorteile in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens.[60] Die Manteltier-Larve ist im Grunde nur ein Schwanz mit einem einfachen Gehirn, Augenfleck und Gleichgewichtsorgan. Diese Sinnesorgane sind bestenfalls rudimentär, erfüllen aber ihren Zweck, der darin besteht, dunkel von hell zu unterscheiden und der Larve zu vermitteln, wo unten ist. Die Larve besitzt keinen ausgebildeten Rachen und kann nicht fressen, was jedoch nicht weiter schlimm ist, da ihr Zweck einzig und allein darin besteht, einen tiefen dunklen Ort zu finden, wo sie sich als ausgewachsenes Tier niederlassen kann. Sobald ein geeigneter Platz gefunden ist, heftet sie sich mit dem Kopf an dieser Stelle fest. Der Schwanz bildet sich zurück, und das Tier bläht sich zu einem gigantischen Rachen auf, der allein der Nahrungsaufnahme dient. Derart mit dem Ort verbunden, geben sie eine leichte Beute ab, also haben Manteltiere eine ganz eigene Art der Panzerung entwickelt – ihren namensgebenden Mantel aus Zellulose. Dieser Stoff, der sonst nur in Pflanzen vorkommt, ist absolut unverdaulich. Die Mäntel der Manteltiere können auch andere fremde Stoffe aus dem Meerwasser wie Nickel oder Vanadium enthalten, und zuweilen sind sie auch durch Mineralien verhärtet. Die Art Pyura beispielsweise ist, solange man sie nicht aufbricht, kaum von einem Stein zu unterscheiden. Die Lebensweise der Manteltiere hat sich seit dem Kambrium nicht verändert.[61]
*
Für ihre Ernährung haben Manteltiere sich schon immer auf ihr althergebrachtes Filtersystem verlassen:[62] den von Saccorhytus erfundenen Maul-mit-Bullaugen-Rachen. Ihre nächsten Verwandten, die Wirbeltiere, haben dagegen einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Sie verwandelten ein ursprünglich allein zur Flucht gedachtes Hilfsmittel – das Notochord samt Schwanz – in ein Instrument für die Vorwärtsbewegung. Cathaymyrus und seine Verwandten benutzten ihren vom Notochord gestützten Schwanz nur für sehr kurze Sprints. Bei Manteltieren besaßen, wie gesagt, meist nur die Larven einen solchen Notochord-verstärkten Schwanz, der einzig dazu gedacht war, an einen guten Ort zur Sesshaftwerdung zu gelangen, und sobald das Tier sich einmal niedergelassen hatten, blieb es auch dort. Solche Tiere brauchten nur die allernötigsten Informationen über die Richtung, in die sie zu schwimmen hatten. Der Schwanz diente ihnen lediglich als eine Art Boost-Antrieb für eine kurze Reise, die immer rasch zu Ende war.
Wirbeltiere hingegen verbrachten nie einen nennenswerten Teil ihres Lebenszyklus unbeweglich an ein und demselben Ort.[63] Ständiges Umherstreifen erforderte freilich ein viel umfassenderes Instrumentarium an Sinnen. Wirbeltiere entwickelten große paarweise Augen, einen ausgeprägten Geruchssinn und ein ausgefeiltes System zum Aufspüren von Wasserströmungen.[64] Wirbeltiere wurden sich ihrer Umgebung und ihres Platzes darin ungleich bewusster als alle anderen Mitglieder der Saccorhytus-Familie – Manteltiere, Lanzettfischchen, Vetulicolia, Stachelhäuter und so weiter. Ein ausgeklügeltes Sensorium aber erfordert ein komplexes zentrales Gehirn. Die Gehirne von Wirbeltieren waren ebenso komplex – wenn nicht gar komplexer – wie die anderer hochmobiler Lebewesen, etwa der Krebstiere, der Insekten oder jenes Altmeisters in Sachen Beweglichkeit, des Oktopus, selbst wenn deren Gehirne völlig anders konstruiert waren.
Und so kam es, dass die schlammige Brühe des kambrischen Meeresbodens Fische hervorbrachte – Fische wie Metaspriggina,[65] Myllokunmingia und Haikouichthys, die nun wie zuckende Sonnenstrahlen durchs Wasser huschten.[66] Diese schmalen schimmernden Geschöpfe sind der Beweis, dass sich die Wirbeltiere entwickelt hatten und bis zur Mitte des Kambriums bereits weitverbreitet waren. Diese ersten Fische hatten Mäuler, wenn auch keine Kiefer, und einen Rachen, der nicht länger zum Sieben von Nahrung benutzt wurde. Da sie im Vergleich mit ihren Manteltier-Verwandten viel aktiver waren, benötigten sie eine bessere Versorgung mit Sauerstoff. Aus den uralten Bullaugen am Rachen, die bis auf Saccorhytus zurückgingen, bildeten sich nun Kiemenspalten. Das durchs Maul einströmende Wasser wurde mit Muskelkraft an den Kiemen vorbeigepresst. Die feingliedrigen, von vielen Blutgefäßen durchzogenen Kiemen nahmen aus dem Wasser Sauerstoff auf und setzten dafür Kohlendioxid frei. Dann wendeten sich die Wirbeltiere ihrem Rachen zu und frisierten ihn auf Höchstleistung: Aus den Scharen sanft wedelnder Zilien wurden Muskelstränge, die nun der Belüftung, sprich Atmung, dienten – und der aktiven Jagd nach Beute.[67]
*
Ein Grund, wieso Wirbeltiere mehr Energie benötigen als andere Tiere, ist, dass sie in der Regel recht groß sind. Wale und Dinosaurier – beides Wirbeltiere – sind die größten Tiere, die je gelebt haben, doch es gibt noch andere Beispiele. Man denke nur an Fische wie den Walhai und den Riesenhai, an Reptilien wie den Python oder andere Boa constrictor, an den Komodowaran oder Säugetiere wie Elefanten oder Nashörner. Nur wenige Wirbellose erreichen vergleichbare Ausmaße. Selbst wir Menschen sind für Tiere ungewöhnlich groß.[68] Gewiss, Wirbeltiere können auch sehr klein sein, manche wiegen nur wenige Gramm, doch alle Wirbeltiere sind für Menschen mit dem bloßen Auge sichtbar. Viele Wirbellose hingegen lassen sich ohne Lupe oder Mikroskop kaum erkennen.[69]
Die artenreichsten Wirbellosen sind die Insekten. Ihr Körper wird von einem Außen- oder Exoskelett gestützt, das aus einem biegsamen, Chitin genannten Protein besteht. Wenn das Insekt wächst, stößt es sein gesamtes Außenskelett ab, bläht sich auf und wartet, bis die neue, noch recht weiche Hülle ausgehärtet ist, bevor es sich bewegen kann. Dies ist ein Grund, weshalb Insekten so klein sind. Ab einer gewissen Größe würden sie ohne ein stabilisierendes Exoskelett von ihrem eigenen Gewicht zerquetscht. Nahe Verwandte der Insekten, die Krebstiere, häuten sich ebenfalls, doch leben sie vorwiegend im Wasser, das ihr Gewicht trägt. Das erklärt, wieso Krebstiere andere Ausmaße erreichen als Insekten. Man denke nur an Krabben oder Hummer, die viel größer werden können als jedes Insekt. Und dennoch: Im Vergleich zu vielen Wirbeltieren ist selbst der größte Hummer ein ausgesprochener Winzling.
*
Die primitivsten noch heute lebenden Wirbeltiere sind Neunaugen und Schleimaale. Sie besitzen keinerlei Panzerung und haben sich seit ihrer Entstehung wohl kaum verändert. Wie Metaspriggina und andere sehr frühe Fische haben sie weder Kiefer noch paarige Flossen. Andere Wirbeltiere allerdings legten sich dicke mehrschichtige Panzer zu. Solche Panzerfische traten erstmals im späteren Kambrium in Erscheinung. Obwohl sie noch immer keine Kiefer besaßen und in ihrem Inneren von einem Notochord gestützt wurden, waren die meisten dieser ersten Fische massiv gepanzert.[70] Diese Rüstungen bestanden meist aus einer Reihe fester Platten, die Kopf und Rachen schützten, am hinteren Teil des Körpers aber lockerer wurden und mehr wie Schuppen angeordnet waren, sodass der Schwanz beweglich blieb. Diese Panzer waren nicht aus Kalzit oder Kalziumkarbonat, sondern aus einem anderen Mineral, Hydroxylapatit, einer Form des Kalziumphosphats. Wirbeltiere sind die einzigen Tiere, die Panzer aus Kalziumphosphat aufweisen.[71]
Die Panzer dieser frühen Fische ähnelten meist einer Schichttorte aus drei Arten von Hydroxylapatit: Die Grundlage bildete eine weiche schwammartige Schicht, dann kam eine etwas dichtere Lage, und die oberste Schicht bestand aus einer extrem harten, sehr dichten Variante von Hydroxylapatit. Heute nennt man diese drei Arten »Knochen«, »Zahnbein« und schließlich »Zahnschmelz« – die härteste Substanz, die ein Lebewesen produzieren kann. Wie die Namen schon vermuten lassen, finden sich Knochen, Zahnbein und Zahnschmelz in ebendieser Reihenfolge auch in unseren Zähnen. Als Wirbeltiere anfingen, hartes Gewebe zu produzieren, besaßen sie im Grunde genommen am ganzen Körper Zähne. Auch heute noch haben die Schuppen eines Hais die Form winziger Zähne, weshalb Haihaut auch so rau ist und früher gern als Schleifpapier benutzt wurde.
Wirbeltiere entwickelten ihre Panzer aus demselben Grund, aus dem andere kambrische Geschöpfe ebenfalls harte Außengewebe ausbildeten – zur Verteidigung.[72] Die Evolution der Panzerfische fiel zusammen mit dem Aufkommen räuberischer Nautiloideen und gigantischer Seeskorpione, den sogenannten Eurypteriden.[73] Der wohl furchteinflößendste Eurypterid war Jaekelopterus, der im Devon lebte. Dieses Monstrum mit großen Stielaugen und gewaltigen Zangen erreichte eine Länge von rund 2,5 Metern und ernährte sich wahrscheinlich von Fischen.[74]
*
Die erste Fischgattung, die sich Panzer zulegte, waren die Pteraspidiformes. Obwohl die Kopfpanzer der Pteraspidiformes bei manchen Arten seitlich abstanden und als Tiefenruder fungierten, verfügten sie über keine paarigen flexiblen Flossen. Außen dick gepanzert, ist über das Innenleben der Pteraspidiformes jedoch wenig bekannt, da ihre Hirnschädel aus schnell verfallendem Knorpelgewebe bestanden und sie im Inneren von einem schwammigen, aber elastischen Notochord gestützt wurden. Bei einigen Panzerfischfossilien allerdings wurde das weiche Knorpelgewebe im Schädel so mineralisiert, dass sich die Form des Gehirns und der darin verlaufenden Blutgefäße recht genau erhalten hat. Die Fundstücke zeigen, dass diese kieferlosen Panzerfische ähnlich aufgebaut waren wie Neunaugen – Neunaugen mit Rüstung.
Solche kieferlosen Panzerfische bevölkerten die Meere vom späten Kambrium bis zum Ende des Devons, und es gab sie in einer Vielzahl außergewöhnlicher Formen. Manche waren dick in Panzerplatten gehüllt, glitten den Großteil ihres Lebens träge über den Meeresgrund oder wühlten im Schlamm nach Fressbarem. Bei anderen wie den schnittigeren Thelodonti[75] bestand die Panzerung aus einer Art Chagrinleder aus elastischeren Schuppen, das es den Tieren erlaubte, sich schneller im offenen Wasser fortzubewegen.
*
Die frühesten Fische wie Metaspriggina hatten ein eng zusammenliegendes Augenpaar an der Vorderseite, das an Motorradscheinwerfer erinnert. Dadurch gab es keinen Platz mehr für eine Nase oder Nasenlöcher. Zum Riechen dienten Zellen im Rachen, Überbleibsel aus jenen Tagen, als die Wirbeltiere noch Schwebstoffe aus dem Wasser filterten. Bei den Pteraspidiformes hingegen wanderten die Augen an beide Seiten des Schädels, um Platz für ein einzelnes Nasenloch zu machen, das oben auf dem Kopf lag. Das Gehirn hatte sich in eine linke und eine rechte Hirnhälfte aufgespalten und somit das Gesicht verbreitert.[76]
Das Nasenloch der Pteraspidiformes (wie auch das der Neunaugen) führte zu einem einzigen Sinnesorgan, das mit der Gehirnbasis verbunden war. Andere kieferlose Fische hingegen entwickelten sich in eine andere Richtung. Fossilienfunde etwa des ebenfalls kieferlosen Shuyu[77] zeigen, dass dieser Fisch statt einer einzigen Nasenöffnung mitten auf dem Kopf über zwei Nasensäcke verfügte, die in der Mundhöhle endeten. Diese Aufteilung, die den Gesichtsbereich noch breiter machte, ist für Wirbeltiere mit Kiefern völlig typisch, nicht aber für Neunaugen oder Pteraspidiformes. Manche der höher entwickelten kieferlosen Fische hatten paarige Pektoralflossen (die Flossen direkt hinter dem Kopf), die bei Neunaugen oder Pteraspidiformes ebenfalls fehlen, allerdings ein charakteristisches Merkmal kiefertragender Wirbeltiere darstellen. Der Weg für den Kiefer war bereitet.
Als die Panzerfische diesen Entwicklungsschritt dann schließlich unternahmen, wurden sie zu einem völlig neuartigen Tier.[78] Heute machen Kiefertiere über 99 Prozent der Wirbeltiere aus. Von den Kieferlosen haben einzig Neunaugen und Schleimaale überlebt.
*
Der Kiefer entstand, indem der erste Kiemenbogen sich in der Mitte teilte und in einer Art Scharnier nach hinten klappte, sodass Ober- und Unterkiefer entstanden. Dadurch wurde die erste Kiemenspalte so weit zusammengepresst, dass sie zu einem winzigen Loch knapp über dem Oberkiefer schrumpfte, dem Spiraculum.
Die ersten kiefertragenden Wirbeltiere waren die sogenannten Placodermi, die mit ihren dicken knöchernen Kopfschilden auf den ersten Blick wie alle anderen Panzerfische aussahen. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man jedoch, abgesehen von Kiefern, noch eine Reihe anderer Neuerungen, die einzig kiefertragende Wirbeltiere aufweisen, wie etwa ein zweites Flossenpaar zusätzlich zu den Brustflossen. Diese neuartigen Bauchflossen lagen grob gesagt rechts und links vom Anus[79] Die Placodermi kamen in der Mitte des Silurs auf und bevölkerten die Meere bis zum Ende des Devons.
Die primitiveren Placodermi, die Antiarchi, waren noch ebenso stark gepanzert wie die Pteraspidiformes. Die höher entwickelten Placodermi hingegen, die Arthrodira, trugen in der Regel (doch nicht immer) eine leichtere Panzerung, und einer von ihnen – Dunkleosteus, der bis zu sechs Meter lang wurde und gewaltige, messerscharfe Kiefer besaß – wurde zum Topräuber der devonischen Ozeane.
Ich spreche hier bewusst nur von den Kiefern des Dunkleosteus, nicht den Zähnen, da Placodermi noch über keine Zähne im heutigen Sinne verfügten.[80] Die Schnittflächen der beeindruckenden Kiefer dieser Kreatur bestanden aus den geschliffenen Kanten der Knochen selbst.
*
Einer der am weitesten entwickelten Placodermi war Entelognathus, auch wenn er mit einem Alter von 419 Millionen Jahren, noch mitten im Silur, zugleich zu den frühesten bekannten Arten zählt.[81] Entelognathus hatte einen für die Arthrodira typischen starken Kopf- und Rumpfpanzer, war mit einer Körperlänge von nur 20 Zentimetern allerdings ungleich kleiner als sein monströser Vetter Dunkleosteus.
Ein weiterer Unterschied zu Dunkleosteus – und allen anderen Placodermi – bestand darin, dass seine Kiefer erstmals mit Knochen ausgestattet waren, die denen heutiger Knochenfische ähneln: Entelognathus besaß einen ausgeprägten Oberkiefer (Maxilla) und Unterkiefer (Mandibula). Dieses Wesen war das erste Wirbeltier, das ein Lächeln hätte zustande bringen können, das wir als solches erkennen würden.
*
Obwohl die Placodermi am Ende des Devons ausstarben, brachten ihre Nachkommen drei andere Arten kiefertragender Wirbeltiere hervor: die Knorpelfische (Haie, Rochen und ihre Verwandten), die Knochenfische (zu denen die meisten der heutigen Fischarten gehören, von den Stören und Lungenfischen bis hin zu Sardinen und Seepferdchen, zudem sämtliche landlebende Wirbeltiere, uns eingeschlossen) sowie eine weitere vollständig ausgestorbene Gruppe namens Acanthodii oder Stachelhaie.
Die Acanthodii lebten noch bis ins Perm, bevor sie ausstarben. Bei den meisten Knorpel- und Knochenfischen wird das Notochord – diese biegsame, den Körper stabilisierende Strebe – im Laufe ihrer Entwicklung durch eine mehrgliedrige Konstruktion ersetzt, die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht bei Knorpelfischen, wie der Name schon sagt, aus Knorpel, obwohl dieser auch zu einem gewissen Grad mineralisiert sein kann. Bei Knochenfischen indes ist dieser Knorpel durch Knochen ersetzt worden. Ob auch Placodermi oder Acanthodii statt Notochord eine Wirbelsäule besaßen, ist nicht bekannt, doch falls dem so war, hätte sie aus Knorpel bestanden.[82]
Anstatt Panzer besaßen die Acanthodii nun vermehrt Schuppen, und sie unterschieden sich auch dadurch von anderen Arten, dass an der Spitze jeder Flosse ein Knochenstachel hervorragte. Ihr Innenskelett bestand allerdings vollständig aus Knorpel und glich eher dem von Haien.[83] Acanthodii stellten einen frühen Nebenzweig der Knorpelfische dar, einer Gruppe, die bis heute überlebt hat.
Einer der Zeitgenossen von Entelognathus in den Meeren des Silur war ein Fisch namens Guiyu oneiros. Bei ihm handelt es sich um den ersten gut erforschten Vertreter der Knochenfische – jener Tiergruppe, der die überwiegende Mehrheit aller heutigen Wirbeltiere angehört.[84] Zwar gab es auch vor Guiyu oneiros bereits Knochenfische, doch sind ihre Fossilien recht bruchstückhaft erhalten und umstritten. Was ihn so besonders macht, ist jedoch weder sein ausgezeichneter Erhaltungsgrad noch die Tatsache, dass er Knochen hat: Er ist besonders, weil er zu den ersten Fischen zählt, die man einer speziellen Unterklasse der Knochenfische zurechnet, einer Gruppe namens Fleischflosser, aus denen sich eines Tages die Landwirbeltiere entwickelten – also auch wir.