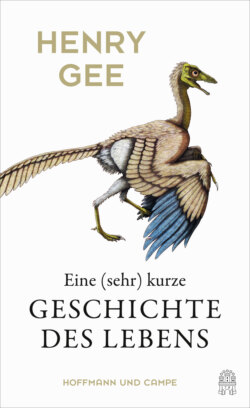Читать книгу Eine (sehr) kurze Geschichte des Lebens - Henry Gee - Страница 5
1 Das Lied von Feuer und Eis
ОглавлениеEr war einmal ein riesiger Stern, der im Sterben lag. Millionen von Jahren hatte er gebrannt, allmählich aber ging dem Fusionsreaktor in seinem Inneren der Brennstoff aus. Der Stern erzeugte die Energie, die er zum Leuchten brauchte, indem er Wasserstoffatome zu Helium verschmolz. Doch die bei dieser Fusion freigesetzte Energie brachte den Stern nicht nur zum Leuchten. Sie hatte eine weitere wichtige Funktion: Sie wirkte der Gravitation entgegen, verhinderte, dass er von seiner eigenen Schwerkraft zermalmt wurde. Als sein Wasserstoffvorrat zur Neige ging, begann der Stern das Helium zu Atomen schwererer Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff zu fusionieren. Mittlerweile jedoch hatte der Stern kaum noch etwas, was er verbrennen konnte.
Schließlich kam der Tag, als sein Brennstoff vollständig aufgebraucht war. Die Schwerkraft gewann die Oberhand: Der Stern implodierte. Obwohl er Millionen Jahre lang gebrannt hatte, dauerte der Kollaps nur einen Sekundenbruchteil. Der Rückstoß dieser Explosion war so gewaltig, dass er das Universum erhellte – eine Supernova. Alles Leben, das vielleicht im Planetensystem des Sterns existierte, wurde ausgelöscht. Doch aus der Katastrophe erwuchs der Keim von etwas Neuem. Noch schwerere chemische Elemente, geschmiedet im Todeskampf des Sterns – Silizium, Nickel, Schwefel und Eisen –, wurden von der Explosion weit hinaus ins All geschleudert und verstreut.
Jahrmillionen später fegte die Schockwelle der Supernova durch eine Wolke aus Gas, Staub und Eis. Diese Wolke wurde von der Gravitationswelle so stark gedehnt und gepresst, dass sie in sich zusammenfiel. Während sie dichter und dichter wurde, begann sie zu rotieren. Die Schwerkraft presste das Gas im Inneren der Wolke derart fest zusammen, dass die Atome anfingen, miteinander zu verschmelzen. Wasserstoffatome wurden komprimiert und formten Helium, das Licht und Wärme hervorbrachte. Der Lebenskreis des Sternenlebens hatte sich geschlossen. Aus dem Tod eines alten Sterns war ein anderer geboren worden, jung und neu – unsere Sonne.
*
Die Wolke aus Gas, Staub und Eis reicherte sich nun mit den schwereren Elementen an, die in der Supernova entstanden waren. Zudem geronnen Teile der Wolke zu einem System verschiedener Planeten, die nun um diese neue Sonne kreisten. Einer davon war unsere Erde. Diese neugeborene Erde hatte wenig gemein mit dem Planeten, den wir heute kennen. Die Atmosphäre war ein tödlicher Nebel aus Methan, Kohlendioxid, Wasserdampf und Wasserstoff, in dem wir nicht hätten atmen können. Die Oberfläche war ein Meer glutflüssiger Lava, aufgepeitscht durch die unablässigen Einschläge von Asteroiden, Kometen und sogar anderen Planeten. Einer von ihnen war Theia, ein Planet etwa so groß wie der heutige Mars.[1] Theia streifte die Erde und brach auseinander. Ein Großteil der Erdoberfläche wurde durch die Kollision hinaus ins All gesprengt. Einige Millionen Jahre lang hatte unser Planet Ringe wie der Saturn. Schließlich jedoch verschmolzen diese Ringe und formten eine weitere neue Welt – den Mond.[2] All dies geschah vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren.
Jahrmillionen vergingen. Irgendwann war es so weit, die Erde hatte sich stark genug abgekühlt, dass der Wasserdampf in der Atmosphäre kondensierte und als Regen zu Boden fiel. Es regnete etliche Millionen Jahre lang, so lange, bis die ersten Ozeane entstanden waren. Und dann war alles Meer – es gab kein Land. Die Erde, einst ein Feuerball, war zu einer Wasserwelt geworden. Nicht dass es nun weniger turbulent zuging. Zu dieser Zeit drehte sich die Welt schneller um die eigene Achse als heute. Der neue Mond hing dicht und drohend über dem schwarzen Horizont. Jede auflaufende Flut war ein Tsunami.
*
Ein Planet ist mehr als ein Haufen Steine. In jedem Planeten mit einem Durchmesser von mehr als einigen 100 Kilometern bilden sich mit der Zeit verschiedene Schichten heraus. Weniger dichte Stoffe wie Aluminium, Silizium und Sauerstoff gehen eine Mischung ein und ergeben eine leichtere Gesteinsschicht nahe der Oberfläche. Dichtere Stoffe wie Nickel und Eisen sinken nach unten bis zum Kern. Heute ist der Erdkern eine rotierende Kugel aus flüssigem Metall. Die eigene Gravitationskraft und der Zerfall schwerer radioaktiver Elemente wie Uran entstanden in den letzten Zuckungen der alten Supernova, halten ihn beständig heiß. Die Drehung der Erde lässt in ihrem Kern ein Magnetfeld entstehen. Dessen Feldlinien dringen mitten durch die Erde und reichen bis weit ins All hinaus. Dieses Magnetfeld schützt die Erde vor dem sogenannten Sonnenwind, einem konstanten Strom winziger energiegeladener Partikel, den die Sonne abstrahlt. Diese Teilchen prallen entweder vom Erdmagnetfeld ab oder werden um die Erde herum ins All geleitet.
Die Erdwärme, die vom flüssigen Kern nach außen abstrahlt, hält den Planeten immerfort am Köcheln, wie einen Topf mit siedendem Wasser auf dem Herd. Die emporsteigende Wärme weicht die oberen Schichten auf, lässt die weniger dichte, aber festere Kruste bersten, treibt die Einzelteile auseinander und lässt dazwischen neue Ozeane entstehen. Diese Teile, die tektonischen Platten, sind immer in Bewegung. Sie stoßen zusammen, gleiten aneinander vorbei oder schieben sich gar untereinander. Diese Bewegung hinterlässt tiefe Gräben im Meeresgrund oder türmt riesige Gebirge auf. Sie verursacht Erdbeben und Vulkanausbrüche. Sie erschafft neues Land.
Während sich kahle Berge in die Höhe schoben, wurden große Teile der Erdkruste zurück in die Tiefe gezogen, verschwanden in Tiefseegräben an den Rändern der tektonischen Platten. Diese Krustenstücke, voll mit Wasser und Sedimenten, wurden tief ins Erdinnere gesogen, gelangten aber in veränderter Form wieder an die Oberfläche. So kann es sein, dass der Schlick vom Meeresboden eines versunkenen Kontinents nach Hunderten von Millionen Jahren durch vulkanische Ausbrüche[3] wieder an die Oberfläche gespien wird – oder sich in Diamanten verwandelt.
*
Inmitten all dieses Chaos, all dieser Katastrophen, entstand Leben. Es waren eben dieses Chaos, das es nährte, die Katastrophen, die es wachsen und gedeihen ließen. Das Leben nahm seinen Anfang in den Tiefen des Meeres, wo die Kanten der tektonischen Platten steil abfielen und wo siedend heiße, mineralreiche Wasserstrahlen unter extremem Druck aus Rissen im Meeresboden strömten.
Die ersten Lebensformen waren kaum mehr als schleimige Membranen über mikroskopisch kleinen Felsspalten. Sie entstanden, als die emporschießenden Ströme aufgewirbelt wurden, sich in verschiedene Strudel aufspalteten, immer schwächer wurden und ihre Fracht aus mineralreichen Schwebstoffen[4] in den Fugen und Poren des Gesteins abluden. Diese Membranen waren löchrig wie ein Sieb, und genau wie ein Sieb ließen sie manche Stoffe durch und andere nicht. Doch obwohl sie durchlässig waren, herrschten im Inneren der Membranen bald andere Verhältnisse als im reißenden Strudel jenseits davon: Innen war es ruhiger, geordneter. Selbst eine einfache Blockhütte mit Dach und Wänden bietet Schutz vor einem Schneesturm, auch wenn die Tür klappert und die Fenster scheppern. Diese Membranen wendeten ihre Durchlässigkeit zum Vorteil, nutzten die Löcher, um durch sie Nährstoffe und Energie aufzunehmen sowie um Abfallprodukte auszuscheiden.[5]
Vor den chemischen Turbulenzen ihrer Außenwelt geschützt, waren diese winzigen Tümpel Oasen der Ordnung. Allmählich verfeinerten sie die Erzeugung von Energie und nutzten sie, um kleine Bläschen von sich abzutrennen, jede in eine eigene Teilschicht der Muttermembran gehüllt. Anfangs geschah dies noch völlig willkürlich, doch wurde es mit der Zeit zunehmend planvoller, und zwar durch die Entwicklung einer inneren chemischen Blaupause, die kopiert und an neue Generationen membranumhüllter Blasen weitergegeben werden konnte. Damit wurde sichergestellt, dass neue Generationen von Blasen mehr oder weniger originalgetreue Kopien ihrer Eltern waren. Die effizienteren Blasen gediehen auf Kosten der weniger geordneten.
Und diese schlichten Blasen standen auf einmal an der Schwelle zum Leben, da sie, wenn auch nur vorübergehend und unter großen Mühen, einen Weg gefunden hatten, dem sonst so unaufhaltsamen Anstieg sogenannter Entropie Einhalt zu gebieten – der Nettozunahme von Unordnung im Universum. Denn genau das ist eine der wesentlichen Fähigkeiten des Lebens. Diese schaumigen Seifenblasenzellen trotzten wie geballte Fäuste ihrem Schicksal, winzige Bollwerke gegen eine leblose Welt.[6]
*
Das wohl Erstaunlichste am Leben auf der Erde – abgesehen von seiner schieren Existenz – ist die Geschwindigkeit, mit der es entstand. Es entwickelte sich gerade einmal 100 Millionen Jahre nach der Bildung des Planeten selbst, in den vulkanischen Tiefen, als die junge Erde aus dem All noch immer von Himmelskörpern bombardiert wurde, die so groß waren, dass sie die gewaltigen charakteristischen Einschlagskrater auf dem Mond hinterließen.[7] Vor 3,7 Milliarden Jahren hatte sich das Leben aus der ewigen Finsternis der Ozeane bereits bis zur sonnenbeschienenen Wasseroberfläche vorgearbeitet.[8] Vor 3,4 Milliarden Jahren hatten Lebewesen begonnen, sich billionenfach zusammenzuschließen und so große Riffe zu bilden, dass sie selbst vom Weltraum aus zu sehen waren.[9] Das Leben hatte endgültig Fuß gefasst.
Diese Riffe bestanden jedoch nicht aus Korallen – die sollten noch drei Milliarden Jahre auf sich warten lassen. Sie bestanden aus grünlichen haarfeinen Fäden und Stummeln aus Schleim, die sich aus mikroskopisch kleinen Organismen zusammensetzten, sogenannten Cyanobakterien – denselben Lebensformen, die noch heute den bläulich grünen Glibber auf unseren Gartenteichen bilden. Sie legten sich in Schichten über Felsen und Ebenen auf dem Meeresboden, um gleich im nächsten Sturm wieder unter Sand begraben zu werden, doch sie arbeiteten sich wieder empor, wurden abermals verschüttet und bildeten so kissenartige Haufen aus geschichtetem Schleim und Sediment. Diese hügelartigen Ansammlungen, die man Stromatolithen nennt, sollten die erfolgreichsten und beständigsten Lebensformen werden, die je auf unserem Planeten lebten – drei Milliarden Jahre waren sie die unangefochtenen Herrscher dieser Welt.[10]
*
Die Welt, in der das Leben seinen Anfang nahm, war warm,[11] aber – von Wind- und Meeresrauschen abgesehen – völlig still. Die vom Wind bewegte Luft enthielt so gut wie keinen Sauerstoff. Ohne eine schützende Ozonschicht in der oberen Atmosphäre tötete die ultraviolette Sonnenstrahlung alles Leben oberhalb – und auch bis sogar einige Zentimeter unterhalb – der Meeresoberfläche gnadenlos ab. Zu ihrer Verteidigung bildeten die Kolonien von Cyanobakterien Pigmente, die imstande waren, diese schädlichen Strahlen zu absorbieren. Sobald sie deren Energie aufgenommen hatten, konnten die Bakterien sie sich zunutze machen. Die Cyanobakterien verwendeten sie, um chemische Reaktionen zu befeuern. Einige von ihnen verschmolzen Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatome miteinander, um daraus Zucker und Stärke zu gewinnen. Diesen Vorgang nennen wir Photosynthese. Aus der Bedrohung war ein Segen geworden.
Bei heutigen Pflanzen nennt man dieses Pigment Chlorophyll. Es nutzt die Sonnenenergie, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, wobei Energie für weitere chemische Reaktionen frei wird. In der Frühzeit der Erde könnten diese Rohstoffe ebenso gut eisen- oder schwefelhaltige Mineralien gewesen sein. Der beste Rohstoff allerdings war der, der im Überfluss vorhanden war – Wasser. Doch die Sache hatte einen Haken. Bei der Photosynthese von Wasser entsteht ein Abfallprodukt: ein farbloses, geruchloses Gas, das alles in Brand setzt, womit es in Berührung kommt. Dieses Gas ist einer der tödlichsten Stoffe des Universums. Sein Name? Freier Sauerstoff oder O2.
Für das erste Leben auf der Erde, das sich in einem Ozean und einer Atmosphäre praktisch ohne freien Sauerstoff entwickelt hatte, war dies eine Katastrophe. Um diesen Vorgang ins Verhältnis zu setzen: Als die Cyanobakterien vor mehr als drei Milliarden Jahren ihre ersten Vorstöße ins Reich der oxygenen – sprich Sauerstoff freisetzenden – Photosynthese unternahmen, gab es in der Atmosphäre nur so wenig freien Sauerstoff, dass man ihn wohl gerade einmal als Spurenstoff bezeichnen könnte. Doch Sauerstoff ist eine so mächtige Substanz, dass selbst eine Spur davon für Lebensformen, die ohne ihn entstanden waren, katastrophale Auswirkungen haben kann. Dieser Hauch von Sauerstoff verursachte das erste von vielen Massensterben in der Erdgeschichte, ein Massensterben, bei dem etliche Generationen von Lebewesen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden.
*
Bald jedoch gelangte noch mehr freier Sauerstoff in die Atmosphäre: während der sogenannten Großen Sauerstoffkatastrophe. So bezeichnet man eine turbulente Periode vor etwa 2,4 bis 2,1 Milliarden Jahren, in der aus noch ungeklärten Gründen die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre zunächst stark anstieg (auf mehr als die heutigen 21 Prozent), sich dann aber wieder auf knapp zwei Prozent einpendelte. Wenngleich der O2-Anteil nach heutigen Maßstäben noch immer winzig war – und zu gering zum Atmen –, waren die Auswirkungen auf das Ökosystem gewaltig.[12]
Durch die Zunahme tektonischer Aktivität wurden riesige Mengen kohlenstoffreichen organischen Materials – die Überreste unzähliger Generationen von Lebewesen – unter dem Meeresgrund begraben, wo der Sauerstoff ihnen nichts anhaben konnte. Dies führte zu einem Überschuss an freiem Sauerstoff, der nun mit allem reagieren konnte, mit dem er in Kontakt kam. Er verätzte blanke Felsen, verwandelte Eisen in Rost und Kohlenstoff in Kalkstein.
Zur gleichen Zeit wurden der Luft Gase wie Methan und Kohlendioxid entzogen und von der Masse neu entstandenen Gesteins absorbiert. Methan und Kohlendioxid bilden die flauschige Daunenfüllung jener schützenden Decke, die den Planeten warm hält. Sie fördern das, was wir den Treibhauseffekt nennen. Ihr Fehlen stürzte die Erde in die erste und größte ihrer vielen Eiszeiten. Gletscher breiteten sich von Pol zu Pol aus und überzogen den gesamten Planeten für 300 Millionen Jahre mit einer Eisschicht.
Es klingt, als wäre alles zu Ende, aber dennoch erwiesen sich die Große Sauerstoffkatastrophe und die anschließende »Schneeball-Erde« als genau die Art von apokalyptischem Desaster, in der das Leben auf der Erde stets gedieh. Viele lebendige Wesen starben, das Leben selbst jedoch vollzog seine nächste große Revolution.
*
In den ersten zwei Milliarden Jahren der Erdgeschichte beruhten die komplexesten Lebensformen auf der Bakterienzelle. Bakterienzellen sind sehr einfach aufgebaut, ganz gleich ob einzeln oder in riesigen verklebten Teppichen auf dem Meeresboden oder, fein wie Engelshaar, in den langen Fäden der Cyanobakterien. Jede für sich genommen ist winzig. Auf den Kopf einer Stecknadel würden mehr Bakterien passen als Hippies einst nach Woodstock pilgerten, und das mit jeder Menge Platz zum Tanzen.[13]
Unter dem Mikroskop wirken Bakterienzellen einfach und strukturlos. Doch ihre Einfachheit ist trügerisch. Was Lebensweise und Lebensräume betrifft, sind Bakterien extrem anpassungsfähig. Sie können so gut wie überall leben. Die Anzahl von Bakterienzellen im (und auf dem) menschlichen Körper übertrifft die Anzahl menschlicher Zellen darin um ein Vielfaches. Ungeachtet der Tatsache, dass manche Bakterien schwere Krankheiten verursachen, könnten wir ohne die Bakterien in unserem Darm, die es uns erst ermöglichen, Nahrung zu verdauen, nicht überleben.
Trotz der enormen Schwankungen in puncto Säuregrad und Temperatur ist das Innere des menschlichen Körpers für Bakterien ein recht lauschiger Ort. Es gibt Bakterien, für die siedende Wasserkessel so angenehm sind wie ein lauer Frühlingstag; andere, die sich in Rohöl pudelwohl fühlen; wieder andere, die in Lösungsmitteln, die beim Menschen Krebs erregen, oder sogar in Atommüll wachsen und gedeihen. Es gibt Bakterien, die im luftleeren Weltraum, unter extremen Temperaturen oder Druck oder in einem Salzkorn eingeschlossen überleben können – und das Millionen Jahre lang.[14]
Bakterienzellen mögen klein sein, aber sie sind geradezu berühmt für ihre Geselligkeit. Verschiedene Arten von Bakterien scharen sich zusammen, um Chemikalien auszutauschen. Die Ausscheidungen der einen Art können einer anderen als Mahlzeit dienen. Die Stromatolithen – die ersten sichtbaren Anzeichen des Lebens auf der Erde – waren Kolonien verschiedener Bakterienspezies. Bakterien sind sogar imstande, Teile ihrer Gene untereinander auszuwechseln. Diesem simplen Tauschgeschäft haben wir es zu verdanken, dass Bakterien heute Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln können. Besitzt ein Bakterium kein Resistenzgen für ein bestimmtes Antibiotikum, bedient es sich einfach am genetischen Wühltisch aller Arten in seiner Umgebung.
Diese Neigung von Bakterien, Lebensgemeinschaften mit anderen Bakterienarten zu bilden, ebnete den Weg zur nächsten großen evolutionären Neuerung. Die Bakterien, so ließe sich fast sagen, hoben das WG-Leben auf ein ganz neues Level – das der kernhaltigen Zelle.
*
Irgendwann vor mehr als zwei Milliarden Jahren gewöhnten sich kleine Bakterienkolonien an, innerhalb einer gemeinsamen Membran zu leben.[15] Alles begann damit, dass eine kleine Bakterienzelle, Archaeon[16] genannt, bemerkte, dass sie für ihre Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen auf einige der Zellen ringsum angewiesen war. Diese winzige Zelle streckte ihre Ranken zu ihren Nachbarzellen aus, um leichter Gene und andere Stoffe austauschen zu können. Die einst so freiheitsliebenden Mitbewohner dieser chaotischen Zellkommune wurden immer abhängiger voneinander.
Jedes Mitglied konzentrierte sich jetzt nur noch auf einen bestimmten Teilbereich des Lebens.
Cyanobakterien spezialisierten sich darauf, die Energie des Sonnenlichts einzufangen, und wurden zu Chloroplasten – den leuchtend grünen Flecken, die man heute in Pflanzenzellen findet. Andere Bakterienarten widmeten sich der Gewinnung von Energie aus Nahrung und wurden zu den winzigen rosa Kraftpaketen, die Mitochondrien genannt werden und in nahezu allen Zellen mit Zellkernen, pflanzlichen wie tierischen, zu finden sind.[17] Doch ganz gleich, worauf sie spezialisiert waren, alle bündelten sie ihre genetischen Ressourcen im zentralen Archaeon. Er wurde zum Kern der Zelle – ihrer Bibliothek, dem Archiv sämtlicher genetischer Informationen, ihrem Gedächtnis, ihrem Erbe.[18]
Diese Arbeitsteilung machte das Leben in der Kolonie um vieles effizienter und geordneter. Was als lose Gemeinschaft begonnen hatte, wurde nun zu einer komplexen Einheit, einer neuen Ordnung des Lebens – der kernhaltigen oder »eukaryotischen« Zelle. Organismen, die aus eukaryotischen Zellen bestehen – ob einzeln (einzellig) oder zu vielen (vielzellig) –, nennt man Eukaryoten.[19]
*
Mit der Evolution des Zellkerns wurde auch die Fortpflanzung um einiges organisierter. Bakterienzellen vermehren sich in der Regel, indem sie sich in der Mitte teilen und auf diese Weise zwei identische Kopien der Mutterzelle erzeugen. Variationen durch das Hinzufügen von zusätzlichem genetischem Material sind bruchstückhaft und zufällig.
Bei Eukaryoten dagegen produziert jeder Elternteil eigens dafür konzipierte Fortpflanzungszellen, die einen hochgradig durchgeplanten Austausch von genetischem Material vollziehen. Dabei werden die Gene beider Elternteile miteinander kombiniert, um den Bauplan eines neuen eigenständigen Individuums zu entwerfen, das sich von beiden Eltern unterscheidet. Diesen eleganten Austausch von Genmaterial nennt man »Sex«.[20] Die Zunahme genetischer Variationen durch Sex hatte wiederum mehr Diversität zur Folge. Das Ergebnis war die Entwicklung einer Fülle verschiedener Arten von Eukaryoten sowie die allmähliche Verschmelzung von Eukaryotenzellen zu mehrzelligen Organismen.[21]
Die Eukaryoten entstanden heimlich, still und leise in einem Zeitraum zwischen 1850 und 850 Millionen Jahren vor unserer Zeit.[22] Vor etwa 1200 Millionen Jahren fingen sie an, verschiedene Arten auszubilden – solche, die bereits als frühe einzellige Verwandte von Algen und Pilzen zu erkennen sind, sowie einzellige Protisten, die man früher Protozoen nannte.[23] Zum ersten Mal wagten sie sich aus dem Meer heraus und besiedelten Süßwasserteiche und Bäche im Landesinneren.[24] An einst unbelebten Küsten bildeten sich Krusten aus Algen, Pilzen und Flechten.[25]
Manche dieser Eukaryoten experimentierten gar mit mehrzelligen Lebensformen, wie im Fall des 1200 Millionen Jahre alten Seetangs Bangiomorpha[26] und des etwa 900 Millionen Jahre alten Pilzes Ourasphaira.[27] Aber es gab noch merkwürdigere Lebensformen. Die frühesten bekannten Hinweise auf vielzelliges Leben sind 2100 Millionen Jahre alt. Einige dieser Lebewesen haben einen Durchmesser von bis zu zwölf Zentimetern, man kann sie also nicht mehr als mikroskopisch klein bezeichnen, muten aber für den heutigen Betrachter derart seltsam an, dass ihre Verwandtschaft mit Algen, Pilzen oder ähnlichen Organismen mehr als zweifelhaft scheint.[28] Möglicherweise handelt es sich um Formen kolonienbildender Bakterien, aber es ist nicht auszuschließen, dass einst ganze Gattungen lebender Organismen existierten – bakterieller, eukaryotischer oder völlig anders gearteter Natur –, die ausstarben, ohne irgendwelche Nachkommen zu hinterlassen, und deshalb für uns schwer als solche zu begreifen sind.
*
Das erste Anzeichen, dass sich etwas Unheilvolles zusammenbraute, war das Auf- und Auseinanderbrechen eines Superkontinents namens Rodinia. Dieser umfasste praktisch die gesamte Landmasse seiner Zeit.[29] Der Zerfall Rodinias hatte eine Reihe von Eiszeiten zur Folge, wie es sie seit der Großen Sauerstoffkatastrophe nicht mehr gegeben hatte. Sie erstreckten sich über 80 Millionen Jahre und hüllten wie bereits zuvor den gesamten Erdball in eine Eisschicht. Doch wieder nahm das Leben die Herausforderung an.
Als es in den Kampf zog, bestand das Leben auf der Erde aus kaum mehr als einem Haufen friedliebender Seegräser, Algen, Pilze und Flechten. Doch es erwies sich als zäh, wendig und ziemlich auf Krawall gebürstet.
Das Leben auf der Erde wurde im Feuer geschmiedet, gehärtet aber wurde es im Eis.