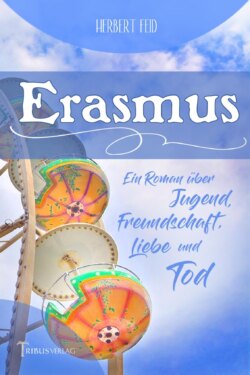Читать книгу Erasmus - Herbert Feid - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
Оглавление26.09.2017
Ihr Handy summt. Die Klingelmelodie ‚Jodler‘ ist schon seit zwei Monaten deaktiviert. Sie passt nicht mehr zu der Situation, in der sie sich befindet. Das Display zeigt 18:57. Frau Baumann nimmt das Handy, ihre Handfläche wird feucht. Ist das der Anruf, den sie seit drei Wochen fürchtet? Ihr Magen zieht sich zusammen, sofort beginnt sie zu zittern. Sie ist allein, denn ihr Mann ist auf einer Konferenz in Wien. Schweiß bedeckt ihre bloßen Arme.
„Baumann“, fast ein Seufzen. Sie setzt sich auf einen Küchenstuhl. Stille wie im sich immer weiter ausdehnenden Weltall, wohin sie aus ihrem Körper geflüchtet ist. Geschäftliches Rascheln in der Leitung stößt sie unsanft ins Hier und Jetzt.
„Guten Abend Frau Baumann. Hier ist das St. Georg Krankenhaus, Schwester Hildegard.“ Eine Stimme, die sie seit Jahren kennt, roboterhaft jedoch voller Teilnahme. Frau Baumann hat nicht den Mut, das Gespräch zu beginnen, besonders in diesem Moment, wo ihr Mann nicht zu Hause ist und sie mit allem allein fertig werden muss. Aber sie war es, die ihn bestärkt hatte, an der Konferenz teilzunehmen, die für ihn als Gastredner wichtig war. Ich komme damit schon zurecht, hatte sie ihn bestärkt.
„Ich verbinde Sie mit Professor Bernhard, einen Augenblick bitte.“ Wieder dieser beruhigende Tonfall, der jedoch nie sein Ziel erreichte. Ohne Übergang meldet sich die heisere, sich stets überschlagende Stimme des Professors.
„Guten Abend Frau Baumann, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, ich störe nicht.“ Die gleiche nichtssagende Begrüßung wie in den letzten Wochen.
Frau Baumann schweigt. Ihr Herz droht sie zu erschlagen. Der Begrüßung kann beides folgen: Keine Änderung oder eine Verschlechterung des Krankheitsbildes, wie es der Professor immer nennt. Eine Besserung war die schwache Hoffnung bei der letzten Einlieferung ins Krankenhaus vor drei Monaten. Seit drei Wochen ist damit nicht mehr zu rechnen, die palliative Behandlung hat begonnen. Die Ärzte können nichts mehr für ihren Sohn tun, ihm nur noch seine Schmerzen lindern.
Der Professor räuspert sich. „Wir haben Ihren Sohn verlegt.“ Schweigen. Schweres Ein- und Ausatmen dringt aus dem Handy. Die Frage, warum verlegt, erübrigt sich, sie weiß Bescheid. Der Professor räuspert sich noch einmal. „In ein größeres Zimmer.“ Frau Baumann klammert sich an das Handy wie eine Ertrinkende an eine Planke. Sie fühlt Brechreiz. „Wir haben dort ein Feldbett aufgestellt, falls Sie oder Ihr Gatte diese Nacht bei Ihrem Sohn bleiben möchten. Es gibt im Zimmer auch einen kleinen Kühlschrank mit Saft und Wasser.“
Nun ist es also soweit. „Ich bin in einer Stunde im Krankenhaus.“ Frau Baumann wundert sich selbst über ihre feste Stimme.
„Danke.“ Der Professor legt auf. Sie tippt hastig die Nummer ihres Mannes ins Handy. Sie hatten abgemacht, sie würde sofort anrufen, wenn sich Erasmus‘ Lage dramatisch verschlechtert und er würde unverzüglich herangehen, wo er auch sei, sogar mitten in seinem Vortrag. Es dauert tatsächlich keine fünf Sekunden. Ein hastiges: „Ist was mit Erasmus?“ Die Stimme, die immer einen vertraulichen metallenen Klang hatte, ist schon lange stumpf geworden.
„Der Professor meint, ich soll heute Nacht bei Eri bleiben. Es ist wohl soweit. Bitte komm schnell zurück.“
„Es gibt einen Flug 21:15 nach Tegel. Ich lande dort um 22:30. Ich komme mit dem Taxi. Abends ist auf den Straßen nicht mehr viel los. Ich denke, ich schaffe es in sechzig Minuten bis ins Krankenhaus. Kopf hoch, ich lasse dich und Erasmus nicht im Stich, das weißt du doch. Wir drei halten zusammen.“ Seine Worte werden immer kraftloser, allein die sich steigernde Lautstärke hält sie noch am Leben. Schließlich noch einmal ein Aufbäumen: „Sei stark, ich bin es auch!“
„Komm schnell, ich brauche dich.“ Das Telefonat ist beendet. Frau Baumann geht ins Schlafzimmer. Dort steht ihre Notfalltasche für drei Nächte im Krankenhaus so wie auch die gleiche Tasche für ihren Mann. Sie wollten sich abwechseln. Ob es noch nötig sein wird?
Beim Verlassen des Schlafzimmers scheut sie den Blick ins Kinderzimmer, das sich in den letzten acht Jahren nicht verändert hat, niemals das aufregende Leben eines Teenagers miterleben durfte. Während der Rehawochen, sogar wenn es ihm gut ging, blieb Erasmus lieber im Haus. Er mochte nicht mit Strickmütze, ohne Augenbrauen und mit einem zum Strich verkommenen Körper unter Leute. Lieber holte er zu Hause seine Gitarre hervor und spielte Schlager nach, die er mit seinem Computer im Krankenhaus heruntergeladen hatte. Er brauchte keine Noten, er hatte die Töne im Kopf. Das hatte er von seiner Mutter geerbt, die bis vor zwei Jahren noch im Radiosymphonieorchester die erste Geige innehatte, ehe ihre Nerven den Stress mit Orchesterproben und dem immer weiter wuchernden Krebs ihres Sohnes nicht mehr ertragen konnten. Sie hatte Erasmus‘ Musikalität immer nach Kräften gefördert, denn musikalisch war er. Jedoch hatte sie nichts gefordert. Auch nicht sein belesener Vater, der Doktor der Philosophie und Literaturprofessor, der ihm hoffnungsvoll den etwas aus der Welt gefallenen Namen Erasmus gegeben hatte. Ihr Sohn sollte selbst entscheiden, was er aus seinen Talenten macht.
Für einen Augenblick denkt sie daran, die Gitarre ihres Sohnes aus dem Schrank im vor sich hindämmernden Kinderzimmer herauszuholen, das Futteral abzustreifen und an den Saiten zu zupfen. Sie öffnet die Tür. Was würde sie dafür geben, wenn ihr Sohn noch einmal die Saiten anschlagen könnte. Sie lässt sie unberührt im Schrank. Traurigkeit umgibt sie. Daneben steht der Geigenkasten. Zum Geige spielen hat Erasmus kein Interesse, das weiß sie. Aber ihr zuliebe hatte er zwei Jahre fleißig geübt. Er war immer ein guter Sohn gewesen.
Das Handy meldet sich wieder. Die Nummer vom St. Georg Krankenhaus erscheint auf dem Display. Frau Baumann erbleicht. Wieder das Zusammenziehen des Magens, das Schwitzen. Sie nimmt den Anruf nicht an, das soll der Anrufbeantworter erledigen. Nach langem Zögern ergreift sie doch mit zitternder Hand das Telefon.
„Baumann.“ Nur noch der Hauch einer Stimme.
„Entschuldigung, ich bin‘s noch einmal, Schwester Hildegard, Onkologie.“ Im Hintergrund Frauenstimmen, die über einen Zeitplan diskutieren. „Professor Bernard äußerte soeben, es wäre besser, wenn Ihr Gatte auch mitkommen könnte. Aber er ist ja zurzeit in Wien, wie sie mir sagten.“ Die Stimme steigt leicht an, vibriert wie bei einer Frage.
„Ja, mein Mann ist im Moment in Wien. Ich habe ihn schon benachrichtigt. Er wird die nächste Maschine nehmen und gegen Mitternacht im Krankenhaus eintreffen.“ Ihre Stimme ist brüchig, aber sie hält durch.
„Im Augenblick ist der Stationsarzt bei Ihrem Sohn. Er schläft, wie Sie ihn heute Mittag verlassen haben. Wenn Sie ihn nachher sehen, bekommen Sie bitte keinen Schreck, sein Gesicht verspannt sich ab und zu. Der Stationsarzt meint, das ist normal in seinem Zustand.“
„Ich komme sofort.“ Das Gespräch ist beendet. Frau Baumann schaut noch einmal durch das Haus, ob alles in Ordnung ist. In die Stille hinein glaubt sie, das helle Lachen ihres Sohnes durch die hohen Zimmer hallen zu hören, als er mit den zum Geburtstag geschenkt bekommenen Rollschuhen an den Füßen durch das Haus tobt. Die teppichbelegte Treppe herunterschliddert. Sie vernimmt ihr Schimpfen, weil er dabei beinahe die wertvolle chinesische Vase im Esszimmer umgeworfen hätte. „Lass‘ ihn doch seine Jugend austoben“, hatte Herbert damals lachend gesagt, als hätte er geahnt, welches grausame Schicksal seinen Sohn kurz danach im Würgegriff halten würde.
Als sie die Haustüre abschließt, fühlt sie, dass es ein Abschied ist. Doch sie will es nicht wahrhaben. Erasmus darf heute nicht sterben, er hat ja noch nichts von seinem Leben gehabt, kaum eine schöne Kindheit, keine Jugend. Hat er jemals die Aufregung, das Kitzeln kennengelernt, mit Freunden eine Nacht durchzumachen, geht es ihr durch den Sinn, wie sie in ihrer Jugend? Hatte er überhaupt Freunde gehabt? Er war noch nie mit Freunden aus, hat niemals über die Stränge geschlagen, als ob das etwas wäre, was Jugend ausmacht. Oder gerade? Was habe ich nicht schon alles mit sechzehn, siebzehn Jahren erlebt, obwohl meine Eltern überaus streng waren und mich am liebsten zu Hause angekettet hätten. Wie oft war ich heimlich ausgebüxt. In einem Monat wird unser Sohn achtzehn. Und das Abenteuer Liebe? Er kennt es nicht!
Sie dachte daran, wie sie mit neunzehn den fünf Jahre älteren Herbert kennengelernt hatte. An ihre Treffen über drei Jahre, die ihr Vater immer wieder zu torpedieren versuchte, weil er an ihr musikalisches Talent glaubte und es nicht von einem sturen Literaturfritzen zugeschüttet wissen wollte. Sie hatte an Herbert festgehalten und schließlich musste ihr Vater nachgeben.
Als sie das Krankenzimmer betritt, bekommt sie einen Schreck, als sie Erasmus‘ verzerrte Gesichtszüge sieht, blutleer. Sein zusammengepresster Körper wie der eines Sterbenden. Sie schiebt vorsichtig einen Stuhl neben sein Bett und setzt sich. Da liegt ihr Sohn, für den sie nichts mehr tun kann. Der thermotherapeutische Wahnsinn hat die gesunden wie die kranken Zellen vernichtet, seine Haut umschließt nur noch Trümmer. Erasmus öffnet die Augen ab und zu für einen kleinen Spalt, scheint seine Mutter jedoch nicht zu erkennen. Der Computer, der immer auf dem schwenkbaren Tisch neben dem Bett stand, seine letzte Verbindung zur Welt draußen, ist seit drei Tagen in eine Ecke weggeräumt, von ihrem Sohn abgekoppelt. Er konnte ihn im Bett liegend bis zuletzt mit zwei Fingern über eine Fernbedienung lenken, die ihm sein Vater besorgt hatte, nachdem sein Sohn sich oft nicht mehr aufrichten konnte. An guten Tagen hatte er sie abends nach ihrem Weggehen zu Hause mit einer Mail überrascht, immer voller Lebensmut. Die für sie weiß bezogene Liege steht für Frau Baumann wie eine Bahre am Fenster. Sie bekommt einen Schreck, als ihr das Weiß der Laken in die Augen sticht.
In die Stille hinein bemerkt sie eine untersetzte Gestalt in einem weißen Kittel hinter Erasmus‘ Bett. Ihr scheint, als ob von dessen Körper ein Leuchten ausgeht.
„Guten Abend Frau Baumann, mein Name ist Hein. Ich arbeite hier als Pfleger. Bitte entschuldigen Sie, aber der Stationsarzt musste zu einem anderen Patienten, deswegen bin ich hier.“ Seine ruhige Stimme, die alles Leid dieser Welt vergessen lässt, umgibt sie, flößt ihr Vertrauen ein. „Ab heute passe ich auf Ihren Erasmus auf. Im Augenblick kämpft sein Inneres gegen die wuchernden Eindringlinge, aber ihr Sohn hat keine Schmerzen mehr. Wir haben ihm heute eine stärkere Dosis Morphium verabreicht als in den letzten Tagen.“
Frau Baumann schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor zehn. Mein Mann sitzt um diese Zeit bestimmt im Flugzeug, tröstet sie sich. Erasmus ist allmählich ruhiger geworden, das Zucken hat nachgelassen. Sie lehnt den Rücken an die Stuhllehne, fühlt Müdigkeit in sich aufsteigen, schließt die Augen und versucht sich zu entspannen.
„Ihr Sohn ist eingeschlafen, er hat sich beruhigt. Ich werde jetzt die Nachtbeleuchtung einschalten. Vielleicht legen Sie sich etwas auf die Liege, das ist bequemer als hier auf dem Stuhl. Es wird für alle eine anstrengende Nacht werden. Ich wecke Sie, falls etwas mit Ihrem Sohn ist oder wenn Ihr Mann kommt. Ich halte bei Erasmus Wache.“ Die Stimme, ähnlich einem gregorianischen Choral, zwingt sie, die Augen zu schließen.
Der Pfleger hüllt das Krankenzimmer in ein beruhigendes bläuliches Licht. Frau Baumann richtet sich mühsam vom Stuhl auf, schaut noch einmal nach ihrem Sohn, der jetzt ruhiger atmet, und drückt ihm die Hand, bevor sie sich auf der Liege ausstreckt. Sie denkt an ihren Mann, wenn er nur schon hier wäre, und an Erasmus, der durchhalten soll. Es dauert nur wenige Minuten, bis ihre Augenlider schwer werden und sie einnickt.