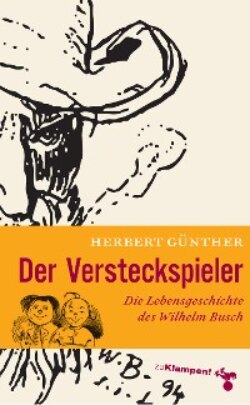Читать книгу Der Versteckspieler - Herbert Günther - Страница 10
Sammelbilder
1841-1851
ОглавлениеWilhelm ist schon seit drei Monaten in Ebergötzen, da schickt er endlich ein Lebenszeichen nach Wiedensahl. In gestochen sauberer Schrift, die Hand vom Onkel geführt, schreibt er kurz nach Weihnachten 1841:
Theure Eltern
Ihr habt gewiß schon lange nach einem Briefe von mir ausgesehen, und ich habe auch im stillen daran gedacht, wie lieb Euch eine kleine Nachricht von mir sein würde. Aber da ich noch nicht ganz ohne Onkels Hülfe an Euch schreiben kann, Onkel aber seit einiger Zeit so viel zu thun hatte, daß ich ihn nicht mit meinen Bitten zur Last fallen wollte, so habe ich meinen Brief bis nach dem Feste verschoben, schreibe nun auch gleich und laße Euch nicht länger auf ein Lebenszeichen von mir lauren …
Die Festtage habe er ziemlich still zugebracht. Er ist der Einzige im Pfarrhaus, der zu Weihnachten Geschenke empfangen hat. Artig bedankt er sich für die neue Hose und das Buch von den Eltern und verspricht, recht viel daraus zu lernen.
Einen Freund habe er auch schon, teilt er mit, den Erich, den Sohn des Müllers Bachmann. Um die Eltern über diese Freundschaft zu beruhigen und positiv zu stimmen, stellen Onkel und Neffe den Freund gleich im Zusammenhang mit dem Lernen vor. Die Nachmittagsstunden haben sie nun gemeinsam, berichtet Wilhelm, wodurch es sich um so beßer lernen lässt, weil der eine es immer beßer machen will, als der andere. Ferien haben wir in dieser Zeit nicht gehabt; bloß den letzten Tag vor den Feiertagen hatten wir keine Stunden. Wir gehen aber auch eben so gern in die Stunden, als daß wir frei haben.
Ernsthaft und lerneifrig gehe es in Ebergötzen zu, davon sollen die Wiedensahler überzeugt werden. Ein anschauliches Beweismittel wird mitgeliefert. Wilhelm schreibt:
Um Euch aber doch einen kleinen Beweis zu geben, daß ich in Ebergötzen nicht so dumm geblieben, als ich hingekommen bin, und daß ich meine Zeit nicht müßig hingebracht habe, schicke ich Euch diejenigen Bücher, die ich bisher vollgeschrieben habe. Aller Anfang ist schwer, das werdet ihr auch in meinen schriftlichen Arbeiten erkennen; aber ich tröste mich mit dem Sprichwort: mit der Zeit bricht man Rosen, und verliere darum die Geduld nicht, wenn’s auch langsam geht …
Onkel und Neffe haben einen Bund geschlossen. Zeigen wir dem Vater mal, wie brav wir sind, wir beide, wie sittsam und ordentlich. Dann wird er beruhigt sein. Und im Übrigen sind wir hier in Ebergötzen für uns.
Pastor Georg Kleine ist ein für die Zeit äußerst toleranter Mann, vielseitig interessiert, gleichwohl ein Landmensch, Naturbeobachter, Verfechter des einfachen Lebens aus Überzeugung. Er ist ein leidenschaftlicher Bienenfreund. Ab 1865 hat Georg Kleine das Bienenwirtschaftliche Centralblatt herausgegeben und sich als Verfechter der damals neuen Fortpflanzungslehre von der Parthenogenese beim Bienenvolk einen Namen gemacht.
Der Privatunterricht beim Onkel, am Nachmittag geteilt mit dem Freund Erich Bachmann, ist abwechslungsreich und interessant. Kein Vergleich zu den zeitüblichen Paukmethoden mit Rohrstockbegleitung in öffentlichen Schulen. Naturbeobachtungen nehmen einen großen Raum ein. Das Leben, wie es ist, steht im Mittelpunkt. Und natürlich kann im Einzelunterricht das individuelle Interesse des Schülers Wilhelm Busch viel mehr Antworten finden als in einer Schulklasse.
Zeichnen gehört zu seinen liebsten Fächern. In Ebergötzen hat er damit ernsthaft und akribisch begonnen. Da ist das Selbstporträt des jungen Zweiflers. Daneben das Bild des Freundes Erich Bachmann — schon ganz künftiger Mühlenbesitzer. Moritz und Max, wie sie in Wirklichkeit waren. Früh schon zeigt sich Wilhelms Talent, mit wenigen Strichen Wesentliches zu erfassen. Der Onkel hat es unterstützt, hat ihn gewähren lassen.
Der Privatunterricht hat auch zur Folge, dass sich sein Abstand zur gewöhnlichen Welt zusehends vergrößert. Die Entdeckung, dass er anderes, dass er mehr kann als die Gleichaltrigen seiner dörflichen Umwelt, wächst sich aus bis zum Hochmut. Den zeigt er selten offen, aber die beständige Unterdrückung des Besserwissens schafft Fremdheit und Irritation. Erich Bachmann, der Freund, hält die Verbindung zum prallen, gradlinigen, oft so erschreckenden Leben.
Der Lehrer der Dorfjugend, weil nicht der mehlige, hatte keine Gewalt über mich — solange er lebte. Aber er hing sich auf, fiel herunter, schnitt sich den Hals ab und wurde auf dem Kirchhofe dicht vor meinem Kammerfenster begraben. Und von nun an zwang er mich allnächtlich, auch in der heißesten Sommerzeit, ganz unter der Decke zu liegen. Bei Tag ein Freigeist, bei Nacht ein Geisterseher.
Die enge Nachbarschaft von Leben und Tod hat ihn auch in Ebergötzen tief beeindruckt. Die findet er im Märchen wieder. Märchenlesen — das nennt er noch vor dem Zeichnen bei der Aufzählung seiner Lieblingsbeschäftigungen in dieser Zeit.
Nur einmal ist der Vater aus Wiedensahl zu Besuch in Ebergötzen. Was er hört und sieht, stellt ihn zufrieden. Man muss ihm ja nicht alles auf die Nase binden. Die freireligiösen Schriften zum Beispiel auf Brümmers Klavier. Die Phantasiestürme um Hannchen Lovis. Seine einsamen Grübeleien über Gott und die Welt. Die Einzelheiten seiner Streifzüge mit Erich Bachmann. Nach solchen Sachen fragt der Vater sowieso nicht.
Friedrich Wilhelm Busch ist mit seinem Schwager zufrieden. Nachdem er das Experiment Wilhelm für gelungen hält, schickt er später auch Sohn Otto zur Erziehung zum Onkel.
Erst nach drei Jahren kommt Wilhelm zum ersten Mal wieder nach Wiedensahl. Für ein paar Wochen zu Hause auf Besuch. Seine Mutter ist gerade auf dem Weg ins Feld, da kommt er an.
Ich kannte sie gleich, erzählt er später über diese Begegnung. Aber sie kannte mich nicht, als ich an ihr erst mal vorbeiging …
Was für eine Verletzung für den Zwölfjährigen. Spontan vergilt er Gleiches mit Gleichem. Er geht an der Mutter vorbei, als kenne auch er sie nicht mehr.
Was bleibt, ist Bitterkeit. Am Ende ist jeder ganz allein auf der Welt, heißt die Logik. Am Ende ist von keinem etwas zu erwarten.
Fünf Jahre dauert die zweite, die bessere Kindheit in Ebergötzen. Dann steht ein neuer Abschied bevor. Familie Kleine bezieht im Herbst 1846 das geräumige Pfarrhaus in Lüthorst am Solling und mit ihr Wilhelm. Georg Kleine übernimmt die besser bezahlte Pfarrstelle von seinem Schwiegervater. Es ist das dritte niedersächsische Bauerndorf, in dem Wilhelm nun lebt.
Lüthorst in dieser Zeit ist ein armes Dorf in einem armen Landstrich, von dem viele sich abgewandt haben, um in der Neuen Welt über dem großen Teich ihr Glück zu versuchen. In Lüthorst gibt es eine größere jüdische Gemeinde, eine geduldete Minderheit in protestantisch geprägter Umgebung.
Pastor Georg Kleine 1X69. Ölbild von Wilhelm Busch
Die Juden gehören zu den Ärmsten im Dorf. Später wird Wilhelm sie malen, den Rabbi von Lüthorst, viele jüdische Kinder. Die Ölbilder der etwa zehnjährigen Line Weißenborn werden zu den beeindruckendsten Porträts zählen, die ihm gelingen.
Einen Freund wie Erich Bachmann hat er in Lüthorst nicht. Dafür stürzt er sich umso mehr aufs Zeichnen, Naturbeobachten, Märchenlesen und auf die einsame Grübelei. Und die Unterrichtsstunden beim Onkel erweitern und intensivieren sich nun.
In den Stundenplan schlich sich nun auch Metrik ein. Dichter, heimische und fremde, wurden gelesen. Zugleich fiel mir die Kritik der reinen Vernunft in die Hände, die, wenn auch damals nur spärlich durchschaut, doch eine Neigung erweckte, in den Laubengängen des intimeren Gehirns zu lustwandeln, wo’s bekanntlich schön schattig ist, oder in der Gehirnkammer Mäuse zu fangen, wo es nur gar zuviel Schlupflöcher gibt.
Wohin mit der Grübelei? Auch dem Onkel wird er nicht alles mitteilen können, was da in seiner Gehirnkammer herumspukt. Es fehlt an Begriffen dafür. Auch soll der Onkel nicht denken, dass er anmaßend wäre. Natürlich hat er Kants Kritik der reinen Vernunft noch längst nicht begriffen. Aber da ist etwas, das ihn nicht loslässt. Er will sich nicht zufrieden geben mit der Oberfläche der Dinge, er will ihnen auf den Grund gehen. Und wenn er diese Art von Lebendigkeit nicht nach außen richten kann, weil er nirgendwo ein angemessenes Echo dafür findet, muss er sie nach innen wenden, muss ganz allein damit fertig werden, egal was alle Welt dazu sagen wird. Mehr und mehr werden die Laubengänge seines intimeren Gehirns zu Geheimkammern, in denen er sein Bild von der Welt und den Menschen aufbewahrt, an das niemand rühren soll.
So kann er sich insgeheim auch über die Ehrfurcht fordernde Erwachsenenwelt erheben, kann ihre Schwächen durchschauen. Zwangsläufig wird ihm dadurch die Welt zur Groteske. Immer deutlicher sieht er zuerst die komische Seite des scheinbar so ernsthaften Erwachsenenalltags. Die Geburtswehen des Humoristen entstehen aus der Beobachtung der Widersprüche der Welt.
In seiner Autobiographie beschreibt er später eine Beobachtung aus Lüthorst wie eine Theaterszene. Ähnlich wird er sie in seinen Bildergeschichten oft darstellen:
Unter meinem Fenster murmelte der Bach. Gegenüber am Ufer stand ein Haus, eine Schaubühne ehelichen Zwistes; der sogenannte Hausherr spielt die Rolle des besiegten Tyrannen. Ein hübsches natürliches Stück; zwar das Laster unterliegt, aber die Tugend triumphiert nicht. Das Stück fing an hinter der Szene, spielte weiter auf dem Flur und schloss im Freien. Sie stand oben vor der Tür und schwang triumphierend den Reiserbesen, er stand unten im Bach und streckte die Zunge heraus; so hatte er auch seinen Triumph.
Ostern 1847 wird der fünfzehnjährige Wilhelm Busch in der Dorfkirche in Lüthorst von seinem Onkel konfirmiert. »Es verwunderte und ergötzte ihn noch der Gedanke daran, dass er und seine dörflichen Mitkonfirmanden in schwarzen Schoßröcken und Zylindern zu dieser Feier erscheinen mussten«, weiß sein Neffe später zu berichten.
Konfirmation bedeutet damals auch den offiziellen und endgültigen Schlusspunkt unter die Kindheit. Der »Ernst des Lebens« begann. Der Eintritt in die Arbeitswelt stand bevor.
Nach dem Wunsch des Vaters soll Wilhelm Maschinenbauer werden. Um dieses handfeste und zukunftssichere Ziel zu erreichen, muss er die Polytechnische Schule in Hannover besuchen. Der Privatunterricht von Onkel Kleine hat ihn auf diese Art von Karriere denn doch nicht sonderlich gut vorbereitet. Er kann anderes, ihn interessiert anderes. Dennoch fügt er sich.
Sechzehn Jahre alt, ausgerüstet mit einem Sonett und einer ungefähren Kenntnis der vier Grundrechnungsarten, erhielt ich Einlaß zur Polytechnischen Schule in Hannover.
Für einen Besuch in Wiedensahl bleibt keine Zeit. Dort ist man beschäftigt mit dem Bau des neuen Hauses. So geschieht sein »Eintritt ins Leben« ohne die Nähe der Eltern. Zu Fuß und mit dem Omnibus reist er von Lüthorst über Einbeck und Alfeld nach Hannover, fast eine Tagesreise damals.
In Hannover wohnt er im Haus des Rechtsanwalts und Notars Christian Hermann Ebhardt, der mit einer Kusine seiner Mutter verheiratet ist. Unter verwandtschaftlicher Obhut wird er dazu angehalten, neben der gewissenhaften Erfüllung seiner mathematisch-technischen Schulpflichten auch Sprachstudien in Englisch und Französisch zu treiben, die der Onkel ihm nicht vermitteln konnte. Auch Schwimmunterricht nimmt er in Hannover.
Aber schwimmen kann er noch lange nicht. Wie tapsig und ungeschickt der Junge vom Dorf seine ersten Schritte in der Stadt setzt, beschreibt er selbst in seiner Erinnerung, wobei die Ironie des Alters die Peinlichkeit der Situation längst überdeckt:
Hier ging mit meinem Äußeren eine stolze Veränderung vor. Ich kriegte die erste Uhr — alt, nach dem Kartoffelsystem — und den ersten Paletot (frz. Überzieher, Herrenmantel) — neu, so schön ihn der Dorfschneider zu bauen vermochte. Mit diesem Paletot, um ihn recht sehen zu lassen, stellte ich mich gleich den ersten Morgen sehr dicht vor den Schulofen. Eine brenzlige Wolke und die freudige Teilnahme der Mitschüler ließen mich ahnen, was hinten vor sich ging. Der umfangreiche Schaden wurde kuriert nach der Schnirrmethode, beschämend zu sehn; und nur noch bei äußerster Witterungsnot ließ sich das einst so prächtige Kleidungsstück auf offener Straße blicken.
Mit Fleiß und Eifer versucht er, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, gegen sich selbst anzuarbeiten, sich vom Makel der Provinzialität zu lösen. Seine Mutter versucht er vom verbissenen Ernst seiner Bemühungen zu überzeugen:
… indeß, ich weiß selbst am besten, wie es mit mir steht. Es ist für mich nicht allein nötig, daß ich den Vortrag verstanden habe, sondern mein künftiger Lebenszweck erheischt mehr als das; ich muß Um auch durchweg u. zu jeder Zeit im Gedächtnis bereit haben.
Aber im selben Brief, fast zum Schluss, stehen plötzlich zwei Sätze, die aufhorchen lassen. Über den drei Jahre jüngeren Justus Ebhardt, Sohn des Justizrats, in dessen Haus er wohnt, schreibt er: Justus hat seine Karriere, in die er ursprünglich einzutreten gedachte, geändert. Er will jetzt Seemann werden.
Einer ist ausgebrochen aus Norm und Konvention, ist abgewichen vom vorbestimmten Lebensweg. Wilhelm erwähnt es gegenüber den Eltern. Kein Wort der Kritik an Justus, in das der Vater sogleich einfallen könnte. Dafür so altklug und falsch klingende Sätze über das, was sein eigener »künftiger Lebenszweck erheischt«. Das passt nicht zusammen. Auch für Wilhelm ist der Gedanke an ein nicht angepasstes Leben längst eine Verlockung. Aber noch hält er ihn nieder.
Wilhelms erzwungener Eifer ist nicht ohne Erfolg. In der reinen Mathematik schwang ich mich bis zu Eins mit Auszeichnung empor, aber in der angewandten bewegt’ ich mich mit immer matterem Flügelschlage. Wichtig ist ihm der Zeichenunterricht. »Erste Klasse«, benotet Zeichenlehrer Heinrich Schulz seine Leistung auf diesem Gebiet. Aber auch in den Fächern, die mit Zeichnen nichts zu tun haben, zeichnet er. Seine Kolleghefte sind voll mit skizzenhaften Darstellungen seiner Lehrer und Mitschüler. Sowohl Zeichnungen nach der Natur als auch Karikaturen. Dann kommt das Jahr 1848. Der Versuch einer bürgerlichen Revolution in Deutschland. In den Staaten des Deutschen Bundes kommt es zu Unruhen. Die Forderungen nach Freiheiten, ähnlich denen der Französischen Revolution, und nach nationaler Einheit werden überall lauter und dringlicher. Im März kommt es in Berlin zu blutigen Barrikadenkämpfen. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. verspricht, sich an die Spitze des »Gesamtvaterlandes« zu stellen, und lässt doch auf die Aufständischen schießen. Im Mai tritt das erste rechtskräftig gewählte deutsche Nationalparlament in der Frankfurter Paulskirche zusammen.
In dieser politisch bewegten Zeit wird der gerade vom Dorf in die Stadt gewechselte 16-jährige Wilhelm Busch wie alle Schüler der Polytechnischen Schule zur Verstärkung von Militär und Polizei als Hüter von Recht und Ordnung eingesetzt.
Aus langem zeitlichem Abstand, im Jahr 1906, schreibt er über seine Erfahrungen mit der Revolution:
Das Jahr 48 machte bedenklichen Lärm. Um den Wall die Ketten verschwanden. Ans uns Polytechnikern wurden Kompanien gebildet unter Führung der Lehrer. Den Stock in der Hand, eine weiße Binde um den Arm, zogen wir durch die Straßen und riefen den Frauen »Guten Abend, Bürgerim zu. Nur waren wir als Schergen der Ordnung beim »Volke« recht unbeliebt. Aus den Haustüren im Rösehof gossen unsichtbare Hände uns Schmutzwasser an die Beine. Bald kriegten wir Waffen; alte Steinschloßflinten, die Ohrfeigen austeilten und Gesichter schwärzten, wenn wir draußen an der Schwedenschanze exerzierten.
Wilhelm Busch 1848
Unsere Uniform war bloß kurz angedeutet durch eine Mütze mit schwarzrotgoldenem Streif drum herum. Das dreikantige Bajonett, im Bandelier zu tragen, diente als furchtbares Seitengewehr. Meine Kompanie hatte die Ehre, als erste die Hauptwache am Markt abzulösen. Freundlich grinsend standen uns die Soldaten gegenüber. Sie hinterließen uns munter belebte Matratzen zur behaglichen Ruhestatt.
Daß man uns keine scharfen Patronen anvertraute, war ärgerlich. Einstmals, während der Nacht, hatten wir an der Ecke der Ballhof- und der Knochenhauerstraße eine leichte Barrikade zu nehmen. Oben aus der Herberge flogen Backsteine herunter, unten bewarf uns von weitem die verwegene Menge. Vergebens verfolgten wir sie. Schießen konnten wir nicht. Da sprang ein langer Kollege, der die Geduld verlor, voran und prickte einem Kerl das Bajonett durch die Hose, daß er bölkte wie ein Ochse. Im Lindener Spital hat man ihn wieder kuriert. Und dies, soviel mir bekannt, ist unsererseits die einzige grausige Bluttat während der ganzen Revolution.
Übrigens gab es unruhige Geister auch in unserer eigenen Mitte. Sie brachten dem Direktor Karmarsch, ich weiß nicht warum, eine Katzenmusik. Für die Radaumacher schloß man die Schule. Für uns anderen, die brav gewesen, ging der Unterricht weiter.
Was für andere am Anfang mit großen Hoffnungen und am Ende mit bitterer Enttäuschung verbunden ist, beschreibt Wilhelm Busch als Groteske. Mag sein, dass ihm im Augenblick des Erlebens anders zumute war als im Rückblick nach so vielen Jahren. Davon aber verrät er nichts.
Im Grunde ist er unpolitisch. Die Zusammenhänge im Großen durchschaut er nicht. Die Revolution ist ihm eine Posse aus Krähwinkel. Ein Engagement, für welche Seite auch immer, ist ihm zuwider. Der Hang zur Grübelei in die Tiefe verbietet ihm, sich anderen Menschen anzuvertrauen. Wieder sieht er auch hier zuerst das Bizarre, Komische, Lachhafte. Salopp bezeichnet er das Rauchen und Biertrinken als zwei Märzerrungenschaften.
Sosehr sich eine solche Haltung im Augenblick auch absondert von den Strömungen der Zeit, sosehr wird gerade sie am Ende Gefallen finden bei vielen. Sie wird zur Zuflucht und zum Trost für alle vom Leben Gebeutelten, und wer wollte sich nicht dazuzählen? Später wird diese Haltung zur Grundstimme seiner Bildergeschichten und ist eine Erklärung für ihren großen Erfolg. Seht her, wird man sagen können, wir haben es doch schon immer gewusst, so ist das Leben, hier ist es wahrhaftig aufgezeichnet und treffend beschrieben. Und das Beste, was uns bleibt, ist, wenigstens einmal kräftig darüber zu lachen.
Dass solche Geschichten nur entstehen konnten, weil dem Erfinder vorher so viel von der menschlichen Wärme versagt geblieben ist, auf die er gehofft hat, dass sie entstehen konnten, weil seine nach innen gerichtete Lebendigkeit durch das Nadelöhr der äußeren Absonderung gegangen ist, das wird am Ende kaum jemand wahrnehmen wollen. Im Kern entspringt der Busch’sche Witz dem Alleingelassenwerden und dem Unvermögen, sich zu entscheiden. Weil es vielen so ging und geht, war und ist er so erfolgreich.
Vorerst aber müht sich Wilhelm Busch mit wachsendem Unmut, sich scheinbar dem anzupassen, was man von ihm erwartet. Auch verschwendet er noch längst keinen Gedanken an Bildergeschichten. Er hat ein ganz anderes geheimes Ziel, das er beharrlich verfolgt.
Mit ihm »brav«, aber unzufrieden mit der Maschinenbauerzukunft sind Carl Bornemann aus Alfeld und August Klemme aus Hannover. Alle drei haben sie Bilder im Kopf, die in die technischen Planquadrate nicht passen, die keine Maschinen ergeben. Sie freunden sich an.
Wilhelm hat sich merklich verändert. Aus dem ängstlich-braven Kind aus Wiedensahl ist nun einer geworden, der sich schon mal wagt, im dunklen Wald auch laut zu singen. Nicht nur das Rauchen und das Biertrinken hat er gelernt. Wenn er sich unbeobachtet fühlt und niemand ihn kennt, probiert er jetzt auch schon mal das öffentliche Lautsein. Im Herbst 1850 hat ihn jemand in der westfälischen Kleinstadt Bünde beobachtet:
»Zufälligerweise kam an diesem Tage ein junger Bursch aus Wiedensahl an, der Polytechniker in Hannover ist. Das war ein seltsamer Passagier. Seine Physiognomie war ganz eigentümlich. Er schien sich fortwährend über die ganze Welt lustig zu machen, und seine Fratzen haben uns oft köstlich amüsiert. Dabei war er ein höchst gescheiter, geistreicher Kopf, in allen Fächern zu Hause und jeden Augenblick mit den schlagendsten Einfällen bei der Hand. Ein Komiker war an ihm verdorben, denn er verstand alles ins Lächerliche zu ziehen …«
Ein Studienkamerad begleitet ihn. Von Bünde aus wandern sie nach Ebergötzen. Da will Wilhelm beim Schützenfest dabei sein. Er ist jetzt so alt wie Hannchen Lovis damals. Voriges Jahr hat er ihr ein Albumblatt zukommen lassen mit einem Spruch von Jean Paul:
… Nicht das bunte Ufer fliehet vorüber, sondern der Mensch und sein Strom; ewig blühen die Jahreszeiten des Lebens am Gestade hinauf und hinab, nur der Mensch fliehet einmal vorüber und kehret nicht wiederum.
In diesem Jahr, Wilhelm erfährt es in Ebergötzen, wird Hannchen den Herrn Adalbert Isermann heiraten.
Enttäuschung und Rückzug nach innen.
Hannchen war viel älter als er. Schon die Kinderfreundschaft zu Christine in Wiedensahl war für den Kaufmannssohn aus Gründen des sozialen Unterschieds fern jeder Verwirklichung. So etwas läuft immer nur in seinem Kopf ab, es bleibt bei schönen Träumereien.
In seiner Beziehung zu Mädchen und Frauen zeigt sich schon hier ein seltsames Muster, dem er bis auf eine einzige Ausnahme sein Leben lang verhaftet bleibt: Der junge Wilhelm Busch sucht die Beziehung zu älteren Frauen oder solchen, die schon in festen Beziehungen leben, der alte Wilhelm Busch wird sich besonders zu den jungen, lebensfreudigen Mädchen hingezogen fühlen. Immer bleiben Berührung und Nähe hinter einer unüberwindlichen Mauer im Reich des Wünschens und Wollens.
Dieser Stau der Gefühle lässt ihn im wirklichen Leben oft täppisch und unangemessen erscheinen. In seinen Bildergeschichten dagegen beflügelt er die Phantasie. Der Augenblick der schönen Illusion, das Gefühl, über den Dingen zu stehen: Man kann ihm umso mehr nachgeben, je ungebundener man ist. Er wird nie heiraten, er wird sich nie einer Idee verschreiben.
Im wirklichen Leben aber muss auch Wilhelm Busch seine Enttäuschung verwinden. Er wandert. Zu Fuß legt er Entfernungen zurück, die sich heute kaum jemand zumuten würde. Zusammen mit dem Studienfreund und mit Erich Bachmann geht es von Ebergötzen aus durch den Harz. Von dort nach Hannover. Und von Hannover mit Erich nach Wiedensahl.
Zum ersten Mal bringt Wilhelm jemanden mit in sein Elternhaus. Seinen ersten und gleichzeitig besten Freund. Das macht ihn stärker, nicht zuletzt gegen den Vater.
Kaum wieder in Hannover, wagt er den ersten Schritt seiner Privatrevolte. Er verlässt das Haus der Aufsicht führenden Verwandten und zieht in die Studentenbude zu seinem Studienfreund Carl Bornemann. Denn wer sich im Rauchen und Biertrinken übt, will einen eigenen Hausschlüssel haben.
Die Studentenromantik in Hannover währt nicht lange. Große Veränderungen sind in die Wege geleitet. In Wiedensahl hat er kein Wort gesagt.
August Klemme ist im Herbst 1850 in die »Stadt des Malkastens«, nach Düsseldorf gegangen, um an der dortigen Kunstakademie das Malen zu studieren. Carl Bornemann und Wilhelm Busch warten gespannt auf Nachricht von ihm.
Öfter als in Wiedensahl ist Wilhelm von Hannover aus in Lüthorst. Mit dem Onkel kann er reden. Mag sein, dass dieser ihn in seinem Eigenwillen bestärkt hat.
Am 9. März 1851 geschieht dann der große Ausbruch: Gegen den Willen seines Vaters verlässt Wilhelm Busch zusammen mit Carl Bornemann ohne Abschluss die Polytechnische Schule in Hannover, »um in Düsseldorf Maler zu werden«.
Adriaen Brouwer (1606-1618). Karten spielende Bauern in einer Schenke
In dieser kunstberühmten Stadt sah ich zum ersten Male die Werke alter Meister: Rubens, Brouwer; Teniers, Frans Hals. Ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, verbunden mit stofflich juwelenhaftem Reiz; diese Unbefangenheit eines guten Gewissens, welche nichts zu vertuschen braucht; diese Farbenmusik, worin man alle Stimmen klar durchhört, vom Grundbaß herauf haben für immer meine Liebe und Bewunderung gewonnen; und gern verzeih’ ich’s ihnen, daß sie mich zu sehr geduckt haben, als daß ich’s je recht gewagt hätte, mein Brot mit Malen zu verdienen wie manch anderer auch. Die Versuche freilich sind nicht ausgeblieben; denn geschafft muß werden, und selbst der Taschendieb geht täglich auf Arbeit aus …
Wilhelm Busch, Von mir über mich