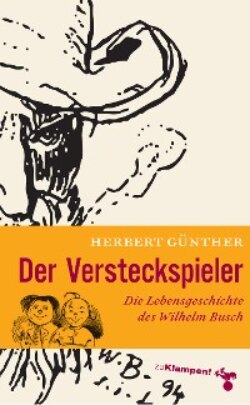Читать книгу Der Versteckspieler - Herbert Günther - Страница 9
II
Moritz trifft Max
ОглавлениеEr ist ganz anders als Harmschlüters Hinnerk. Anders auch als Krischan oder Johann oder Kord. Aber eins hat er mit ihnen gemeinsam: den festen, bedenkenlosen Blick, der aufs Erleben aus ist, aufs Ausprobieren und Machen, koste es, was es wolle.
Wie bestellt, schon am ersten Tag nach Wilhelms Ankunft in Ebergötzen, steht Erich Bachmann im Pfarrgarten; der Onkel lächelt und entlässt sie beide zu einem Streifzug durchs Dorf.
»Wo kommst du denn her?«, fragt Erich.
»Aus Wiedensahl«, antwortet Wilhelm.
»Nie gehört.«
»Ist auch weit weg. Drei Tage mit der Kutsche.«
Erich pfeift anerkennend durch die Zähne.
»Und jetzt wohnst du bei Pastors?«
»Ja.«
Auch das ist offenbar ein Pluspunkt. Erich nickt, und Wilhelm, der schon dabei war, sich alle Vorzüge seines Heimatortes in Erinnerung zu rufen, um bei einem zu erwartenden Dorfvergleich nicht schlechter abschneiden zu müssen, wundert sich, dass Erich nichts weiter wissen will.
Das Dorf hat Ecken und Winkel, es geht bergauf und bergab und Wilhelm, der Flachländer, hat schon bald die Orientierung verloren. Aber Erich schleust ihn, seines Weges offenbar ganz sicher, über Gartenzäune und Mauern, über Höfe und offen stehende Scheunen, an bellenden Hunden und zischenden Gänsen vorbei, über den Bach; und auf einmal stehen sie vor einem großen, hölzernen Mühlrad, das sich, vom vorbeifließenden Wasser getrieben, knarrend und gleichmäßig dreht.
»Da wohn ich«, sagt Erich.
Jetzt ist auch Wilhelm voller Bewunderung.
Lange rührt er sich nicht vom Fleck und bestaunt wortlos das riesige Mühlrad; beobachtet, wie die Schaufeln eintauchen, wie das Wasser im Mühlgraben abläuft.
»Bei uns haben wir nur Windmühlen«, sagt er schließlich und hat schon vergessen, dass er sich damit bei seinem Begleiter in Nachteil bringen könnte. Ohne weiter zu fragen, zieht Erich ihn mit sich, um das Haus herum, über den Hof, zur Haustür rein und zeigt ihm das Innere der Mühle.
In einen Trichter, der aussieht wie ein gefräßiges, weit geöffnetes Maul, werden Getreidesäcke entleert, hölzerne Zahnräder greifen eins ins andere; es staubt und rattert und ruckelt. Ein Müllergeselle verscheucht sie mit Handzeichen aus der Nähe des Laufwerks. Man könnte sein eigenes Wort nicht verstehen.
Ein anderer Geselle schleppt prall gefüllte Maltersacke treppauf und treppab, auf seinem Gesicht klebt eine Staubschicht, von Schweißrinnen durchbrochen.
Unten treffen sie auf den Müller, Erichs Vater, der mit einem Bauern herumbrüllt, aber, wie sich heraushören lässt, nur über das Wetter redet.
Erich schiebt sich vorbei, der Vater sieht sie beide, beachtet sie aber nicht weiter. Unvorstellbar, denkt Wilhelm, er wäre mit einem fremden Jungen durch den Kaufladen oder auf den Wiedensahler Speicher gegangen.
Auf dem Weg zum Pfarrhaus zurück machen sie einen kleinen Bogen den Hang hinauf. Es ist ein warmer Septembertag, die Kühe, Schafe und Ziegen weiden noch auf den eng abgesteckten Wiesen und Obstgärten dicht hinter den Häusern.
»Mal sehen«, flüstert Erich geheimnisvoll. »Vielleicht haben wir Glück.«
Er schleicht durch Hinterhöfe, unter Zäunen hindurch, vorbei an glotzenden Kuhaugen und Wilhelm folgt ihm ohne Rücksicht auf seine Kleider.
Vor ihnen stehen Obstbäume, knorrig verwachsene Stämme, ein Birnbaum am Rand überragt die anderen, wirft einen dunklen Schatten ins Gras. Dahin zeigt Erich jetzt und drückt den Zeigefinger auf die Lippen.
Auf allen vieren pirschen sie sich an den Birnbaum heran. Erich teilt die langen Grashalme vor ihren
Augen, und ein Hab-ich-nicht-gewusst-Lächeln strahlt über sein Gesicht. Jetzt reckt auch Wilhelm den Hals, und da sieht er den stoppeligen Graubart im Gras liegen, einen langen, verbogenen Spieß im Arm, zerlumpte Kleider, vorn aufgeplatzte Schuhe. Er schnarcht aus zahnlosem Mund. »Krrrch«, macht er, wenn er einatmet, und »Püüüh«, wenn er die Luft mit spitzen Lippen von sich bläst. Das rasselnde »Krrrch« und das pfeifende, melodische »Püüüh« sind wie Bruchsteingeröll und Vogelgesang. Der alte Mann schläft mit tiefem Genuss, sein Brustkorb hebt und senkt sich unter dem zerschlissenen Hemd.
Erich stößt Wilhelm an, grinst, pult einen kleinen krumm gewachsenen Zweig aus dem Gras und fährt dem Alten damit leicht über den grauen Stoppelbart. Erst tut sich nichts, aber dann macht der Mann seltsam schnappende Bewegungen mit dem Kinn, dann lässt er es vorgestreckt und mahlt die Kiefer aufeinander, als würde er genussvoll dem Sonntagsbraten nachschmecken.
Siegessicher und zufrieden erhebt Erich sich und lacht dem längst sprungbereiten Wilhelm ins zweifelnde Gesicht. Lachend umkurvt Erich die Obstbäume und trabt den Häusern entgegen. Wilhelm läuft hinter ihm her.
»Der alte Tanne«, sagt Erich atemlos. »Alle im Dorf nennen ihn »Bettelvogt«. Bisschen plemplem, wenn du weißt, was ich meine. Aber harmlos. Isst mal hier und mal da. Schläft auf Heuböden und in Pferdeställen. Im Sommer im Gras.«
Erich genießt seinen Triumph. Er boxt Wilhelm in die Seite, und als sie vor dem Pfarrhaus stehen, macht Erich: »Krrrch!« Ohne zu zögern, antwortet Wilhelm: »Püüüh!« Sie hauen sich auf die Schultern, dass es brennt; bis morgen also, das ist doch ganz klar. Der Onkel hat nichts dagegen. Selbst der Vater würde nichts einwenden können, denkt Wilhelm. Der Sohn des Müllers. Das war schließlich was anderes als der warzenrunzlige Johann aus dem Armenhaus.
Im Sommer dann sind sie längst Freunde und nicht nur der alte Tanne hat das zu spüren bekommen. Dem Müller sein Erich und Pastors Neffe, die gehören zusammen, denen spitzt der Schalk aus den Augen, die sticht der Hafer, und die Bauern von Ebergötzen wundern sich, dass der Pastor Kleine, der sie doch beide privat unterrichtet, nicht öfter mal eingreift. Aber die richtige Kirchenfrömmigkeit ist des Pastors Sache ja auch nicht, der gibt sich noch mit ganz anderen Sachen ab; die Bienen sind sein Ein und Alles, und mit Halleluja und Gottesfurcht hat er nicht viel am Hut.
»Komm«, sagt Erich an einem heißen Hochsommertag. »Wir gehen baden.«
Draußen vorm Dorf, im Hacketal, da wo die Straße von Waake und Göttingen herkommt, fließt der Bach durch sumpfige Wiesen und ist von Sträuchern und Weiden gesäumt. Sie finden eine flache morastige Stelle am Ufer, werfen ihre Kleider ins Gras und springen ins Wasser. Es reicht ihnen bis zu den Knien. Ein-, zweimal tauchen sie unter, dann bespritzen sie sich gegenseitig mit lautem Gejohl.
Außer Atem staksen sie ans Ufer zurück. Angenehm kühl quillt der Schlamm zwischen den Zehen hindurch. Wilhelm bleibt stehen und sieht an sich hinunter. Bis über die Fußknöchel steckt er im Schlamm.
»Man müsste sich mal ganz einbacken«, sagt Wilhelm. »Von oben bis unten. Wie man dann aussieht?«
Erich ist sofort Feuer und Flamme. Sie legen sich nebeneinander und räkeln sich im Morast. Dann stehen sie auf und betrachten die Abdrücke ihrer Körper im Schlamm. Eben noch waren sie da selber, jetzt sind da Figuren, denen man Namen geben sollte.
»Peter und Paul«, sagt Wilhelm.
Erich grinst.
Gegenseitig bekleistern sie sich die Rückenpartien, die Vorderfront besorgt jeder selber. Die Gesichter zuletzt. Dann liegen sie reglos in der Sonne und warten darauf, dass ihre neue Schutzschicht trocken und hart wird.
»So müsste man mal durchs Dorf gehen«, sagt Erich. »Keiner würde uns erkennen.«
»Wir wären Peter und Paul«, nickt Wilhelm.
Wagen würde er es nicht. Manche Sachen durfte man sich eben nur vorstellen. Aber das waren immer die besten.
Mücken schwirren durch die Luft, im schattigen Wald zwitschern die Vögel. Sonst ist alles friedlich und still. Nur einmal meint Wilhelm aus den Augenwinkeln zu sehen, wie hinter den Sträuchern am jenseitigen Ufer des Bachs etwas davonhuscht, und sofort durchfährt ihn ein heißer, freudiger Schreck. Hannchen Lovis, denkt er, das blondlockige Mädchen aus der Papiermühle ein paar hundert Meter den Bach hinauf. Sie haben sie schon ein paar Mal beim Forellenfangen hier in der Gegend getroffen. Hannchen hat gelacht über ihre Einfälle und freundlich mit ihnen geredet, besonders mit Wilhelm, so schien es ihm. Als würden sie sich lange schon kennen. Dabei ist sie viel älter als er, 18 wohl schon, aber das macht ihm nichts aus. Über sich selbst verwundert stellt er fest, dass es ihm nicht unangenehm wäre, hätte Hannchen ihn so gesehen. Aber nie, niemals würde er darüber sprechen. Auch nicht mit Erich. Selbst mit ihm kann er längst nicht über alles reden, was ihm so durch den Kopf geht. Er rührt sich nicht vom Fleck, schielt nur noch einmal zu den Sträuchern hinüber, kann aber nichts weiter entdecken. Dann schließt er die Augen und spinnt sich in Träume ein, von denen Erich nichts ahnt: Eine Feuersbrunst bricht aus, und Wilhelm rettet Hannchen vor dem sicheren Tod. Selbst bezahlt er dafür mit seinem Leben, er liegt vor ihren Füßen, und Hannchen weint und weint und weint … — Nein, das ist ihm für heute zu tragisch. Lieber die andere Art: Im Traum kann er fliegen. Hoch und weit hinaus, von einem Baumwipfel zum anderen, wohin er nur will. Und Hannchen steht da mit offenem Mund und ist starr vor Bewunderung … — Ja, das ist gut für diesen heiteren Tag. Wilhelm liegt in der Sonne, träumt sich weit weg, und als er das Gesicht zum Lächeln verzieht, merkt er, der Lehmpanzer ist hart.
Ein anderes Mal sind sie unterwegs, um die ausgelegten Vogelfallen zu kontrollieren. Erich ist ein Meister im Herstellen von Fallen. Mit großem Geschick hat er das Geflecht von Pferdehaaren an ausreichend starken Ästen befestigt und mit Vogelbeeren beködert. Er hat Sprenkelkästen gebaut mit krumm gespannten Weidenruten als Schließfedern.
Sie haben Erfolg. In einem Drohnengeflecht hat sich eine junge Schwarzdrossel verheddert. Als Erich sie in den selbst gebauten Käfig setzt, pickt sie ihm die Hand blutig und schlägt mit den Flügeln zuckend gegen den Draht.
»Na warte, du Biest!«, schimpft Erich und saugt sich das Blut vom Handrücken. »Das werden wir dir abgewöhnen!«
Nach zwei Tagen sitzt der Vogel mit eingezogenem Kopf reglos in der Ecke des Käfigs und verschmäht alle Körner.
»Na also. Jetzt bist du gezähmt. Ab morgen werden wir dich was lehren. Es soll Drosseln geben, die können richtig reden.«
Wilhelm ist nicht so wohl bei der Sache. Aber vor Erich will er nicht als Muttersöhnchen erscheinen und schlägt vor, dem Vogel die Deklinationen beizubringen, die sie gerade beim Onkel Kleine durchgenommen haben.
»Und wenn du nicht spurst«, droht Erich dem Vogel, »dann kommst du zum Lehrer Wichmann in die Volksschule, da kannst du schön was erleben!«
Aber am nächsten Tag ist der Vogel tot und sie werfen ihn auf den Misthaufen hinter der Mühle.
Manchmal sind sie im Gasthaus zur Post. Im Hinterzimmer steht ein Klavier, und Wilhelm kann mit dem, was er mehr schlecht als recht zusammenklimpert, sogar Bewunderung finden bei den Dienstmägden und auch bei Heinrich Brümmer, dem Wirt, dem die pechschwarzen Haare aus Ärmel und Kragen quellen. Überall hat der Mensch Haare. Mit ledernen Klapppantoffeln und mit beständig wiederholter Klage, er sei zu gut für diese Welt, schlurft Heinrich Brümmer durch die Räume seiner Wirtschaft, angekündigt von kräftigen Schnupftabakexplosionen.
Wenn Wilhelm Klavier spielt, wird es Erich schnell langweilig. Er schleicht davon, inspiziert Gaststube und Kegelbahn, sieht nach den Hunden und Katzen draußen im Hof oder beguckt sich Heinrich Brümmers Trost und Stolz, die Blumenbeete im Garten, und überlegt, wie man die selbst angepriesene Geduld des Gastwirts auf eine Probe stellen könnte.
Währenddessen sitzt Wilhelm im Hinterzimmer und blättert in Büchern und Zeitschriften, die er auf dem Klavier gefunden hat. Viel versteht er nicht von dem, was er da liest, aber den aufbegehrenden Ton der Schriften spürt er sehr wohl heraus. Gott — ist das am Ende nur eine Erfindung der Menschen? Was gibt es denn, wenn es Gott nicht gibt?
In solche Gedanken verstrickt, zieht er die Haustür hinter sich zu und steigt die Stufen der Steintreppe hinab.
Auf dem Hof steht Brümmer mit Erich und vor ihnen der junge Jagdhund Hasso, den der Wirt vor vierzehn Tagen vom Förster Bornebusch in Hattorf gekauft hat.
»Platz! Mach Platz!«, brüllt der Gastwirt schon sichtlich erregt. Der Hund glotzt zu ihm hinauf und rührt sich nicht.
»Er versteht eben nur Platt!«, lacht Erich voll Schadenfreude.
Das bringt den schwarzhaarigen Wirt noch mehr in Rage.
»Mach Platz, du Mistvieh!«, brüllt er das Tier an und tritt ihm auf die Pfoten. Der Hund jault schmerzvoll auf, zieht den Schwanz ein und versucht wegzulaufen.
»He, Meister Brümmer!«, ruft Wilhelm da. »Ich denke, Ihr seid zu gut für diese Welt?«
Der Wirt fährt herum. Mit zwei, drei Sätzen ist er bei Wilhelm und platsch, schlägt er ihm auf die Wange-
»Du naseweiser Rotzbengel, du!«
Wilhelm fasst sich an die brennende Backe, dreht sich um, läuft vom Hof und nimmt sich vor, ihn niemals wieder zu betreten. Aber dann ist Erich neben ihm, bewundert seinen Mut und sagt: »Nächstes Mal bist du schneller als der in seinen Latschen.«
In vierzehn Tagen ist alles vergessen. Wilhelm sitzt wieder auf dem Hocker hinter dem Klavier, liest »Die Throne im Himmel und auf Erden« und rätselt über den Widerspruch zwischen der Allmacht Gottes und dem freien Willen des Menschen. Und Heinrich Brümmer führt ihnen vor, wie brav Hasso Platz machen kann.
Eines Abends sehen sie den alten Gottlob Wenzel auf den Stufen zum Kirchplatz sitzen. Kein vernünftiger Mensch setzt sich da hin. Oben, ein paar Schritte weiter nur, ist die Bank rund um die alte Linde; da treffen sich nach Feierabend die jungen Mädchen und Burschen und singen und lachen und reden und streiten. Gottlob Wenzel, der allabendlich abseits auf dem kalten Stein sitzt, Pfeife raucht und unergründlich lächelt, ist oft genug geduldiges Ziel ihres Spotts. Und er ist auch ein leichtes Opfer für Erich und Wilhelm.
Die Bank ist noch leer, niemand scheint in der Nähe, die Pfeife liegt noch unbenutzt neben ihm, und Gottlob Wenzel genießt mit halb geschlossenen Augen die letzten Strahlen der Abendsonne.
»He, aufwachen, Gottlob!«, ruft Erich.
Der alte Mann sieht sie an und lächelt versonnen.
Jetzt ist Wilhelm an der Reihe. Mit Gottlob muss man reden wie mit einem kleinen Kind, hat Erich gesagt. Er leidet an Blödigkeit.
»Pastor Kleine schickt uns«, sagt Wilhelm. »Er schenkt dir von seinem Tabak.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, die ohnehin nur in Lächeln besteht, nimmt Wilhelm die Pfeife und stopft sie randvoll mit Kuhhaaren, die sie sich aus Bachmanns Stall besorgt haben.
»Bester Eichsfelder Krauter«, sagt Erich, während Wilhelm sorgfältig stopft.
Gottlob Wenzel nickt zufrieden, und als Wilhelm ihm die Pfeife reicht, steckt er sie widerspruchslos in den Mund. Dienstbeflissen reibt Wilhelm ein Zündholz an, es qualmt und knistert gewaltig im Pfeifenkopf, aber das selige Lächeln auf Gottlob Wenzels Gesicht bleibt ganz unverändert.
Zwei junge Burschen kommen die Straße herauf, und weil der erwartete Erfolg immer noch ausbleibt, ruft Erich ihnen zu: »Gottlob raucht Ochsenkraut! Gottlob raucht Ochsenkraut!«
Aber plötzlich schlägt die Kirchentür zu, der Onkel Kleine kommt mit langen, eiligen Schritten über den Kirchplatz. Wahrscheinlich hat er alles mit angesehen und gehört. Ärgerlich sieht er aus, gar nicht milde und freundlich wie sonst. Erich zieht es vor, das Weite zu suchen. Für Wilhelm gibt es kein Entrinnen.
»Ich werd dich lehren!«, schimpft der Onkel. »Was du dem Geringsten tust, das tust du mir!« Er reißt einen trockenen Georginenstängel vom Wegrand und schlägt damit drei-, viermal auf Wilhelms Hintern, bis der Stängel zerbricht.
Weh tut es nicht. Aber schmachvoll zieht Wilhelm mit dem Onkel davon. Die beiden jungen Burschen lachen hämisch. Und Gottlob Wenzel sitzt auf der Treppe, sieht auch dieser Szene freundlich lächelnd zu und schickt immer noch schwarzrauchigen Qualm in die Luft.
An einem Spätsommertag steigen sie wieder durch die Hinterhöfe. Die Birnen sind reif. Diese Köstlichkeit wollen sie sich nicht entgehen lassen. Erich weiß genau, wann die beste Zeit ist, die Obstgärten ungesehen zu plündern. Im Gras liegt viel Fallobst. Die Wespen machen sich daran zu schaffen. Und da hinten unter dem großen Birnbaum liegt auch wieder der alte Tanne.
Sie schleichen sich an wie beim vorigen Mal. Auf allen vieren durchs Gras. Aber als sie näher kommen, hören sie kein Schnarchen.
Wieder nimmt Erich einen kleinen Stock von der Erde auf, beugt sich vor, streckt den Arm aus, aber plötzlich verharrt er in der Bewegung.
Die Bartstoppeln sehen heute viel heller aus als sonst. Sind auch länger. Der Kopf zur Seite geneigt, die Augen starr und glasig. Der Mund steht offen und irgendwie schief. Zwei Fliegen laufen hinein und heraus.
Erichs Hand zittert. Dann schleudert er den Stock von sich und springt auf.
»Da ist kein Leben mehr drin!«, schreit Erich.
Sie rennen los und achten auf kein Hindernis.
Wie gut ist es, in Bewegung zu sein. Den Atem zu spüren, das Blut in den Adern und den jagenden Puls.