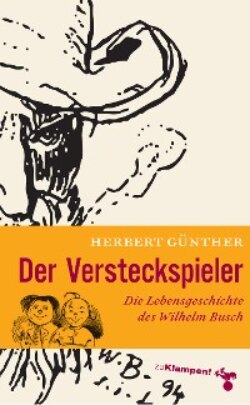Читать книгу Der Versteckspieler - Herbert Günther - Страница 11
III
Der Versager
ОглавлениеRote Kreise drehen sich, flimmern, lösen sich auf in warme Feuchtigkeit, bilden sich als Wellen neu, durchlaufen seinen Körper von unten nach oben, lassen ihn frösteln und treiben ihm Schweißperlen über die Stirn.
Die Sonne kann es nicht sein. Die Sonne hat sich kaum blicken lassen in diesen Tagen. Es ist Ende März 1853, der Himmel über Antwerpen ist verhangen, er sieht immer denselben Ausschnitt aus dem Fensterkreuz, milchgrau und unbewegt, selten mit ein, zwei Vogelpunkten, die sich schnell seinem Blickfeld entziehen. Stillstand seit Tagen. Er ist gefangen wie ein Vogel im Käfig. Das schneeweiße Federbett, die kleine Kammer, die Waschkommode, rissige Dielenbretter, die Petroleumlampe auf dem Nachttisch, der muffige Geruch, und der Blick wandert an den Deckenbalken entlang, immer dieselben Linien hin und her.
Heute Nacht, mitten in einem seiner Fieberträume, ist ihm auf einmal sein früher Tod nur logisch und konsequent erschienen. Die Hoffnungen, mit denen er nach Düsseldorf gegangen ist, liegen weit zurück. Er ist ein Versager. Den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen. Nichts bringt er zu Ende.
Leichtfertig hat er hingeworfen, wofür sie ihn bestimmt hatten. Hochmütig ist er seinen eigenen Wünschen gefolgt. Seinen eigenen Wünschen? Zweimal ist er dem August Klemme hinterher, erst nach Düsseldorf, dann nach Antwerpen. Maler wollte er werden. War das nicht noch anmaßender als Justus Ebhardts Seemannsträume? Auch Justus war in Antwerpen gelandet. Der Maler und der Seemann. Vereint als Strandgut hochfahrender Hoffnungen. Was hat er bloß gedacht? Hat er geglaubt, sie haben hier auf ihn gewartet, hier draußen in der großen Welt? Auf ihn, auf Wilhelm Busch, den Dorfjungen aus Wiedensahl?
Fast in jeder Nacht kommen sie wieder und verhöhnen ihn, die Spukgestalten, die edelschmächtigen weißen Gipsfiguren aus dem Antikensaal in Düsseldorf, wollen, dass er immer wieder und immer wieder von vorn ihre Rundungen und jenseitigen Blicke aufs Papier bringt. Ein Flüstern und Kichern erhebt sich. Hermes, der Götterbote, wirft sein weites Gewand über die Schulter, die klassisch schönen Gesichter verziehen sich zu gemeinem Grinsen, unzählige Arme strecken sich aus, unzählige Finger zeigen auf ihn. Wilhelms Zeichenstift fegt mit irrwitziger Geschwindigkeit übers Papier, als könne er den Aufstand der idealistischen Gipsköpfe nur durch rasendes Nachzeichnen bannen. Sie jagen ihn kreuz und quer durch den Saal und Wilhelm zeichnet wie besessen.
Unter die antiken Modelle haben sich jetzt auch Carl Friedrich Sohn, der Lehrer der Vorbereitungsklasse, und Wilhelm von Schadow, der Akademiedirektor, gemischt. »Kopieren, kopieren und nochmals kopieren!«, schreit Carl Friedrich Sohn, und von Wilhelm von Schadow, der im Nebel verschwindet, hallt es herüber: »Heilig! Klassisch! Historisch!« Sie jagen ihn bis auf die Straße hinaus, und ihr Johlen unterscheidet sich jetzt durch nichts mehr von dem der Hütekinder in Wiedensahl oder der Dorfjugend bei der Kirmesrauferei in Ebergötzen. Aber die Straße ist nun nicht mehr die Straße in Düsseldorf, der Lärm nähert sich dem Haus Pont au fromage Nr. 320 in Antwerpen, und Wilhelm hält sich die Ohren zu, er will das Spottgelächter nicht hören, aber sein Wehren ist zwecklos, der Lärm kommt von innen.
Irgendwo im Haus poltert es. Das Geräusch kommt näher. Die Tür geht auf. Im Schein der Kerze huschen zwei Gestalten in sein Zimmer. Er erkennt sie und seufzt erleichtert. Es sind seine Wirtsleute Jan und Mie Timmermans, sorgenvolle, gütige Menschen. Er, hager, mit Nachtmütze und Schlappen, sie, mollig, zwanzig Jahre älter als ihr Mann, im Nachthemd mit Spitzenkragen. Gemeinsam betreiben sie das Barbiergeschäft an der Käsbrücke, Sammelstelle für alltägliche Freuden und Sorgen.
»Herr Wilhelm, Herr Wilhelm«, beginnt Mie in ihrer herben flämischen Sprache, von der Wilhelm immer nur Wörter erraten kann, die dem Plattdeutschen ähnlich sind, aber nie alles versteht. Sie stellt die Kerze auf den Nachttisch, lüftet das dumpfe Federbett, macht ihm neue Wadenwickel und wischt ihm den Schweiß von der Stirn.
Gestern haben sie einen richtigen Arzt ins Haus geholt. Die eigenen Bartscherer-Mittel schienen ihnen nicht mehr zu reichen. Der spitzbärtige Mann hat ihn abgehorcht, beklopft und befühlt und am Ende bedächtig genickt, als habe sich seine schlimmste Befürchtung bestätigt. Wilhelm hat das Erschrecken von den Gesichtern seiner Wirtsleute gelesen. Typhus.
Von dieser Krankheit stehen viele nicht wieder auf. Noch ist er nicht einmal 21 Jahre alt. War das denn schon alles? Als er am Morgen aufwacht, sitzt Mie neben seinem Bett, schon wieder oder immer noch, er weiß es nicht. Manchmal werden die Feuerräder vor seinen Augen kleiner und manchmal verschwinden sie ganz. Dann blinzelt er zu ihr hinüber und findet ihre lächelnd gütigen Augen. Ach Mie, denkt er. Wie gut ist es, die Nähe eines Menschen zu spüren. Es braucht keine Worte. Es braucht überhaupt keine Worte.
Alles wirklich Wichtige ist mit Worten ohnehin nicht zu sagen. Was er sagen wollte, wollte er in Bildern sagen. In der »Muttersprache der Kunst«. Bilder, die er in sich geahnt hat, denen er nachspüren wollte sein Leben lang. Und nun hat er sie gesehen, mit eigenen Augen gesehen. Das, liebe, verständige Mie, das ist das Schönste und Schrecklichste zugleich, was deine Stadt, was Antwerpen für mich bereitgehalten hat: die Bilder. Zwei-, fast dreihundert Jahre sind sie alt. Peter Paul Rubens hat sie gemalt, Adriaen Brouwer, David Teniers und der unvergleichliche Frans Hals.
Alles, was er sagen wollte, ist mit diesen Bildern gesagt. So wie er es nie fertig bringen wird. Stümperei und Geschmier alles im Vergleich zu den großen Niederländern. Und kein akademisches Malenlernen wird ihn je dahin bringen, den alten Meistern auch nur das Wasser zu reichen.
Ach Mie, denkt er, wie gut ist es, zusammen schweigen zu können.