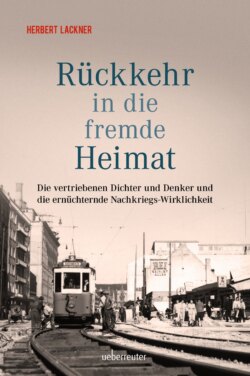Читать книгу Rückkehr in die fremde Heimat - Herbert Lackner - Страница 4
VORWORT
ОглавлениеAn jenem Juni-Nachmittag 2016, an dem ich mich im Garten des alten Jagdhauses in Mürzsteg zu John Sailer setzte, konnte ich natürlich nicht ahnen, dass aus dem nun folgenden Gespräch drei Bücher entstehen sollten.
Ich kannte John, wir sind beide seit vielen Jahren mit Heinz Fischer befreundet, er ist außerdem einer der wichtigsten Galeristen Wiens („Ulysses“). Der damals eben aus dem Amt scheidende Bundespräsident hatte uns und einige andere Freunde an diesem Tag zu einem kleinen Geburtstagsfest für seine Frau Margit eingeladen.
Österreich stand in diesem Jahr im Bann der Flüchtlingsströme, die sich infolge der Kriege im Nahen und Mittleren Osten in Bewegung gesetzt hatten. Natürlich sprach ich auch mit John über dieses Thema, das Geburtstagskind Margit Fischer wurde ja in der Emigration in Schweden geboren.
„Weißt Du eigentlich, wie ich mit meiner Familie geflüchtet bin?“, fragte mich John. Ich wusste, dass Johns Vater Karl Hans Sailer Redakteur der „Arbeiter Zeitung“ und nach 1934 Chef der in den Untergrund abgetauchten Sozialdemokraten war. Die Details der Flucht der Familie Sailer vor den Nazis kannte ich nicht. „Wir sind im Oktober 1940 auf dem letzten Ozeandampfer, der Europa verlassen hat, von Lissabon nach New York gekommen. Ich war erst drei, meine Eltern haben mir später erzählt, auf dem Schiff seien viele prominente Künstler gewesen.“
John erinnerte sich noch an den Namen des Schiffs: „Nea Hellas“.
Das erleichterte meine weiteren Recherchen. Die Ankünfte der Dampfer aus Europa samt deren Passagierlisten wurden im Verzeichnis des New Yorker Hafens penibel vermerkt, die Listen sind seit Kurzem online einsehbar.
Wenige Wochen später schrieb ich für „profil“ eine Geschichte über die Flucht der Familie Sailer und der von John erwähnten Prominenten auf der „Nea Hellas“. Ich hatte in den Passagierlisten Franz Werfel und seine Frau Alma Mahler-Werfel, Heinrich und Golo Mann, Alfred Döblin und seine Familie, Alfred Polgar sowie eine Reihe bekannter Sozialdemokraten gefunden.
Die „profil“-Geschichte war ausführlich, aber ich wusste, dass zu diesem Thema noch mehr zu erzählen war. Das Ergebnis weiterer Recherchen war das im September 2017 erschienene Buch „Die Flucht der Dichter und Denker – wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen“. Auch das dramatische Entkommen von Lion Feuchtwanger, Hannah Arendt, Karl Farkas, Robert Stolz, Hermann Leopoldi und anderer konnte ich nun beschreiben. Viele von ihnen waren mit einem von Thomas Mann aus den USA entsandten Fluchthelfer über geheime Pyrenäen-Pfade nach Spanien gelotst worden und schließlich, wie John Sailers Familie, von Lissabon über den Atlantik in die USA geflüchtet.
So ließ sich zeigen, dass Flüchtlinge nicht immer aus Syrien, Bosnien, Afghanistan oder Afrika kamen, sondern vor gar nicht so langer Zeit aus der Wiener Taborstraße, vom Alsergrund, aus Eisenstadt, Graz oder Berlin stammten.
„Die Flucht der Dichter und Denker“ wurde vom Publikum sehr gut aufgenommen und später mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet. Beim Schreiben hatte sich natürlich die Frage aufgedrängt, wie diese Größen des österreichischen und europäischen Kulturlebens die Zeit vor ihrer Flucht erlebt hatten. Hatte sie der Aufstieg des Faschismus irritiert? Hatten sie erkannt, welche Gefahr drohte? Sahen sie die von Michael Köhlmeier zitierten „vielen kleinen Schritte, von denen jeder zu klein schien für eine große Empörung“ und die dann doch zum „großen Bösen“ führten?
Im September 2019 habe ich versucht, diese Fragen in meinem Buch „Als die Nacht sich senkte. Europas Dichter und Denker am Vorabend von Faschismus und der NS-Barbarei“ zu beantworten. Es ist die Vorgeschichte der im ersten Buch beschriebenen Flucht. Sie begleitet die oben Genannten, aber auch Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Albert Einstein, Bertolt Brecht und andere durch die zwei dramatischen Jahrzehnte zwischen dem Ende der Monarchie und dem Finis Austriae im Jahr 1938.
Diese Arbeit ist nun der letzte Teil meiner Flucht-Trilogie. Es geht darin um die Rückkehr der Flüchtlinge in ein Land, in dem man sie beraubt hat, aus dem sie vertrieben wurden, in dem man ihre Lieben ermordet hat.
Wie wird man sie empfangen? Haben Krieg und Shoah jene bekehrt, die lachend dabeigestanden sind, als Juden die Gehsteige schrubben mussten? Jene, die am Heldenplatz oder im Spalier ihrem „Führer“ zujubelten und nichts dabei fanden, sich ein wenig in den Wohnungen der vertriebenen Nachbarn „umzusehen“?
Wie denken die Menschen im vom Nationalsozialismus befreiten Österreich?
Mich hat der oft zitierte Satz „Wir haben unsere Geschichte nicht aufgearbeitet“ in seiner Unschärfe immer etwas ratlos zurückgelassen. Wie lief dieses Nicht-Aufarbeiten ab? Wer deckte zu, wer schaute weg? Wer forderte immer ganz schnell ein Ende der Debatte? Welche in die Gehirne gepflanzten NS-Irrlehren haben überdauert?
Den Antworten auf solche Fragen versuche ich mich in diesem Buch zu nähern. Noch vor wenigen Jahren wäre eine Erzählung dieser Art nicht möglich gewesen. Seither wurden bis dahin nur schwer zugängliche Archive geöffnet und digitalisiert, etwa jene der Österreichischen Nationalbibliothek, der Wien Bibliothek, der Akademie der Wissenschaften und anderer Institutionen, denen dafür nicht genug gedankt werden kann.
Wie in den beiden anderen Büchern habe ich auf das Setzen von ermüdenden Fußnoten verzichtet, Originalzitate kursiv gesetzt und die Quelle im Text angegeben. Sie sind jederzeit dokumentierbar.
Dieses Buch ist eine Reise durch Nachkriegsösterreich – durch ein uns heute fremdes, aber in manchen Teilen doch erschreckend vertrautes Land.
Herbert Lackner