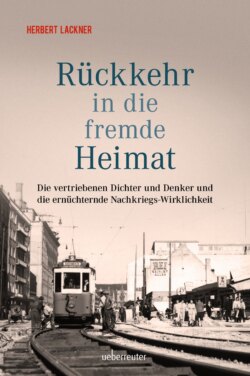Читать книгу Rückkehr in die fremde Heimat - Herbert Lackner - Страница 6
New York/Wien 1945/46 DREI FLÜCHTLINGE HABEN HEIMWEH
ОглавлениеKarl Farkas, Hermann Leopoldi und Robert Stolz, große Unterhaltungsstars der Zwischenkriegszeit, sind mit knapper Not dem Tod entronnen. Jetzt planen sie die Rückkehr nach Wien, haben aber Bedenken.
Am Tag, an dem Adolf Hitler in seinem Führerbunker Selbstmord begeht, am 30. April 1945, feiert Karl Farkas seinen größten Triumph: Er tritt in der berühmten New Yorker Carnegie Hall auf. „Vienna at Night“ heißt die Operette, deren Libretto er zur Musik von Johann Strauß geschrieben hat. Er spielt selbst mit.
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Spaßmacher aus dem Wiener Kabarett „Simpl“ in den USA einschlägt? Man hätte nicht einmal hoch darauf gewettet, dass es Farkas überhaupt nach New York schafft. Es war ja tatsächlich knapp, die Gestapo war hinter ihm her.
Mit dem letzten Zug war er im März 1938 aus Wien in die Tschechoslowakei entkommen, sein Freund und kongenialer „Simpl“-Partner Fritz Grünbaum schaffte es nicht mehr über die Grenze. Er versteckte sich noch einige Wochen in Wien, dann wurde er an die Gestapo verraten. „Den Grünbaum haben wir!“, jubelte die Wiener Nazi-Presse.
Farkas und Grünbaum waren Hassobjekte der braunen Machthaber: „Sie setzten die neuen Einrichtungen des nationalsozialistischen Deutschlands in der perfidesten Art herunter. In ihren krampfhaften und geistlosen Witzen machten sie selbst vor den führenden Männern des neuen Deutschlands nicht halt“, höhnte der „Völkische Beobachter“, nachdem Farkas geflohen und Grünbaum ins KZ verschleppt worden war.
Als sich die Nazis anschickten, auch die Tschechoslowakei zu besetzen, flüchtete Farkas nach Paris. Seine Frau Anny und sein zehnjähriger Sohn Robert („Bobby“) kamen nach. Aber bald zeichnete sich ab, dass Nazi-Deutschland in absehbarer Zeit auch über Frankreich herfallen würde. Nun blieb ihnen nur noch die Flucht nach Übersee. Doch auch dieser Weg war versperrt: Das amerikanische Konsulat in Paris teilte der Familie Farkas ohne Umschweife mit, dass sie keine Visa bekommen würde. Robert hatte als Kleinkind eine Gehirnhautentzündung und war seither geistig behindert – und an Behinderte und Kranke wurden keine US-Visa ausgegeben. Schweren Herzens fuhren Anny und Robert zurück nach Wien und dann nach Bresnitz, ein kleines Dorf in Südböhmen, in dem Annys Eltern lebten.
Karl Farkas schlug sich mit Auftritten in Pariser Cafés durch. Als die Wehrmacht im September 1939 über Polen herfiel und das mit Polen verbündete Frankreich damit formal im Kriegszustand mit Deutschland war, wurde Farkas wie alle deutschen und österreichischen Flüchtlinge im wehrfähigen Alter in ein französisches Internierungslager gesteckt. Auch im Lager spielte er Kabarett.
Wenige Monate später marschierte die Wehrmacht in Belgien, den Niederlanden und Frankreich ein. Die meisten der in Lagern Internierten wurden vor der Ankunft der SS-Fahnder freigelassen und flohen ins noch unbesetzte Südfrankreich. In der Christnacht des Jahres 1940 überstieg Farkas die Pyrenäen Richtung Spanien und fuhr dann mit der Bahn nach Portugal. Er war jetzt 47.
Im Zielort Lissabon angekommen, spielte er wieder Kabarett. Da die Transatlantik-Schiffe New York wegen der U-Boot-Gefahr nicht mehr anliefen, ging es im Jänner 1941 auf einem der letzten Kähne, die sich noch auf den Atlantik wagten, zuerst nach Kuba und von dort entlang der US-Küste nach Norden.
Karl Farkas war auf hoher See, als sein Freund und Partner Fritz Grünbaum nach langen Qualen am 14. Jänner 1941 im Konzentrationslager Dachau starb. Nach dem Krieg wird man das Farkas nachtragen und nicht den Nazis. Er habe sich nicht um ihn gekümmert, heißt es im Mundfunk.
Auf Ellis Island im Hafen von New York wurde Karl Farkas sofort interniert: Er hatte ja kein Affidavit, also keine Garantieerklärung von amerikanischen Gastgebern, die sich bereit erklärten, im Notfall für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Die US-Grenzbehörden drohten, ihn mit dem nächsten Schiff zurück nach Europa zu schicken. Bereits in die USA geflohene Freunde, eilig zusammengetrommelt vom Autor Alexander Roda-Roda – er war auf demselben Schiff wie Farkas nach New York gekommen –, erlegten 5000 Dollar Kaution (nach heutiger Kaufkraft etwa 85.000 Euro) und bekamen ihn frei.
Farkas machte sofort wieder, was er an seinen früheren Fluchtorten gemacht hatte: Er spielte in kleinen Cafés und Theatern Kabarett, um auf eigenen Beinen stehen zu können.
Ein Jahr nach seiner Ankunft in den USA bekam er eine kleine Rolle in einem Emigrantentheater: In „Die letzten Tage der Menschheit“ gab Karl Farkas einen Reporter. Dann trat er im „Zigeunerbaron“ auf und als „Frosch“ in der „Fledermaus“.
Es lief gut für den Flüchtling Farkas, es gab ja Publikum. In Yorkville rund um Manhattans 86. Straße war ein deutschsprachiger Stadtteil gewachsen. Hier lebten Zuwanderer aus Deutschland und Österreich, die bald nach der Jahrhundertwende gekommen waren. Vor den Nazis geflohene Neuankömmlinge fanden das Stadtviertel als Ersatzheimat und siedelten sich ebenfalls hier an.
Der aus Wien vertriebene Komponist Emmerich Kálmán schrieb 1944 in New York eine Operette mit dem Titel „Marinka“, in der es um Kronprinz Rudolf und dessen Ende in Mayerling ging. Karl Farkas arbeitete am Libretto mit. Das Stück lief 32 Wochen lang am berühmten „Winter Garden“-Theater am Broadway.
Und nun, Ende April 1945, also der Auftritt in der Carnegie Hall.
Farkas ist einer der wenigen, die es in den USA geschafft haben, aber er leidet, weil er seit fünf Jahren keinen Kontakt mit seiner Familie hat. In Paris hatten Anny und Karl Farkas 1940 vor der Trennung einen damals beliebten Schlager von Tino Rossi ins Herz geschlossen: „J’attendrai“ („Ich werde warten“):
„J‘attendrai
Le jour et la nuit
J‘attendrai, toujours
Ton retour.“
Sie hatten zwei Platten gekauft und jeder der beiden spielte die seine in diesen fünf Jahren der Trennung wohl Hunderte Male.
Ende August 1945 erreicht Karl endlich der erste Brief seiner Frau. Sie erzählt ihm von den harten Kriegsjahren im südböhmischen Dorf und von Sohn Bobby, der jetzt 17 ist: „Er ist größer geworden, größer als Du. Er ist ein Kind, lieblich und gut gewachsen. Er ist mehr aktiv geworden, aber das ist für ihn und seine Umgebung nicht günstig. Manchmal lacht er grundlos. Er spricht, aber meist nur Dummheiten. Und immer dieselbe Sache.“
Beide Schwestern Karls wurden ermordet, schreibt Anny. Aus der Familie Farkas hat nur eine nach London geflüchtete Nichte den Terror der Nazis überlebt. Die letzte Zeile des Briefs lautet: „Deine Anny, die sehr müde ist.“
Karl Farkas will nicht zurück nach Wien, in die Stadt, aus der man seine Familie und seine Freunde in Vernichtungslager verschleppt hat, um sie dort umzubringen, nicht in dieses Trümmerfeld. Er will, dass Anny und Bobby nach New York kommen, hier hat er Erfolg, hier werden sie gut leben.
Aber der Plan zerschlägt sich rasch. Bobby hat mit seiner Behinderung auch nach dem Krieg keine Chance, die strengen Gesundheits-Checks auf Ellis Island im Hafen von New York zu bestehen. Und in einem Heim wollen die Eltern ihren Sohn nicht zurücklassen. Karl Farkas entschließt sich schweren Herzens zur Rückkehr nach Wien. An Anny schreibt er: „Ich weiß, es ist eine Dummheit New York gegen Wien einzutauschen, ich weiß, daß ich nie mehr im Leben solche Angebote und soviel Geld haben werde.“ Und noch etwas anderes quält ihn: „Glaubst Du, daß ich in Wien arbeiten könnte? Wie ist die Einstellung gegenüber den Juden und den Flüchtlingen?“
Die Frage kommt nicht von ungefähr. Karl Farkas weiß, dass die Nazi-Presse eine üble und absurde Kampagne gegen ihn und andere bekannte Emigranten geführt hat.
Gleich nach seiner Flucht hatte die Wiener Ausgabe des „Völkischen Beobachters“ geschrieben: „Im Stadttheater konnte man vom Schnürboden aus die widerlichsten Szenen beobachten, zu denen Farkas Girls und arme Schauspielschülerinnen zwang. Wer sich seinen Wünschen entgegenstellte, flog unweigerlich aus dem Vertrag.“ 1941 „jiddelte“ das Nazi-Blatt sogar, um Farkas zu diskreditieren: „Die Neuyorker können stolz darauf sein, was ihnen ihr jüdischer Präsident Roosevelt für einen jüdischen Misthaufen mitten in Neuyork aufgeschichtet hat: Hermann Leopoldi, die Comedian Harmonists und – endlach ist er bei saine Lait – der ‚geistvolle‘ Karl Farkas, das jüdische Brechmittel.“ Immer wieder erinnert der „Völkische Beobachter“ an „die widerliche Grimasse Karl Farkas“.
Farkas will nun also durchaus zu Recht wissen, wie die Einstellung der Österreicher zu Juden und zu ihm selbst ist. Annys Antwort ist nicht ermutigend: „Du fragst mich, ob Du noch ein Publikum hättest? Ich glaube, daß sich alles sehr verändert hat. Die Dichter und Denker wurden getötet oder vertrieben. Und die anderen? Ich glaube nicht mehr an das goldene Wienerherz. Sie waren so böse und ich habe Angst, daß sich ihre Meinung nicht geändert hat.“
Karl Farkas hat in New York mit einem anderen, in Friedenszeiten noch berühmteren Österreicher eng zusammengearbeitet, mit dem Komponisten und Dirigenten Robert Stolz.
Stolz, ein gebürtiger Grazer, ist bei Kriegsende 65. In Deutschland und Österreich war er vor seiner dramatischen Flucht ein großer Star. An jeder Straßenecke wurden seine Schlager gesungen: „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“, „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ und natürlich „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“. Stolz schrieb das Lied 1916, als er mit den „Deutschmeistern“ im Biergarten „Schweizerhaus“ im Wiener Prater aufspielte.
Als Hitler 1933 die Macht in Deutschland übernahm, arbeitete Robert Stolz gerade in Berlin an der Musik zu Tonfilmen, eine aufregende Neuerung, die ihn fesselte. Er war kein Jude, hatte nichts zu befürchten. Im Gegenteil: Das NS-Regime hätte sich gern mit ihm, dem beliebten Komponisten und Dirigenten, geschmückt. Aber Robert Stolz verachtete die Nazis und ihre Führer.
In den folgenden Jahren brachte er immer wieder jüdische Freunde aus Deutschland über die Grenze nach Österreich. Stolz versteckte sie unter den Rücksitzen seiner Gräf & Stift-Limousine. Seinen Chauffeur ließ er zur Tarnung ein Hakenkreuz-Fähnchen am Kotflügel aufstecken.
Die Grenzposten kontrollierten den Promi nicht, sie salutierten.
Im März 1938 floh Robert Stolz wie viele seiner Freunde von Wien nach Paris. Nach Kriegsbeginn im September 1939 wurde auch er interniert – in einem Fußballstadion nahe der Hauptstadt.
Der Komponist, er war jetzt 59, hatte kurz zuvor eine ebenfalls aus Wien geflohene polnische Jüdin namens Yvonne Louise Ulrich kennengelernt. Sie war 24 und betreute Emigranten. Joseph Roth brachte sie Rotwein, der ebenfalls von ihr umsorgte Operettenkomponist Paul Abraham nannte sie „Einzi“, die Einzige, die sich um die Flüchtlinge aus Wien kümmert.
Robert Stolz wurde von Einzi das Leben gerettet. Durch ihre guten Beziehungen gelang es ihr, den an einer Lungenentzündung Erkrankten im November 1939 aus dem Stadion freizubekommen. Die Rettungsaktion mündete in eine Lebensliebe. Im März 1940 verließen Robert Stolz und Einzi auf einem von Genua auslaufenden Transatlantik-Schiff Europa.
In den USA konnte der Komponist bald an seine frühere Karriere anknüpfen: Zweimal war seine Filmmusik für den Oscar nominiert, seine Stücke wurden zuerst in New York und Boston und dann auch in anderen großen Städten der USA aufgeführt.
Die Meldung, dass Adolf Hitler tot ist und Nazi-Deutschland die bedingungslose Kapitulation unterschrieben hat, platzt am 8. Mai 1945 in ein von Robert Stolz dirigiertes Operettenkonzert im Chicagoer Grant Park. Die fast 60.000 Zuschauer erheben sich und singen „God Bless America“. „Es war, als seien wir alle soeben von einem besonders abscheulichen Alptraum erwacht“, beschreibt Robert Stolz in seinen Memoiren seine Gefühle in diesem Moment.
Jetzt zieht es ihn zurück nach Wien. Amerikanischen Journalisten, die ihn fragen, warum er sein angenehmes Leben in New York mit einem sicher weniger komfortablen im zerstörten Wien tauschen wolle, erzählt Stolz, er wolle einfach „noch einmal die Minoritenkirche im Schnee“ sehen. Und er singt ihnen seinen Schlager „The Woods of Vienna are Calling“ vor, den ins Englische übertragenen Gassenhauer „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“.
Kurz vor seinem Tod im Jahr 1975 schreibt Robert Stolz in seinen Lebenserinnerungen: „Ich war überzeugt, daß meine Musik einen kleinen Beitrag zur Wiedergenesung Österreichs und Deutschlands nach dem Nationalsozialismus würde leisten können.“
Aber selbst er, der große Star der Zwischenkriegszeit, kann nicht sicher sein, in der alten Heimat freundlich empfangen zu werden. Die Nazi-Presse hatte hemmungslos gegen ihn gehetzt: „Der ‚arische‘ Stolz-Hahn auf dem jüdischen Misthaufen“, hatte das NS-Organ „Völkischer Beobachter“ einen Artikel über ein Stolz-Konzert für österreichische Flüchtlinge in New York getitelt: „Das Charakterschwein Robert Stolz mit seinem ungewaschenen Rüssel spielt jetzt den Emigranten auf.“
Als Robert und Einzi Stolz 1940 nach New York kamen, waren sie zu zweit. Jetzt, bei Kriegsende, sind sie eine dreiköpfige Familie: Einzis siebenjährige Tochter Clarissa aus erster Ehe ist nach einer dramatischen Irrfahrt dazugekommen.
Einzi hatte vor der Flucht mit ihrem Ehemann, einem deutlich älteren Bankier, in der Wiener Löwelstraße gelebt. Unmittelbar nach der Ankunft an ihrem Fluchtort London hatte sie im März 1938 eine Tochter geboren. Sie gab ihr den Namen Clarissa. Aber die Geburt des Mädchens konnte die Ehe nicht mehr kitten. Einzi zog zu ihrem Bruder nach Paris, Clarissa blieb vorerst beim Vater in London.
Im September 1940 – da waren Robert Stolz und seine Retterin Einzi schon in New York – sollte Clarissa zur Mutter in die USA geschickt werden. Clarissas Vater arbeitete für den britischen Geheimdienst und konnte Plätze für die Zweijährige und ihre Nanny auf dem Passagierdampfer „City of Benares“ ergattern. Das Schiff lief in Liverpool aus und steuerte das kanadische Quebec an. An Bord waren 406 Personen, darunter 90 Kinder, die wegen der Bombenangriffe der deutschen Luftwaffe auf englische Städte in Sicherheit gebracht werden sollten.
Am vierten Tag der Atlantiküberquerung, die „City of Benares“ befand sich gerade südwestlich von Island, wurde das Schiff bei schwerem Wellengang von einem deutschen U-Boot torpediert. Wegen der raschen Schräglage des Passagierdampfers konnte nur ein Teil der Rettungsboote zu Wasser gelassen werden. 248 Passagiere ertranken, also mehr als die Hälfte. Nur 6 der 90 Kinder überlebten. Clarissa und ihre Nanny schafften es in eines der Rettungsboote, die in diesem entlegenen Gebiet des eisigen Nordatlantik bei hohem Seegang zum Teil erst acht Tage nach dem Untergang der „City of Benares“ von der britischen Navy gefunden wurden.
Einige Monate später wurde Clarissa mit einem Flugzeug in die USA gebracht, wo sie im Mai 1945 als Siebenjährige das Kriegsende mit ihrer Mutter Einzi und ihrem bisher kinderlosen und daher besonders entzückten Stiefvater Robert Stolz erlebt.
Aber Einzi weiß noch nicht, dass ihre Mutter und ihre Schwestern in Treblinka ermordet wurden.
Neben Karl Farkas und Robert Stolz ist auch ein dritter großer Unterhaltungskünstler aus Wien bei Ende des Kriegs in New York: Hermann Leopoldi.
Wie die Schlager von Robert Stolz waren auch jene von Leopoldi vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten überaus beliebt: „In einem kleinen Café in Hernals“, „Schön is so a Ringlspiel“, „Schnucki, ach Schnucki, fahr ma nach Kentucky, in der Bar Old Shatterhand spielt a Indianerband“ – da konnte jeder mitsingen. Armin Berg, Hans Moser, Karl Valentin und viele andere traten in Leopoldis Lokal in der Wiener Rothgasse auf.
In der Nacht zum 12. März 1938 versuchten Leopoldi und seine Frau Eugenie mit demselben Zug wie Fritz Grünbaum Österreich Richtung Tschechoslowakei zu verlassen. Aber die Grenzen waren gesperrt. Die Leopoldis fuhren zurück in ihre Wohnung in der Marxergasse. Ende April 1938 kam die Gestapo. Hermann Leopoldi wurde in ein provisorisches Gefängnis in einer Schule in der Karajangasse gebracht, wo zu dieser Zeit auch ein Student namens Bruno Kreisky einsaß. Dann deportierte die Gestapo den 50-Jährigen ins Konzentrationslager Dachau und im September 1938 ins KZ Buchenwald.
Leopoldis Frau Eugenie durfte nach New York ausreisen, ihre Eltern lebten dort bereits seit einigen Jahren und betrieben ein Geschirrgeschäft. Im Februar 1939 gelang es Hermann Leopoldis Schwiegereltern, ihn aus Buchenwald freizukaufen. Das funktionierte damals noch, weil die Nazis froh waren, beim Volk besonders beliebte jüdische Häftlinge unauffällig loszuwerden. Außerdem brauchten sie Geld.
In New York trat Leopoldi in „Eberhardt’s Café Grinzing“ auf. Dort lernte er die um 26 Jahre jüngere Helly Möslein kennen, die schon 1930 mit ihren Eltern in die USA ausgewandert war. Bald traten die beiden nicht nur als Gesangsduo auf, sie wurden ein Paar.
Wie Robert Stolz amerikanisierte auch Leopoldi sein Repertoire: Aus „I bin a stiller Zecher“ wurde „I am a quiet Drinker“ und aus dem kleinen Café in Hernals „A Little Café Down the Street“.
Seinem Publikum im deutschsprachigen Stadtteil Yorkville um Manhattans 86. Straße bot er auch eine Art Lebenshilfe. In seinem Lied „Da wär’s halt gut, wenn man Englisch könnt’“ formulierte er seine und ihre Probleme: „Die Sprache, die ich früher sprach, die konnt’ ich fließend sprechen,/doch Englisch language, Schreck lass nach,/ da hab ich halt noch Schwächen.“
In der New Yorker Emigrantenszene hatte er einen besonderen Status. Einzi Stolz erinnerte sich später: „Leopoldi war für uns alle irgendwie ein Wesen von einem anderen Stern, hatte er doch das Grauen der KZ-Lager von Buchenwald überstanden.“
Hermann Leopoldi und Helly Möslein könnten in den USA durchaus ihr Glück machen. Aber Leopoldi hat Heimweh. A little Café down the Street kann ihm die Wiener Beisln nicht ersetzen.
Wie seine Freunde Karl Farkas und Robert Stolz wird er zu den ersten gehören, die es ins zerstörte Österreich zieht. Aber es dauert noch eine Weile, bevor sie diese Heimreise ins Ungewisse antreten können.